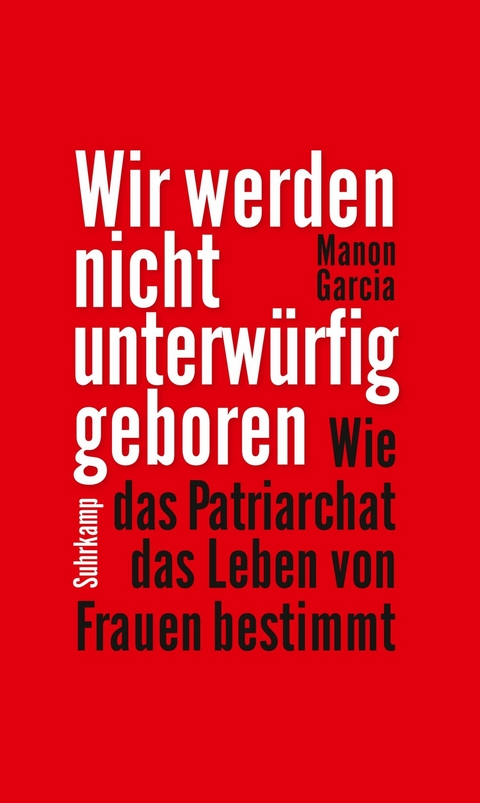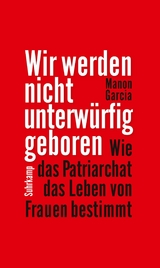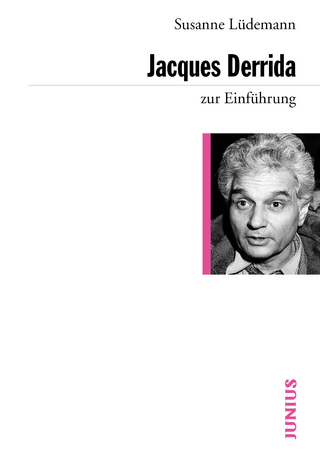Wir werden nicht unterwürfig geboren (eBook)
200 Seiten
Suhrkamp Verlag
978-3-518-76793-1 (ISBN)
Die feministischen Debatten der Gegenwart werfen ein hartes Licht auf die Kehrseite der Männerherrschaft: die Zustimmung der Frauen zu ihrer eigenen Unterwerfung. Diese wurde als philosophisches Tabu und blinder Fleck des Feminismus in der Komplexität der gelebten Existenz bislang nie im Detail analysiert.
Im direkten Dialog mit dem Denken Simone de Beauvoirs stellt sich Manon Garcia dieser Aufgabe und meistert sie mit philosophischer Bravour. Und sie macht deutlich, warum es wichtig ist, die Mechanismen der Selbstunterwerfung von Frauen zu verstehen. Denn dieses Verstehen ist die notwendige Voraussetzung für jede Emanzipation.
Manon Garcia, geboren 1985, ist nach Stationen in Harvard und Yale Professorin für Praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin. In Frankreich zählt sie zu den einflussreichsten und meistgelesenen Philosophinnen ihrer Generation. Ihre Bücher sind in zahlreiche Sprachen übersetzt. Für <em>Das Gespräch der Geschlechter. Eine Philosophie der Zustimmung</em> erhielt sie 2022 den Prix des Rencontres philosophiques de Monaco.
2
Weibliche Unterwerfung, eine Tautologie?
Wer die Unterwerfung der Frauen denken möchte, muss sich zunächst mit folgendem Problem auseinandersetzen: Da die Vorstellung, dass ihre Unterwerfung natürlich sei, den Frauen eindeutig schadet, ist man versucht, bei der Unterwerfung wegzusehen, zu sagen, dass es so etwas wie eine weibliche Unterwerfung nicht gibt, dass es sich nur um eines der vielen sexistischen Vorurteile handelt. Doch der Sprachgebrauch, die klassische wie die populäre Kultur und die medialen Darstellungen lassen vermuten, dass es in der Unterwerfung etwas Weibliches gibt oder in der Weiblichkeit etwas Unterwürfiges. Der unterwürfige Mann wird oft wegen seines Mangels an Männlichkeit verspottet; die klassischen Modelle der Weiblichkeit sind Modelle der Unterwerfung unter die Männer. Was ist davon zu halten?
Sind Frauen Masochistinnen?
Wenn von Unterwerfung die Rede ist, kommen einem gewöhnlich folgende Figuren in den Sinn: die unterwürfige Frau, der Sklave, der besiegte Krieger. Beim Sklaven – der quasi immer als ein Sklave gesehen wird – wie auch beim besiegten Krieger ist die Unterwerfung das Ergebnis eines physischen Zwangs, gegen den sie nichts ausrichten können. Sie tragen für die Unterwerfung keine Verantwortung, abgesehen davon, dass der Krieger nicht stark genug gewesen ist, um seine Unterwerfung zu verhindern. Bei der Figur der unterwürfigen Frau erscheint die Unterwerfung hingegen als gewählt, so dass die Frau dafür verantwortlich ist. Die Unterwerfung ist hier eine Form von billigender Passivität, die entweder die Haltung ist, die von einer respektablen Frau erwartet wird – man denke an die auf Odysseus wartende Penelope –, oder eine entwürdigende Form von Weiblichkeit – gegen die zum Beispiel die Aktivistinnen von Ni putes ni soumises Stellung bezogen. Wenn man die Unterwerfung als ein moralisches Problem betrachtet, weil sie einen freiwilligen und unmoralischen Verzicht auf die eigene Freiheit beinhaltet, fällt einem als typisches Beispiel eine Frau ein.
Die Unterwerfung als etwas typisch Weibliches zu begreifen, findet sich in der alltäglichen Vorstellung wieder, dass die Frauen von Natur aus Masochistinnen sind und dass dieser Masochismus sowohl die häusliche und eheliche Gewalt als auch die Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt erklärt. Dass diese Vorstellung falsch ist, wurde immer wieder bewiesen,1 doch ist sie so weitverbreitet, dass es interessant ist, sich ihre Wurzeln in Sigmund Freuds Theorie des Masochismus anzusehen. Das Problem, das der Masochismus für die Psychoanalyse aufwirft, ist der scheinbare Widerspruch, den eine aus erlittenem Schmerz gewonnene Lust darstellt, insbesondere im sexuellen Bereich. Dies ist nicht nur ein psychologisches Problem – ist es eine Form von Perversion oder Wahnsinn, am Schmerz Lust zu empfinden? –, sondern auch ein logisches. In der Tat werden Lust und Schmerz im Verhältnis zueinander definiert, sie sind Gegensätze, und als solche erscheint der Masochismus als eine Infragestellung des Prinzips der Nicht-Widersprüchlichkeit. Wenn es Lust gibt, dann sollte es keinen Schmerz geben und vice versa. Auch wenn die Lust am Schmerz theoretisch undenkbar ist, stellen Ärzte und Psychiater auf der praktischen Ebene fest, dass einige ihrer Patienten am Schmerz Lust empfinden, und schreiben dies, insbesondere wegen des darin zum Ausdruck kommenden logischen Widerspruchs, einer Form von Perversion zu. Da Freud mit diesem Problem konfrontiert war, schrieb er zwischen 1905 und 1924 drei Texte, die die Grundlage des psychoanalytischen Konzepts des Masochismus bilden:2 »Die sexuellen Abirrungen« (1905), »Ein Kind wird geschlagen« (1919) und »Das ökonomische Problem des Masochismus« (1924).
Der Masochismus ist gemäß Freud eine Abweichung, eine sekundäre Form, des Sadismus. Wenn man, wie er, die Libido als eine Form des Selbsterhaltungsinstinkts betrachtet, kann die masochistische Neigung in ihrer Destruktivität tatsächlich keinen Sinn machen, da der Masochismus sich genau gegen den Selbsterhaltungsinstinkt zu richten scheint. Um diesen Widerspruch aufzulösen, stellt Freud die Hypothese auf, dass es zwischen dem Sadismus, verstanden als sexueller Wunsch, Schmerz zuzufügen, und dem Masochismus einen chronologischen Zusammenhang gibt. Freud definiert den Masochismus als Gegenstück des Sadismus, erklärt ihn aber als eine abgestufte und sekundäre Form davon. In Phantasien wie der, die er in »Ein Kind wird geschlagen« untersucht, tritt der Masochismus in Verbindung mit dem Schuldbewusstsein auf: Das Kind hat ein inzestuöses und sadistisches Begehren, das aufgrund des Schuldbewusstseins, das es gegenüber diesem Phantasma empfindet, in Masochismus umschlägt.3 Darin liegt die Besonderheit des Masochismus: Er entsteht aus dem Schuldbewusstsein. Die Lust wird in den Schmerz und die Erniedrigung verlagert. Der Masochismus wird nicht mehr als eine passive Abirrung verstanden, sondern als die Umwendung des verdrängten sadistischen Triebs gegen sich selbst (in dem Fall, den er untersucht, will das Kind, dass das andere Kind vom Vater geschlagen wird, weil dies ein Beweis dafür wäre, dass der Vater das andere Kind nicht liebt).
Die inzestuöse Dimension der masochistischen Umkehrung führt Freud zu der Hypothese vom Geschlechtsunterschied im Masochismus: Es gebe einen weiblichen Charakter des Masochismus. Freud fragt sich, welchen Einfluss das Geschlecht der Patienten auf die Entfaltung dieser Phantasie hat, und stellt fest, dass der Masochismus der Männer »einer femininen Einstellung [entspricht]«,4 das heißt, dass der Masochismus nur eine Ausdrucksform unter anderen der – femininen – Passivität dieser Männer ist. Insofern sich die Phantasie der Männer und die Phantasie der Frauen nicht genau entsprechen, kommt er zu dem Schluss, dass sich »in beiden Fällen die Schlagephantasie von der inzestuösen Bindung an den Vater ableitet«, das heißt, dass der Masochismus bei den Frauen eine normale Folge des Ödipuskomplexes ist, während er bei den Männern eine »verkehrte Ödipuseinstellung« ist, da er den Vater betrifft. Bei den Frauen ist der Masochismus normal, bei den Männern ist er pervers.
Die Idee von einem femininen, mit Passivität identifizierten Charakter des Masochismus entfaltet Freud in »Das ökonomische Problem des Masochismus«. Hier schlägt er eine Typologie der Masochismen vor: Man muss drei Formen des Masochismus unterschieden, »einen erogenen, femininen und moralischen Masochismus«.5 Der erogene Masochismus, der der primäre Masochismus ist, ist die dem erlittenen Schmerz entnommene Lust; er ist im wesentlichen sexueller Natur. Obgleich dieser Masochismus als die Urform dargestellt wird, von der sich die beiden anderen ableiten, bietet Freud keine Erklärung für ihn.6 Der feminine Masochismus ist für Freud nicht der Masochismus der Frauen – er wird nur in seinem Vorkommen bei perversen Männern betrachtet. Er entspricht der Lust an der Passivität, das heißt an einer passiven psychischen und sexuellen Position. Bei Freud wird das Paar Aktivität/Passivität als ein Grundgegensatz begriffen, der im Zentrum der Geschlechterdifferenz steht und die Definition von Maskulinität (als Aktivität) und Femininität (als Passivität) mitbestimmt; folglich wird der Wunsch nach Passivität als ein feminines Begehren identifiziert. Nach Freud ist dies der am einfachsten zu beobachtende Masochismus, weshalb er als erster analysiert wird. Er beruht auf dem primären Masochismus und drückt ein Schuldgefühl aus.
Der moralische Masochismus ist die große Neuerung der Freud'schen Konzeption. Er besteht darin, Haltungen der Selbstgeißelung als masochistisch zu identifizieren. Der moralische Masochismus kommt in einem übersteigerten Schuldgefühl zum Ausdruck. Die beiden Hauptunterschiede zwischen dem moralischen Masochismus und den anderen Formen des Masochismus sind zum einen, dass der moralische Masochismus keine sexuelle Dimension hat – er hat »seine Beziehung zu dem, was wir als Sexualität erkennen, gelockert«7 –, und zum anderen, dass die Identität...
| Erscheint lt. Verlag | 10.5.2021 |
|---|---|
| Übersetzer | Andrea Hemminger |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | ON NE NAIT PAS SOUMISE, ON LE DEVIENT |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Philosophie ► Philosophie der Neuzeit |
| Schlagworte | aktuelles Buch • Bücher Neuererscheinung • Bücher Neuerscheinung • De Beauvoir • Feminismus • metoo • Neuererscheinung • neuerscheinung 2024 • neues Buch • On ne nait pas soumise on le devient deutsch • Selbstunterwerfung • Simone de Beauvoir • STW 2434 • STW2434 • suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2434 |
| ISBN-10 | 3-518-76793-3 / 3518767933 |
| ISBN-13 | 978-3-518-76793-1 / 9783518767931 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich