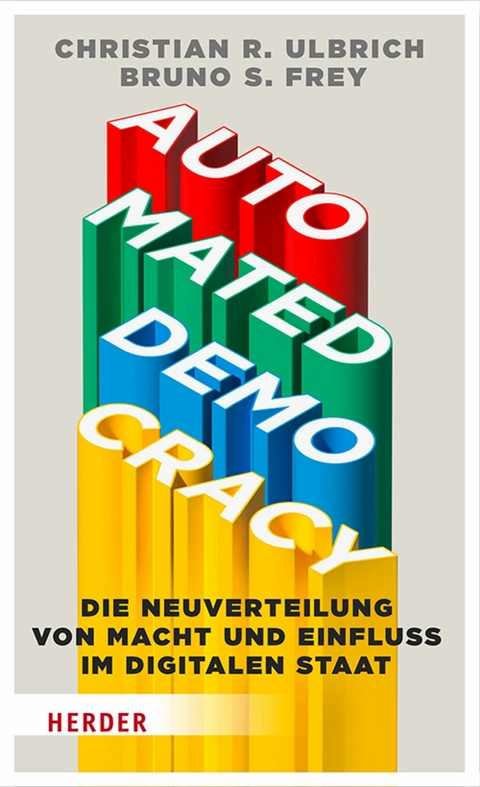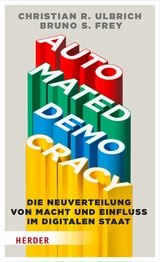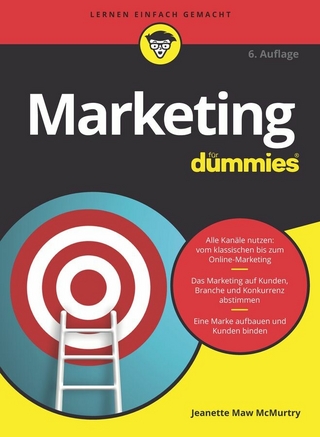Automated Democracy (eBook)
352 Seiten
Verlag Herder
978-3-451-83285-7 (ISBN)
Bereits jetzt ist erkennbar, wie digitale Transformation des Staates von den gleichen grundlegenden digitalen Dynamiken und Mechanismen angetrieben wird, die schon die Wirtschaft durchgerüttelt und einschneidend geprägt haben. In ihrem neuen Buch beleuchten Christian R. Ulbrich und Bruno S. Frey die Hintergründe dieser Dynamiken und Mechanismen und erläutern, welche bisher kaum beachteten Risiken und Chancen sie für unser demokratisches Gemeinwesen mit sich bringen. Sie machen konkrete und innovative Vorschläge, wie zentrale demokratische Institutionen digital-technologisch gestützt zukunftsfest gemacht werden.
Im Zeitalter permanenter digitaler Transformation auf nahezu allen Ebenen muss sich der Staat im Digitalen neu erfinden. Er tut es richtig oder er scheitert – zulasten von Demokratie, sozialem Zusammenhalt und Wohlstand.
Christian R. Ulbrich ist Leiter und Mitbegründer der Forschungsstelle für Digitalisierung in Staat und Verwaltung (e-PIAF) an der Universität Basel, wo er das Forschungsprojekt zum digitalen Staat initiierte und bis heute betreut. Zuvor arbeitete er zu den disruptiven Folgen digitaler Steuerbehörden in einem der global führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen. Er beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren intensiv mit der digitalen Transformation von Staat, Gesellschaft und Unternehmen. Bruno S. Frey ist Ständiger Gastprofessor an der Universität Basel sowie Forschungsdirektor von CREMA in Zürich. Er war ordentlicher Professor für Finanzwissenschaft an der Universität Konstanz, Visiting Research Professor an der Universität Chicago, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Zürich und Distinguished Professor an der Universität Warwick. Für seine Arbeit wurde Frey vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit fünf Ehrendoktorwürden. Er gilt als einer der wichtigsten Ökonomen im deutschsprachigen Raum und als einer der meistzitierten politischen Ökonomen der Welt.
| Erscheint lt. Verlag | 8.4.2024 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Beruf / Finanzen / Recht / Wirtschaft ► Wirtschaft |
| Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika | |
| Schlagworte | Bürokratieabbau • Demokratie • Digitalisierung • Direkte Demokratie • Disruption • Rechtsstaat • Überwachung • Unterdrückung |
| ISBN-10 | 3-451-83285-2 / 3451832852 |
| ISBN-13 | 978-3-451-83285-7 / 9783451832857 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich