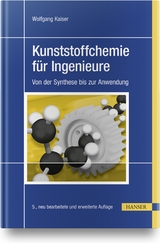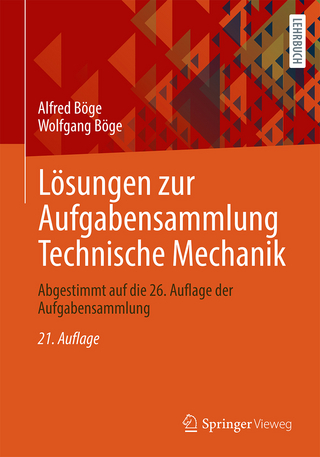Kunststoffchemie für Ingenieure
Hanser (Verlag)
978-3-446-45191-9 (ISBN)
- Titel erscheint in neuer Auflage
- Artikel merken
Wer Kunststoffe, ihre Eigenschaften, Verarbeitung und Anwendungen von Grund auf verstehen möchte, muss sich mit ihrer Chemie befassen. Das seit Jahren bewährte Lehrbuch macht es Ihnen leicht, sich diese spannende Thematik zu erschließen. Es ist anschaulich geschrieben, dabei fachlich fundiert und grundlegend. Die für die Beschreibung der Polymer-Synthesen verwendeten chemischen Gleichungen richten sich im Grundsatz nach den von den Rohstoff-Erzeugern genutzten industriellen Verfahren. Der dadurch gewonnene Einblick in die Chemie der Polymere bleibt demzufolge trotz aller Theorie praxisbezogen.
Neu bearbeitet und um Themen ergänzt: Schadenverhütung/Schadensanalyse, moderne Verfahren beim Recycling von Kunststoffen
Dieser anregende »Chemie-Cocktail« aus Theorie und Praxis eignet sich als Lehrbuch, als Nachschlagewerk oder als Hilfe bei der Werkstoffauswahl.
Prof. Dr. Wolfgang Kaiser begründete für Ingenieure in der Schweiz eine systematische Aus- und Weiterbildung in der Kunststofftechnik; an der FH Nordwestschweiz und am Departement Materialwissenschaften der ETH Zürich. Er war mitverantwortlich für den Aufbau des Kunststoff-Ausbildungs- und Technologie-Zentrums (KATZ) in Aarau und dessen langjähriger Geschäftsführer in Personalunion. Wolfgang Kaiser ist Autor und Koautor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen auf dem Gebiet der Kunststofftechnik.
Vorwort zur fünften Auflage 7
Vorwort zur ersten Auflage 9
Prof. Dr. phil. II Wolfgang Kaiser 11
Hinweise zur Benutzung des Buches 13
Inhalt 19
1 Einführung 41
1.1 Werkstoffklassen 41
1.1.1 Werkstoffauswahl bei Kunststoffen 42
1.1.2 Internationale Vereinbarungen/Normen – die geheimen Helfer 43
1.1.3 Werkstoffdatenbanken 44
1.2 Bedeutung der Kunststoffe 44
1.2.1 Wachstumsursachen 44
1.2.1.1 Die Petrochemie als Rohstofflieferant 45
1.2.1.2 Leichtgewicht Kunststoff 46
1.2.1.3 Energiegünstiges Verhalten 46
1.2.1.4 Komplexe Formteilgeometrien und hoher Automatisierungsgrad 47
1.2.1.5 Nutzung von Synergien 47
1.2.1.6 Hohe Wertschöpfung des Erdöls 48
1.2.2 Kunststoffe und die Grundbedürfnisse des Menschen 48
1.2.2.1 Nahrung 48
1.2.2.2 Bekleidung 49
1.2.2.3 Wohnung 49
1.2.2.4 Gesundheit 49
1.2.2.5 Soziale Bedürfnisse 50
1.3 Geschichte der Kunststoffe 51
1.3.1 Kurzer Abriss der Entwicklung der Polymer- wissenschaften (ohne Copolymere und Blends) 54
1.4 Zukunft der Kunststoffe - Prognosen 65
1.4.1 Zukünftiger Pro-Kopf-Verbrauch von Kunststoff- Werkstoffen 66
1.4.2 Erwartungen an Polymere 67
1.4.3 Zukünftige Rohstoffquellen 69
1.5 Wirtschaftsdaten und Grafiken zu Kunststoffen 71
1.5.1 Einteilung der Kunststoffproduktion nach Typ und Bedarf in Einsatzgebieten 71
1.5.2 Europe (EU 28) Entwicklung der Beschäftigtenzahl 73
1.5.3 Einteilung der Kunststoffe nach ihrem Eigenschaftsprofil 73
2 Grundlagen 77
2.1 Was sind Kunststoffe 78
2.1.1 Einteilung der Kunststoffe 81
2.1.2 Makromolekül-Architektur/Topologie 82
2.2 Bildungsreaktionen für Makromoleküle -- Polyreaktionen 85
2.2.1 Kettenpolymerisation 86
2.2.1.1 Radikalische Kettenpolymerisation 87
2.2.1.2 Kationische Kettenpolymerisation 91
2.2.1.3 Anionische Kettenpolymerisation 92
2.2.1.4 Koordinative Kettenpolymerisation/Polyinsertion 94
2.2.1.5 Homo- und Copolymerisate 95
2.2.1.6 Chemische Vernetzung durch Kettencopolymerisation 97
2.2.1.7 Verfahrenstechnik der Kettenpolymerisation 97
2.2.1.8 Plasmapolymerisation 102
2.2.2 Kondensationspolymerisation (Polykondensation) 102
2.2.3 Additionspolymerisation (Polyaddition) 107
2.2.4 Verfahrenstechnik der Kondensationspolymerisation und Additionspolymerisation 108
2.2.5 Einteilung nach dem Typ der Aufbaureaktionen 109
2.2.6 Chemische Umsetzungen an Makromolekülen 110
2.2.6.1 Vergrößerung des Polymerisationsgrads 110
2.2.6.2 Beibehaltung des Polymerisationsgrads 110
2.2.6.3 Verringerung des Polymerisationsgrads 111
2.2.6.4 Chemische Umsetzungen an makromolekularen Naturstoffen 111
2.3 Bindungskräfte in makromolekularen Systemen 112
2.3.1 Hauptvalenzbindungen 112
2.3.2 Nebenvalenzbindungen 115
2.3.3 Ionenbindungen 119
2.3.4 Mechanische Bindungen 119
2.4 Strukturmerkmale von Kunststoffen 120
2.4.1 Chemische Struktur 121
2.4.1.1 Konstitution 121
2.4.1.2 Konfiguration 127
2.4.2 Festkörperstruktur 129
2.4.2.1 Räumliche Anordnung eines Makromoleküls 129
2.4.2.2 Räumliche Anordnung mehrerer Makromoleküle zu einem Verband 130
2.4.2.3 Kristallinität 133
2.4.3 Mittlere Molmasse M und Molmassenverteilung 135
2.4.3.1 Kettenlänge 135
2.4.3.2 Molmasse M bei niedermolekularen Verbindungen 136
2.4.3.3 Mittlere MolmasseM und Molmassenverteilung bei hochmolekularen Verbindungen 136
2.4.3.4 Mittlerer Polymerisationsgrad 138
2.4.3.5 Beeinflussung von Eigenschaften durch die mittlere Molmasse 139
2.5 Modifizierung von Polymeren und Kunststoffen 140
2.5.1 Chemisches Modifizieren von Polymeren 140
2.5.1.1 Steuerung von Synthesereaktionen 140
2.5.1.2 Copolymerisation 141
2.5.1.3 Andere chemische Modifikationen 141
2.5.2 Physikalische Modifizierung von Polymeren und Kunststoffen 141
2.5.2.1 Polymergemische und Polymerblends 141
2.5.2.2 Erhöhung der Ordnung in Polymeren 142
2.5.3 Modifizieren mit Zusatzstoffen (Additive) 144
2.5.3.1 Füllstoffe 145
2.5.3.2 Verstärkungsstoffe 146
2.5.3.3 Weichmacher 147
2.5.3.4 Treibmittel 147
2.5.3.5 Farbmittel 147
2.5.3.6 Stabilisatoren 148
2.5.3.7 Flammhemmende Zusätze 149
2.5.3.8 Weitere Additivgruppen 149
2.6 Wichtige Eigenschaften der Kunststoffe 151
2.6.1 Fließverhalten (Rheologie) von Kunststoff-Schmelzen 151
2.6.1.1 Viskositätsfunktionen von Thermoplastschmelzen 153
2.6.1.2 Zeitverhalten von thermisch instabilen Thermoplast- Schmelzen und reagierenden Formmassen 155
2.6.2 Thermisch-mechanisches Verhalten 157
2.6.2.1 Thermoplaste 157
2.6.2.2 Elastomere und Duroplaste 160
2.6.3 Chrono-mechanisches Verhalten 162
2.6.4 Verhalten gegen Umwelteinflüsse 165
2.6.4.1 Chemische Beständigkeit 165
2.7 Alterung und Alterungsschutz 168
2.7.1 Alterung und Alterungsvorgänge 168
2.7.1.1 Chemische Alterungsvorgänge 168
2.7.1.2 Physikalische Alterungsvorgänge 171
2.7.2 Alterungsschutz 171
2.8 Wichtige Aspekte bei der Schadenverhütung und Schadensanalyse im Kunststoffbereich 175
2.8.1 Thermoanalyse (TA) zur Schadenverhütung/ Schadensanalyse 176
2.8.1.1 Differential-Kalorimetrie (Differenial-Scanning-Calorimetry), DSC 177
2.8.2 Mikroskopische Gefügeanalyse an Bauteilen und Halbzeug 179
3 Technologie der Ver- und Bearbeitung von Kunststoffen 183
3.1 Allgemeines 183
3.2 Begriffe und Einteilung der Fertigungsverfahren nach DIN 8850 183
3.2.1 Prinzip der wichtigsten Ver- und Bearbeitungsverfahren 186
3.3 Pathologische Technologie 186
3.3.1 Pathologie eines Werkstoffs, Beispiel Kunststoff 186
3.3.2 Chemische Reaktionen bei der Ver- und Bearbeitung von Kunststoffen 187
3.3.2.1 Chemische Reaktionen im Aufgabenbereich des Verarbeiters 188
3.3.2.2 Kunststofferzeugung beim Verarbeiter 189
3.4 Aufbereitung/Compoundierung 190
3.4.1 Maschinenhersteller (Beispiele®) 192
3.4.2 Einteilung der Aufbereitungs-Walzwerkverfahren 192
3.4.2.1 Einteilung der Aufbereitungs-Walzwerkverfahren 192
3.4.2.2 Dosieren und Mischen 192
3.4.2.3 Granulieren 195
3.4.2.4 Zerkleinern 195
3.4.2.5 Vortrocknen 196
3.4.3 Pathologischer Befund bei den Aufbereitungsverfahren 196
3.5 Urformen 199
3.5.1 Extrudieren (Strangpressen) 200
3.5.1.1 Aufbau eines Extruders 201
3.5.1.2 Hersteller von Extrusionsanlagen (Beispiele®) 205
3.5.1.3 Beispiele typischer Extrusionsanlagen 205
3.5.2 Blasformen 208
3.5.2.1 Extrusionsblasformen 209
3.5.2.2 Extrusions-Streckblasformen 211
3.5.2.3 Spritzblasformen 212
3.5.2.4 Spritz-Streckblasformen 212
3.5.3 Spritzgießen 213
3.5.3.1 Hersteller von Spritzgießmaschinen (Beispiele®) 213
3.5.3.2 Verfahrenstechnik beim Spritzgießen 213
3.5.3.3 Spritzgießmaschine 215
3.5.3.4 Einflussgrößen auf die Formteilqualität beim Spritzgießen 216
3.5.3.5 Sonderverfahren der Spritzgießtechnik 218
3.5.3.6 Spritzgießen von vernetzenden Polymeren 222
3.5.4 Pressen, Spritzpressen, Schichtpressen 223
3.5.4.1 Formpressen von Duroplasten 223
3.5.4.2 Pressen von Thermoplasten 225
3.5.4.3 Spritzpressen von Duroplasten 225
3.5.4.4 Schichtpressen von Duroplasten 225
3.5.5 Kalandrieren 226
3.5.5.1 Hersteller von Kalanderanlagen (Beispiele®) 226
3.5.5.2 Bauarten des Kalanders 226
3.5.5.3 Verfahrenstechnik beim Kalandrieren 227
3.5.6 Spinnverfahren 228
3.5.6.1 Grundlagen des Spinnprozesses 229
3.5.6.2 Herstellung von Chemiefasern 229
3.5.6.3 Textile Definitionen 235
3.5.6.4 Textile Flächengebilde 236
3.5.7 Faserverbundkunststoff (FVK)-Urformen 237
3.5.7.1 Prepregverarbeitung 237
3.5.7.2 Faserspritzen 238
3.5.7.3 Faserwickeln 238
3.5.7.4 Pultrusion 239
3.5.7.5 RTM-Verfahren 239
3.5.7.6 Handlaminieren 240
3.5.8 Schäumen 241
3.5.8.1 Herstellung eines Schaumstoffes 243
3.5.8.2 Einteilung der Schäumverfahren 244
3.5.8.3 Polystyrol-Schaumstoffe 244
3.5.8.4 Polyurethan-Schaumstoffe 246
3.5.9 Gießen 252
3.5.9.1 Vakuumgießen 253
3.5.9.2 Rotationsformen (Rotationsgießen) 255
3.5.9.3 Schleuderverfahren (Schleudergießen) 255
3.5.9.4 Filmgießen (Foliengießen) 255
3.5.9.5 Einbetten, Imprägnieren, Tränken 256
3.5.10 Tauchformen 256
3.5.11 Additive Fertigungsverfahren/3D-Druckverfahren (Additive Manufacturing AM) 256
3.5.11.1 Polymerisation als Basis für AM 257
3.5.11.2 Kunststoffe als Basis für AM 259
3.5.12 Pathologischer Befund beim Urformen 260
3.6 Umformen 263
3.6.1 Hersteller von Thermoformmaschinen (Beispiele®) 263
3.6.2 Unterschiede im Warmformbereich zwischen amorphen und teilkristallinen Thermoplasten 264
3.6.3 Einteilung der Warmformverfahren für Thermoplaste 264
3.6.3.1 Biegeumformen 264
3.6.3.2 Zugumformen 265
3.6.3.3 Zugdruckumformen 265
3.6.3.4 Kombinierte Verfahren 265
3.6.4 Verfahrenstechnik beim Warmformen 266
3.6.5 Thermoformmaschinen 268
3.6.6 Pathologischer Befund beim Umformen 269
3.6.7 Vor- und Nachteile des Warmformens 271
3.7 Trennen (Spanen) 271
3.8 Fügen 273
3.8.1 Schweißen 273
3.8.1.1 Hersteller von Schweißmaschinen für Thermoplaste 273
3.8.1.2 Grundlagen 274
3.8.1.3 Schweißverfahren (Auswahl) 276
3.8.1.4 Pathologischer Befund beim Schweißen 278
3.8.2 Kleben 279
3.8.2.1 Grundlagen 279
3.8.2.2 Abbindemechanismus der Klebung 281
3.8.2.3 Verfahrenstechnik 282
3.8.2.4 Arbeitssicherheit und Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Klebstoffen 282
3.8.3 Mechanische Verbindungen 282
3.9 Beschichten 283
3.9.1 Einteilung der Beschichtungsverfahren 283
3.9.2 Streichverfahren 283
3.9.3 Pulverbeschichten 285
3.10 Veredeln 285
3.10.1 Lackieren von Kunststoffen 286
3.10.2 Bedrucken von Kunststoffen 286
3.10.3 Laserbeschriften 288
3.10.4 Heißprägen 288
3.10.5 Metallisieren 288
3.10.6 Beflocken 290
3.10.7 Plasmabeschichten 290
3.10.8 Tempern 291
3.10.9 Konditionieren 292
3.10.10‚Bestrahlen 292
4 Polyolefine 295
4.1 Polyethylen (PE) 295
4.1.1 Das Wichtigste in Kürze 295
4.1.2 Handelsnamen (Beispiele®) 295
4.1.3 Eigenschaften 296
4.1.4 Verarbeitung und Anwendung 297
4.1.5 Anwendungsbeispiele 298
4.1.6 Der Weg zum Polyethylen 299
4.1.6.1 Hochdruckverfahren 299
4.1.6.2 Niederdruckverfahren 300
4.1.7 Der molekulare Aufbau des Polyethylens 303
4.1.7.1 Polyethylene mit multimodaler Molmassenverteilung 304
4.1.7.2 Ethylen-Copolymere mit ?-Olefinen 305
4.1.7.3 Metallocen-katalysierte Ethylencopolymere (PE-MC) 306
4.2 Chemische Modifikation von Polyethylen 307
4.2.1 Abwandlung durch Vernetzen 307
4.2.2 Abwandlung durch chemische Veränderungen 308
4.2.3 Weitere Ethylen-Copolymere 309
4.2.3.1 Unpolare Ethylen-Copolymere 309
4.2.3.2 Polare Ethylen-Copolymere 310
4.3 Polypropylen (PP) 315
4.3.1 Das Wichtigste in Kürze 315
4.3.2 Handelsnamen (Beispiele®) 315
4.3.3 Eigenschaften 316
4.3.4. Verarbeitung und Anwendung 317
4.3.5 Anwendungsbeispiele 317
4.3.6 Der Weg zum Polypropylen 318
4.3.7 Der molekulare Aufbau von Polypropylen 319
4.3.7.1 Isotaktisches Polypropylen (iPP) 320
4.3.7.2 Syndiotaktisches Polypropylen (sPP) 320
4.3.7.3 Ataktisches Polypropylen (aPP) 321
4.4 Modifikation von Polypropylen 321
4.4.1 PP-Copolymere 321
4.4.2 Gefüllte und verstärkte Polypropylene 322
4.4.3 Chemische Modifikation am fertigen PP-Polymer 323
4.5 Polyisobutylen (PIB) 323
4.5.1 Handelsnamen (Beispiele®) 323
4.5.2 Eigenschaften 323
4.5.3 Verarbeitung (Beispiele) 324
4.5.4 Anwendungsbeispiele 324
4.5.5 Der Weg zum Polyisobutylen 324
4.6 Polybuten-1 (PB-1) 325
4.6.1 Handelsnamen (Beispiele®) 325
4.6.2 Eigenschaften, Verarbeitung und Anwendung 325
4.6.3 Der Weg zum Polybuten-1 326
4.7 Poly-4-methylpenten-1 (PMP) 326
4.7.1 Handelsnamen (Beispiel®) 326
4.7.2 Eigenschaften 326
4.7.3 Verarbeitung (Beispiele) 327
4.7.4 Anwendungsbeispiele 327
4.7.5 Der Weg zum Poly-4-methylpenten-1 327
4.8 Geschichtliches 328
4.9 Tabellarischer Eigenschaftsvergleich 329
5 Halogenierte Kunststoffe I 333
5.1 Hart-PVC (Hart-Polyvinylchlorid) PVC-U (weichmacherfreies Polyvinylchlorid) 333
5.1.1 Das Wichtigste in Kürze über Hart-PVC-U 333
5.1.2 Handelsnamen (Beispiele®) 334
5.1.3 Eigenschaften 334
5.1.4 Verarbeitung (Beispiele) 335
5.1.5 Anwendungsbeispiele 336
5.1.6 Der Weg zum Polyvinylchlorid 336
5.2 Modifizierte Vinylchlorid-Polymerisate 340
5.2.1 Vinylchlorid-Copolymere 341
5.2.1.1 Einteilung 341
5.2.1.2 Eigenschaften, Verarbeitung und Anwendung 342
5.2.1.3 Der Weg zu den Vinylchlorid-Copolymeren 342
5.2.2 Besonders schlagfestes Polyvinylchlorid (PVC-HI) 343
5.2.2.1 Eigenschaften, Verarbeitung und Anwendung 343
5.2.2.2 Der Weg zum besonders schlagfesten Polyvinylchlorid 343
5.2.3 Chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C) 344
5.2.3.1 Eigenschaften, Verarbeitung und Anwendung 344
5.2.3.2 Der Weg zum chlorierten Polyvinylchlorid 345
5.3 Weich-Polyvinylchlorid (PVC-P) (Weich PVC, weichmacherhaltiges PVC) 345
5.3.1 Das wichtigste in Kürze über Weich-Polyvinylchlorid 345
5.3.2 Handelsnamen (Beispiele®) 346
5.3.3 Eigenschaften 346
5.3.4 Verarbeitung (Beispiele) 347
5.3.5 Anwendungsbeispiele 347
5.3.6 Der Weg zum Weich-Polyvinylchlorid 348
5.3.6.1 Weichmacher 348
5.3.6.2 Einarbeitung von Weichmachern 350
5.4 Chloriertes Polyethylen (PE-C) 352
5.4.1 Handelsnamen (Beispiele®) 352
5.4.2 Eigenschaften, Verarbeitung und Anwendung 352
5.4.3 Der Weg zum chlorierten Polyethylen 352
5.5 Polyvinylidenchlorid (PVDC) 354
5.5.1 Das Wichtigste in Kürze 354
5.5.2 Handelsnamen (Beispiele®) 354
5.5.3 Eigenschaften, Verarbeitung und Anwendung von Vinylidenchlorid-Copolymerisaten 354
5.5.4 Der Weg zu den Vinylidenchlorid-Copolymerisaten 355
5.6 Geschichtliches 355
5.7 Tabellarischer Eigenschaftsvergleich 356
6 Polystyrol-Kunststoffe 359
6.1 Das Wichtigste in Kürze über Polystyrol-Kunststoffe 359
6.2 Polystyrol (PS) 360
6.2.1 Handelsnamen (Beispiele®) 360
6.2.2 Ataktisches Polystyrol 360
6.2.2.1 Eigenschaften 360
6.2.2.2 Verarbeitung (Beispiele) 361
6.2.2.3 Anwendungsbeispiele 361
6.2.2.4 Der Weg zum Polystyrol 361
6.2.3 Stereoreguläre Polystyrole 363
6.3 Modifizierte Styrolpolymere (Abschnitt 6.4 bis 6.8) 364
6.4 Styrol-Acrylnitril-Copolymerisat (SAN) 365
6.4.1 Handelsnamen (Beispiele®) 365
6.4.2 Eigenschaften und Verarbeitung 365
6.4.3 Anwendungsbeispiele 366
6.4.4 Der Weg zum Styrol-Acrylnitril 366
6.5 Schlagzäh modifiziertes Polystyrol (PS-I) (Styrol-Butadien SB) 367
6.5.1 Handelsnamen (Beispiele®) 367
6.5.2 Eigenschaften 367
6.5.3 Verarbeitung (Beispiele) 368
6.5.4 Anwendungsbeispiele 368
6.5.5 Der Weg zum schlagzähen Polystyrol 368
6.6 Acrylnitril-Butadien-Styrol-Polymerisate (ABS) 371
6.6.1 Handelsnamen (Beispiele®) 372
6.6.2 Eigenschaften 372
6.6.3 Verarbeitung (Beispiele) 372
6.6.4 Anwendungsbeispiele 372
6.6.5 Der Weg zum Acrylnitril-Butadien-Styrol 373
6.7 Schlagzähe Acrylnitril-Styrol-Formmassen (ASA, AES, ACS) 375
6.7.1 Handelsnamen (Beispiele®) 375
6.7.2 Eigenschaften, Verarbeitung und Anwendung von Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) 375
6.7.3 Der Weg zum Acrylnitril-Styrol-Acrylat 376
6.8 Blends 377
6.8.1 PS-I + PPE Blends 377
6.8.2 ABS + PC bzw. ASA + PC Blends 377
6.8.3 ABS + PA Blends 378
6.8.4 PS + PE Blends 378
6.9 Geschichtliches zu den Styrolpolymeren 378
6.10 Tabellarischer Eigenschaftsvergleich 380
7 Ester-Thermoplaste 385
7.1 Ester-Gruppe in der Hauptkette 386
7.1.1 Polyalkylenterephthalate („gesättigte“ Polyester) (PET, PBT) und Polyethylennaphthalat (PEN) 386
7.1.1.1 Das Wichtigste in Kürze über Polyalkylenterephthalate 386
7.1.1.2 Der Weg zu den Polyalkylenterephthalaten 386
7.1.1.3 Polyethylenterephthalat (PET) 388
7.1.1.4 Polybutylenterephthalat (PBT) 390
7.1.1.5 Polytrimethylenterephthalat (PTT) 391
7.1.1.6 Modifizierte Polyalkylenterephthalate 391
7.1.1.7 Polyethylennaphthalat (PEN) 392
7.1.1.8 Geschichtliches 393
7.1.2 Polycarbonat (PC) 394
7.1.2.1 Das Wichtigste in Kürze über Polycarbonat 394
7.1.2.2 Handelsnamen (Beispiele®) 394
7.1.2.3 Eigenschaften 394
7.1.2.4 Verarbeitung (Beispiele) 395
7.1.2.5 Anwendungsbeispiele 395
7.1.2.6 Der Weg zum Polycarbonat 395
7.1.2.7 Modifizierte Polycarbonate 397
7.1.2.8 Geschichtliches 400
7.1.3 Polyestercarbonat (PEC) 400
7.1.3.1 Das Wichtigste in Kürze 400
7.1.3.2 Handelsnamen (Beispiele®) 400
7.1.3.3 Eigenschaften 400
7.1.3.4 Verarbeitung (Beispiele) 401
7.1.3.5 Anwendungsbeispiele 401
7.1.3.6 Der Weg zu Polyestercarbonat 401
7.1.3.7 Geschichtliches 402
7.2 Ester in der Seitenkette 402
7.2.1 Polymethylmethacrylat (PMMA) 402
7.2.1.1 Das Wichtigste in Kürze 402
7.2.1.2 Handelsnamen (Beispiele®) 402
7.2.1.3 Eigenschaften 402
7.2.1.4 Verarbeitung (Beispiele) 403
7.2.1.5 Anwendungsbeispiele 403
7.2.1.6 Der Weg zum Polymethylmethacrylat 403
7.2.1.7 Modifizierte Methylmethacrylate und Derivate 404
7.2.1.8 Geschichtliches 406
7.3 Celluloseester (CA, CB, CP, CAB, CAP) 407
7.3.1 Das Wichtigste in Kürze 407
7.3.2 Handelsnamen (Beispiele®) 407
7.3.3 Eigenschaften 407
7.3.4 Verarbeitung (Beispiele) 408
7.3.5 Anwendungsbeispiele 408
7.3.6 Der Weg zu den Celluloseestern 408
7.3.6.1 Der Ausgangsstoff Cellulose 408
7.3.6.2 Chemische Umsetzungen an Cellulose 409
7.3.7 Geschichtliches 410
7.4 Tabellarischer Eigenschaftsvergleich 411
8 Stickstoff-Thermoplaste 419
8.1 Polyamide (PA) 419
8.1.1 Teilkristalline aliphatische Polyamide 419
8.1.1.1 Das Wichtigste in Kürze 419
8.1.1.2 Handelsnamen (Beispiele®) 421
8.1.1.3 Eigenschaften 422
8.1.1.4 Verarbeitung (Beispiele) 423
8.1.1.5 Anwendungsbeispiele 424
8.1.1.6 Der Weg zu den teilkristallinen aliphatischen Polyamiden 424
8.1.1.7 Wasserstoffbrücken (H-Brücken) 428
8.1.2 Modifizierte teilkristalline aliphatische Polyamide 429
8.1.2.1 Chemische Modifizierung 429
8.1.2.2 Physikalische Modifizierung 429
8.1.2.3 Anwendungsbeispiele 430
8.1.3 Cycloaliphatische Polyamide 430
8.1.3.1 Das Wichtigste in Kürze 430
8.1.3.2 Handelsnamen (Beispiele®) 431
8.1.3.3 Eigenschaften 431
8.1.3.4 Verarbeitung (Beispiele) 431
8.1.3.5 Anwendungsbeispiele 431
8.1.3.6 Der Weg zu den cycloaliphatischen Polyamiden 432
8.1.4 Teilaromatische Polyamide 432
8.1.4.1 Das Wichtigste in Kürze 432
8.1.4.2 Handelsnamen (Beispiele®) 434
8.1.4.3 Eigenschaftsprofil im Vergleich zu Standard-Polyamiden 434
8.1.4.4 Verarbeitung (Beispiele) 434
8.1.4.5 Anwendungsbeispiele 434
8.1.4.6 Der Weg zu den teilaromatischen Polyamiden 435
8.1.5 Modifizierung von teilaromatischen Polyamiden 436
8.1.6 Geschichtliches 436
8.2 Polyacrylnitril PAN 438
8.2.1 Das Wichtigste in Kürze 438
8.2.2 Handelsnamen (Beispiel®) 438
8.2.3 Eigenschaften von Polyacrylnitril-Barriere- Kunststoffen 438
8.2.4 Verarbeitung und Anwendung (Beispiele) 439
8.2.5 Der Weg zu Polyacrylnitril-Barriere-Kunststoffen 439
8.2.6 PAN-Fasertransformation zu Kohlenstofffasern (C-Fasern) 440
8.2.7 Geschichtliches 440
8.3 Tabellarischer Eigenschaftsvergleich 441
9 Acetal- und Ether-Thermoplaste 449
9.1 Polyoxymethylen (Polyacetal) (POM) 450
9.1.1 Das Wichtigste in Kürze 450
9.1.2 Handelsnamen (Beispiele®) 450
9.1.3 Eigenschaften 450
9.1.4 Verarbeitung (Beispiele) 451
9.1.5 Anwendungsbeispiele 451
9.1.6 Der Weg zum Polyoxymethylen 452
9.1.6.1 POM-Homopolymerisat (POM-H) 452
9.1.6.2 POM-Copolymerisate (POM-C) 453
9.1.6.3 Eigenschaftsunterschiede zwischen POM-Homo- und Copolymerisaten 454
9.1.7 Modifizierte Polyoxymethylen-Polymerisate 454
9.1.8 Geschichtliches 455
9.2 Polyphenylenether (PPE) 456
9.2.1 Das Wichtigste in Kürze 456
9.2.2 Handelsnamen (Beispiele®) 456
9.2.3 Eigenschaften 456
9.2.4 Verarbeitung (Beispiele) 457
9.2.5 Anwendungsbeispiele 457
9.2.6 Der Weg zum Polyphenylenether 457
9.2.7 Weitere modifizierte Polyphenylenether 458
9.2.8 Geschichtliches 459
9.3 Tabellarischer Eigenschaftsvergleich 459
10 Halogenierte Kunststoffe II 463
10.1 Polytetrafluorethylen (PTFE) 463
10.1.1 Das Wichtigste in Kürze 463
10.1.2 Handelsnamen (Beispiele®) 463
10.1.3 Eigenschaften 463
10.1.4 Verarbeitung (Beispiele) 464
10.1.5 Anwendungsbeispiele 465
10.1.6 Der Weg zum Polytetrafluorethylen 466
10.2 Thermoplastisch verarbeitbare Fluor-Kunststoffe 468
10.2.1 Das Wichtigste in Kürze 469
10.2.2 Fluorthermoplaste und Beispiele® von Handelsnamen 469
10.2.3 Eigenschaften 470
10.2.4 Verarbeitung (Beispiele) 470
10.2.5 Anwendungen 470
10.2.5.1 Spezielle Anwendungsbeispiele 470
10.2.6 Der Weg zu den thermoplastisch verarbeitbaren Fluor-Kunststoffen 471
10.2.6.1 Perfluorethylenpropylen FEP, auch Tetrafluorethylen- Hexafluorpropylen-Copolymer 472
10.2.6.2 Perfluoroalkoxy-Copolymer (PFA) 472
10.2.6.3 Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymer (ETFE) 472
10.2.6.4 Polyvinylidenfluorid (PVDF) 473
10.2.6.5 Tetrafluorethylen-Hexafluorpropylen-Vinylidenfluorid- Terpolymer TFEHFPVDF (THV) 473
10.2.6.6 Polyvinylfluorid (PVF) 473
10.2.6.7 Polychlortrifluorethylen (PCTFE) 474
10.2.6.8 Ethylen-Chlortrifluorethylen-Copolymer (ECTFE) 474
10.3 Geschichtliches zu den Fluorpolymeren 474
10.4 Tabellarischer Eigenschaftsvergleich 475
11 Duroplaste 479
11.1 Allgemeines über Herstellung und Eigenschaften 479
11.2 Phenoplaste (Phenol-Formaldehyd- Kondensationsharze) (PF) 481
11.2.1 Das Wichtigste in Kürze 481
11.2.2 Handelsnamen (Beispiele®) 482
11.2.3 Eigenschaften von PF-Formstoffen 482
11.2.4 Verarbeitung (Beispiele) 484
11.2.5 Anwendungsbeispiele 484
11.2.5.1 Harzformstoffe, Harzformteile 484
11.2.5.2 Schichtpressstoffe 484
11.2.5.3 PF-Harze 484
11.2.6 Der Weg zu den Phenolharzen 485
11.2.7 Geschichtliches 489
11.3 Aminoplaste 489
11.3.1 Harnstoffharze (Harnstoff-Formaldehyd- Kondensationsharze) (UF) 489
11.3.1.1 Das Wichtigste in Kürze 489
11.3.1.2 Handelsnamen (Beispiele®) 489
11.3.1.3 Eigenschaften 490
11.3.1.4 Verarbeitung, Anwendung (Beispiele) 490
11.3.1.5 Der Weg zum Harnstoffharz 490
11.3.2 Melaminharze (Melamin-Formaldehyd- Kondensationsharze) (MF) 492
11.3.2.1 Das Wichtigste in Kürze 492
11.3.2.2 Handelsnamen (Beispiele®) 492
11.3.2.3 Eigenschaften 492
11.3.2.4 Verarbeitung, Anwendung (Beispiele) 493
11.3.2.5 Eigenschaften und Anwendung von modifizierten Melaminharzen (Beispiele) 493
11.3.2.6 Der Weg zum Melaminharz 494
11.3.3 Geschichtliches 495
11.4 Reaktionsharz-Duroplaste 496
11.4.1 Ungesättigte Polyesterharze (UP) 496
11.4.1.1 Das Wichtigste in Kürze 496
11.4.1.2 Handelsnamen (Beispiele®) 496
11.4.1.3 Eigenschaften 496
11.4.1.4 Verarbeitung (Beispiele) 498
11.4.1.5 Anwendungsbeispiele 499
11.4.1.6 Der Weg zu den ungesättigten Polyesterharzen 499
11.4.1.7 Geschichtliches 503
11.4.2 Vinylesterharze (VE) 503
11.4.2.1 Eigenschaften 503
11.4.2.2 Verarbeitung, Anwendung (Beispiele) 503
11.4.2.3 Der Weg zu den Vinylesterharzen 504
11.4.2.4 Geschichtliches 505
11.4.3 Epoxidharze (EP) 505
11.4.3.1 Das Wichtigste in Kürze 505
11.4.3.2 Handelsnamen (Beispiele®) 505
11.4.3.3 Eigenschaften 505
11.4.3.4 Verarbeitung (Beispiele) 506
11.4.3.5 Anwendungsbeispiele 506
11.4.3.6 Der Weg zu den Epoxidharzen 507
11.4.3.7 Geschichtliches 512
11.5 Sonstige Harze 513
11.5.1 Siliconharze 513
11.5.2 Polydiallylphthalatharze (PDAP, PDAIP) 514
11.5.2.1 Das Wichtigste in Kürze 514
11.5.2.2 Handelsnamen (Beispiele®) 514
11.5.3 PUR-Gießharze 514
11.5.3.1 Elastomer-Gießharze 514
11.5.3.2 Harte PUR-Harze 515
11.5.4 Cyanatester-Harze 515
11.6 Tabellarischer Eigenschaftsvergleich 516
12 Hochleistungspolymere 519
12.1 Polyaryletherketone (PAEK) 520
12.1.1 Das Wichtigste in Kürze 520
12.1.2 Handelsnamen (Beispiele®) 520
12.1.3 Eigenschaften 520
12.1.4 Verarbeitung (Beispiele) 521
12.1.5 Anwendungsbeispiele 522
12.1.6 Der Weg zu den Polyaryletherketonen 522
12.1.7 Geschichtliches 522
12.2 Polyarylate (PAR) 523
12.2.1 Das Wichtigste in Kürze 523
12.2.2 Handelsnamen (Beispiele®) 523
12.2.3 Eigenschaften 523
12.2.4 Verarbeitung (Beispiele) 524
12.2.5 Anwendungsbeispiele 524
12.2.6 Der Weg zu den Polyarylaten 525
12.2.7 Geschichtliches 525
12.3 Flüssigkristalline Polymere (LCP) 526
12.3.1 Das Wichtigste in Kürze 526
12.3.2 Handelsnamen (Beispiele®) 526
12.3.3 Eigenschaften 526
12.3.3.1 Aufbau und Struktur der LCP 526
12.3.3.2 Eigenschaften von thermotropen LCP 527
12.3.4 Verarbeitung (Beispiele) 529
12.3.5 Anwendungsbeispiele 529
12.3.6 Der Weg zu den flüssigkristallinen Polymeren 529
12.3.6.1 Herstellung der lyotropen LCP 529
12.3.6.2 Herstellung der thermotropen LCP 531
12.3.7 Geschichtliches 532
12.4 Polyimide (PI) 532
12.4.1 Das Wichtigste in Kürze 532
12.4.2 Handelsnamen (Beispiele®) 532
12.4.3 Eigenschaften 532
12.4.4 Verarbeitung (Beispiele) 534
12.4.5 Anwendungsbeispiele 534
12.4.6 Der Weg zu den Polyimiden 535
12.4.7 Geschichtliches 540
12.5 Polyarylsulfone (PSU, PES, PPSU) 541
12.5.1 Das Wichtigste in Kürze 541
12.5.2 Handelsnamen (Beispiele®) 541
12.5.3 Eigenschaften 541
12.5.4 Verarbeitung (Beispiele) 542
12.5.5 Anwendungsbeispiele 542
12.5.6 Der Weg zu den Polyarylsulfonen 542
12.5.7 Geschichtliches 544
12.6 Polyphenylensulfid (PPS) 544
12.6.1 Das Wichtigste in Kürze 544
12.6.2 Handelsnamen (Beispiele®) 544
12.6.3 Eigenschaften 544
12.6.4 Verarbeitung (Beispiele) 545
12.6.5 Anwendungsbeispiele 545
12.6.6 Der Weg zu Polyphenylensulfid 546
12.6.7 Geschichtliches 546
12.7 Tabellarischer Eigenschaftsvergleich 546
13 Elastomere 551
13.1 Permanent vernetzte Elastomere/Gummi 552
13.1.1 Das Wichtigste in Kürze über vernetzte Elastomere 552
13.1.2 Handelsnamen (Beispiele®) 554
13.1.3 Eigenschaften 554
13.1.4 Verarbeitung (Beispiele) 556
13.1.5 Anwendungsbeispiele 556
13.1.6 Der Weg zu den permanent vernetzten Elastomeren 557
13.1.7 Geschichtliches 559
13.2 Reversibel vernetzte Elastomere/ Thermoplastische Elastomere TPE 559
13.2.1 Das Wichtigste in Kürze über TPE 559
13.2.2 Handelsnamen (Beispiele®) 562
13.2.3 Allgemeine Eigenschaften 562
13.2.4 Einzeleigenschaften und Anwendungsbeispiele 565
13.2.4.1 Thermoplastische Elastomere auf Olefinbasis, TPE-O/TPE-V (TPO/TPV) 565
13.2.4.2 Thermoplastische Elastomere auf Styrolbasis, TPE-S (TPS) 565
13.2.4.3 Thermoplastische Polyester-Elastomere, TPE-E (TPC) 566
13.2.4.4 Thermoplastische Polyamid-Elastomere, TPE-A (TPA) 566
13.2.4.5 Thermoplastische Polyurethan-Elastomere, TPE-U (TPU) 567
13.2.5 Der Weg zu den thermoplastischen Elastomeren 568
13.2.5.1 TPE-O/TPE-V (TPO/TPV) 568
13.2.5.2 TPE-S (TPS) 569
13.2.5.3 TPE-E (TPC) 569
13.2.5.4 TPE-A (TPA) 569
13.2.5.5 TPE-U (TPU) 570
13.2.6 Geschichtliches 570
14 Schaumstoffe 571
14.1 Allgemeines über Herstellung und Eigenschaften 571
14.1.1 Handelsnamen (Beispiele®) 574
14.2 Polystyrol-Schaumstoffe (PS-E) 574
14.2.1 Das Wichtigste in Kürze 574
14.2.2 Polystyrol-Hartschaumstoff, Partikel-Schaumstoff 574
14.2.2.1 Eigenschaften 574
14.2.2.2 Verarbeitung 575
14.2.2.3 Anwendungsbeispiele 575
14.2.3 Polystyrol-Hartschaumstoff, Extruder-Schaumstoff 575
14.2.3.1 Eigenschaften 575
14.2.3.2 Verarbeitung 575
14.2.3.3 Anwendungsbeispiele 575
14.2.4 Polystyrol-Integralschaumstoff 575
14.2.4.1 Eigenschaften 575
14.2.4.2 Verarbeitung (Beispiele) 576
14.2.4.3 Anwendungsbeispiele 576
14.3 Polyolefin-Schaumstoffe, PO-Schaumstoffe 576
14.3.1 Das Wichtigste in Kürze 576
14.3.2 Eigenschaften 576
14.3.3 Verarbeitung (Beispiele) 577
14.3.4 Anwendungsbeispiele 577
14.4 Polyurethan-Schaumstoffe, PUR-Schaumstoffe 577
14.4.1 Das Wichtigste in Kürze 577
14.4.2 PUR-Hartschaumstoffe, (PUR-H) 578
14.4.2.1 Eigenschaften 578
14.4.2.2 Anwendungsbeispiele 578
14.4.3 PUR-Weichschaumstoffe, (PUR-W) 578
14.4.3.1 Eigenschaften 578
14.4.3.2 Anwendungsbeispiele 579
14.4.4 PUR-Halbhart-(semiflexible) Schaumstoffe 579
14.4.4.1 Eigenschaften 579
14.4.4.2 Anwendungsbeispiele 579
14.4.5 PUR-Integral-Hartschaumstoffe, (PUR-I) 579
14.4.5.1 Eigenschaften 579
14.4.5.2 Anwendungsbeispiele 579
14.4.6 PUR-Integral-Halbhart- und Weichschaumstoffe 580
14.4.6.1 Eigenschaften 580
14.4.6.2 Anwendungsbeispiele 580
14.4.7 Der Weg zu den Polyurethan-Schaumstoffen 580
14.4.7.1 Polyurethan-Schäumsysteme 580
14.4.7.2 Chemie der PUR-Schäumsysteme 583
14.4.8 Isocyanatfreie Polyurethane (NIPU) NIPU, Non-Isocyanat-Polyurethan 586
14.4.8.1 Biobasierte NIPU-Schäume 587
14.4.9 Geschichtliches 587
14.5 Weitere Schaumstoffe 588
14.5.1 Polyvinylchlorid-Schaumstoffe 588
14.5.2 Phenol-Formaldehyd-Schaumstoffe 588
14.5.3 Harnstoff-Formaldehyd-Schaumstoffe 588
14.5.4 Polymethacrylimid-Schaumstoffe 588
14.5.5 Gummi-Schaumstoffe 589
14.6 Tabellarischer Eigenschaftsvergleich 590
15 Kunststoffe als Sonderwerkstoffe 591
15.1 Elektroaktive Kunststoffe 591
15.1.1 Oberflächenbehandlungen 592
15.1.2 Elektrisch leitfähige Compounds 592
15.1.3 Intrinsisch elektrisch leitfähige Polymere 593
15.1.4 Polymere als Elektrete 595
15.1.5 Ferroelektrische Polymere (Piezo- und Pyroelektrizität) 596
15.1.6 Triboelektrizität (Reibungselektrizität) 597
15.2 Funktionskunststoffe 598
15.2.1 Polymere als Datenspeicher 598
15.2.2 Polymere Leuchtdioden, Polymer-LEDs (PLEDs) 599
15.2.3 Polymere Photovoltaik (PPV) 600
15.2.4 Photoresists 602
15.2.5 Brennstoffzellen 603
15.2.6 Hybride Polymersysteme 604
15.3 Nanotechnologie und Kunststoffe 605
15.3.1 Anwendung von Nanoröhren (CNT) als Zusatzstoffe für Kunststoffe 606
15.3.2 Graphen 606
15.3.3 Nanotechnologie als Schrittmacher in die Zukunft 607
15.4 Kunststoffe in der Medizintechnik 608
15.4.1 Exemplarische Beispiele aus der Chirurgie 608
15.4.1.1 Polylactide 608
15.4.2 Scaffolds für Tissue Engineering 608
15.5 Biopolymere 609
15.5.1 Das Wichtigste in Kürze 609
15.5.2 Biokunststoffe -- Kunststoffe aus nachwachsenden (biogenen) Rohstoffen (NAWARO) 610
15.5.2.1 Handelsnamen (Beispiele®) 610
15.5.2.2 Cellullosewerkstoffe 610
15.5.2.3 Stärkewerkstoffe 611
15.5.2.4 Werkstoffe aus dem Bioreaktor 613
15.5.2.5 Werkstoffe durch chemische Synthese biobasierter Rohstoffe 614
15.5.2.6 Biocomposites als Werkstoffe 616
15.5.2.7 Blends als Werkstoffe 617
15.5.3 Biologisch abbaubare Kunststoffe (BAK) 617
15.5.3.1 Biokunststoffe neu definiert 619
15.5.4 Anwendungsbeispiele und Ausblick 619
15.6 Gele 620
15.6.1 Aufbau der festen Struktur 620
15.6.1.1 Nebenvalenzbindungen/Nebenvalenzgele 620
15.6.1.2 Hauptvalenzbindungen/Hauptvalenzgele 621
15.6.2 Anwendungsbeispiele 621
15.6.2.1 Hydrogele als Funktionspolymere 621
15.7 Tabellarischer Eigenschaftsvergleich 622
16 Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte von Kunststoffen 623
16.1 Gesundheits- und Sicherheitsaspekte von Kunststoffen 623
16.1.1 Gewerbetoxikologische Begriffe (Auswahl) 623
16.1.2 Herstellung von Polymeren und Kunststoff- Formmassen 623
16.1.3 Verarbeitung und Prüfung von Kunststoffen 624
16.1.4 Anwendung von Kunststoffen 625
16.2 Umweltaspekte von Kunststoffen 626
16.2.1 Nachhaltige Entwicklung 626
16.2.2 Lebensdauer von Erzeugnissen aus Kunststoff 626
16.2.3 Abfall- und Recyclinghierarchie 626
16.3 Abfallwirtschaft und Recycling aus Sicht der Kunststoffindustrie 627
16.3.1 Abfallwirtschaft 627
16.3.1.1 Kunststoffabfälle 2018 629
16.3.2 Grundsätzliche Aspekte beim Recycling von Kunststoffen 629
16.3.3 Recyclingkreisläufe von Kunststoffen 630
16.3.3.1 Werkstoffliches Recycling 630
16.3.3.2 Rohstoffliches chemisches Recycling 633
16.3.3.3 Kontrollierte energetische Nutzung 635
16.3.4 Deponie 638
16.3.5 Littering alias Vermüllung 638
16.3.6 Codierung erleichtert Recycling 639
16.4 Abbaufähige, resorbierbare Kunststoffe 640
16.4.1 Biologisch abbaubare Kunststoffe (BAK) 641
16.4.2 Photoabbaubare Polymere 642
16.4.3 Wasserlösliche Polymere 642
16.5 Cradle to Cradle, C2C (»Von der Wiege zur Wiege«) 642
Literaturverzeichnis 645
Sachwortverzeichnis 651
Einführung Grundlagen Technologie der Verarbeitung von Kunststoffen Polyolefine Halogenierte Kunststoffe I Polystyrol-Kunststoffe Ester-Thermoplaste Stickstoff-Thermoplaste Acetal- und Ether-Thermoplaste Halogenierte Kunststoffe II Duroplaste Hochleistungspolymere Elastomere Schaumstoffe Kunststoffe als Sonderwerkstoffe Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte von Kunststoffen
| Erscheinungsdatum | 15.01.2021 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 176 x 245 mm |
| Gewicht | 1281 g |
| Einbandart | gebunden |
| Themenwelt | Technik ► Maschinenbau |
| Schlagworte | Basiswissen Kunststoffe • Chemie • Kunststoffchemie • Kunststoffchemie Grundlagen • Kunststoffe • Kunststoffeigenschaften • Kunststoffklassen • Polymerchemie |
| ISBN-10 | 3-446-45191-9 / 3446451919 |
| ISBN-13 | 978-3-446-45191-9 / 9783446451919 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich