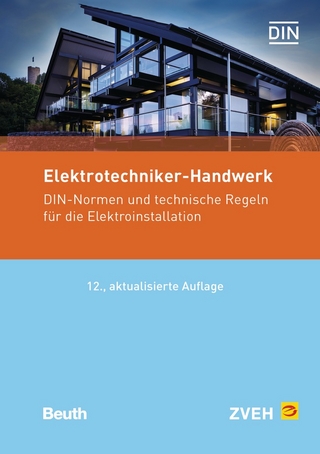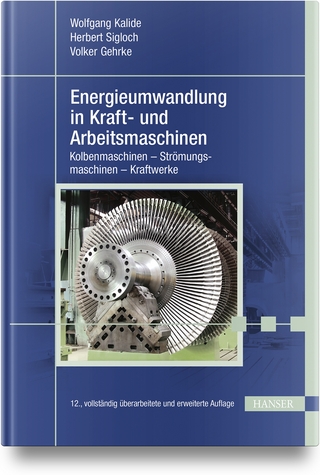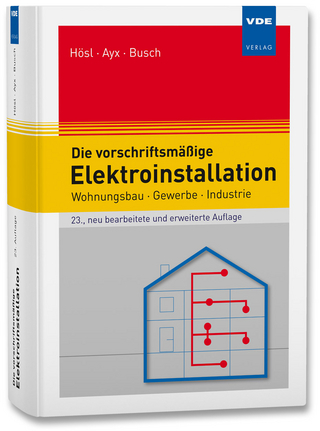Auf die Röhre geschaut
- Keine Verlagsinformationen verfügbar
- Artikel merken
Vorwort
1. Was ist eine Röhre? 12
1.1. Etwas Technik 13
1.2. Durchgriff, Steilheit, Innenwiderstand 15
1.3. Vielfach nutzbares Prinzip 18
2. Röntgenröhren als Erste 19
2.1. Der Anfang 19
2.2. Hohe Zeit der Ionenröhren 27
2.2.1. Regenerierung des Gasdrucks 27
2.2.2. Antikathode und Kühlung 31
2.2.3. Strahlenaustritt, Härtemessung, Schutzmaßnahmen 35
2.2.4. Nichtmedizinische Anwendungen, Metallröhren 38
2.3. Elektronenröntgenröhren bis heute 40
2.3.1. Erst Lilienfeld, dann Coolidge 40
2.3.2. Fokussierung 43
2.3.3. Strahlenschutzröhren 44
2.3.4. Belastbarkeit des Brennflecks, Drehanodenröhren 46
2.3.5. Spannungsversorgung 50
2.3.6. Besondere Röhren 51
3. Braunsche Röhren 53
3.1. Oszillografenröhren 53
3.1.1. Ionenröhren 53
3.1.2. Elektronenröhren 56
3.1.2.1. Fokussierung 57
3.1.2.2. Ablenkung 59
3.1.2.3. Kolbenform 63
3.1.2.4. Besondere Röhren 66
3.2. Bildröhren 68
3.2.1. Der Anfang 68
3.2.2. Elektronisches Fernsehen 71
3.3. Anfang der Plasmabildschirme 81
4. Gleichrichterröhren 84
4.1. Glimmgleichrichter 55
4.2. Quecksilberdampfgleichrichter 89
4.2.1. Zündung 92
4.2.2. Rückzündung 92
4.2.3. Kolbenform 93
4.2.4. Kühlung 94
4.2.5. Saugdrossel 94
4.2.6. Argonal-Gleichrichter 95
4.2.7. Steuerbare Gleichrichter 96
4.2.8. Eisengefäße 98
4.3. Gleichrichter mit Glühkathode 101
4.3.1. Gasgefüllte Gleichrichter 101
4.3.1.1. Höhere Spannungen 106
4.3.1.2. Steuerbare Gleichrichter 107
4.3.2. Hochvakuumgleichrichter 110
4.3.2.1. Detektor für die Funktechnik 111
4.3.2.2. Hochspannungsgleichrichter 113
4.3.2.3. Anodenspannungsversorgung der Radioröhren 116
4.3.2.4. Und wieder Detektor 120
4.3.2.5. Spezialitäten 121
5. Röhren mit Fotokathoden 122
5.1. Fotoempfänger 122
5.1.1. Fotowiderstände 122
5.1.2. Fotozellen 124
5.2. Fotozellen mit Sekundärelektronenvervielfacher 130
5.2.1. Fotozelle mit Verstärkerröhre 130
5.2.2. Sekundärelektronenvervielfacher 132
5.3. Bildwandler und Bildverstärker 137
5.4. Röntgenbildverstärker 140
5.5. Kameraröhren 141
5.5.1. Der Anfang: Ikonoskop und Dissectorröhre 141
5.5.2. Orthikon 145
5.5.3. Vidikon 146
6. Endlich: Radioröhren 149
6.1. Vorläufer 149
6.2. Der Anfang 152
6.2.1. Lieben-Röhre 152
6.2.2. Audion 154
6.2.3. Gasgefüllte Röhren 155
6.2.4. Hochvakuumröhren 157
6.2.4.1. Kapazitätsarme Konstruktionen 160
6.2.4.2. Raumlade- und Schirmgitter 160
6.2.4.3. Mehrfachröhren 162
6.2.4.4. Metallkolben 162
6.2.4.5. Zusammengefasst 162
6.3. Die frühe Radiozeit bis 1930 163
6.3.1. Der Anfang 163
6.3.2. Thorierte Heizfäden 165
6.3.3. Spezialisierte Röhren 166
6.3.4. Schirmgitterröhren 168
6.3.5. Raumladegitterröhren 169
6.3.6. Mehrfachröhren 170
6.3.7. Heizfadenbruch und Reparatur 71
6.3.8. Das Jahr 1927 172
6.3.8.1. Barium-Aufdampfkathoden 172
6.3.8.2. Indirekt geheizte Kathoden 173
6.3.8.3. Die Pentode 175
6.3.9. Die Patentsituation 176
6.4. Röhren für Superhet-Empfänger 177
6.4.1. Regelröhren 178
6.4.2. Magische Augen 179
6.4.3. Mischröhren 180
6.4.4. Lautsprecherröhren 181
6.4.5. Typenbezeichnungen und weitere Entwicklung 183
6.5. Schlusspunkt 1960 186
7. Senderöhren & Co. 190
7.1. Grundsätzliches 193
7.2. Hohe Leistung 196
7.2.1. Parallelschaltung 196
7.2.2. Höhere Kolbentemperatur 196
7.2.3. Wasser- oder Luftkühlung 198
7.2.4. Doppelröhren für Gegentaktschaltungen 203
7.2.5. Modulator- und Taströhren 203
7.3. Hohe Frequenz 205
7.3.1. Dichtegesteuerte Röhren 205
7.3.2. Laufzeitgesteuerte Röhren 208
7.3.2.1. Bremsfeld-Röhre 209
7.3.2.2. Magnetrons 211
7.3.2.3. Heilscher Generator, Klystron, Wanderfeldröhre 217
8. Sehr spezielle Röhren 224
8.1. Röhren für besondere Verwendung 224
8.1.1. Telefonverstärkerröhren 224
8.1.2. Elektrometerröhren 226
8.1.3. Vakuum-Messröhren 227
8.1.4. Professionelle Röhren 229
8.1.5. Dioden im Sättigungsgebiet 232
8.2. Stabilisatorröhren 233
8.3. Zählrohre 235
8.4. Dekadische Anzeigeröhren 236
8.4.1. Ziffernanzeigeröhren 236
8.4.2. Zählröhren 239
8.4.2.1. Dekatrons 239
8.4.2.2. Zählröhre E1T 241
8.4.2.3. Trochotrons 243
8.5. Sperrröhren 244
8.6. Eisenwiderstände 245
8.7. Den Röhren ähnlich 248
9. Quellenhinweise 251
10. Sachwortverzeichnis 267
Vorwort Homo sapiens (der wissende Mensch), homo ludens (der spielende Mensch) oder homo faber (der Mensch als Schmied): Diese Bezeichnungen für den Menschen – für uns – kennen wir. Unsere Geschichte betrachten wir überwiegend als Aufreihung der Mächtigen, derer Kriege und zahlloser Katastrophen. Wenn wir uns ausnahmsweise mit der Kultur befassen, so verstehen wir darunter meist Philosophie und bildende oder sonstige Künste. Das Wort „Künstler“ hat dabei eine selt¬same Bedeutungswandlung durchgemacht: Vom Wortsinn her ist ein Künstler einer, der etwas kann. So gab es denn die „schönen“ und die „nützlichen“ Künste, doch eigenartigerweise wurden die „nützlichen“ Künste immer weniger geachtet, während die „schönen“ hohe Beachtung finden. „Banausie“ ist ein griechisches Wort und bezeichnet nach Meyers Lexikon das handwerksmäßige Betreiben einer Kunst oder Wissenschaft. Diejenigen, die das können, werden von der Gesellschaft als „Banausen“ verachtet. Die schönen Künste können heute leider oft mit „exorbitant teuer, zu vielen Worten Anlass gebend und absolut sinnfrei“ beschrieben werden. Trotzdem überwiegen sie im öffentlichen Interesse, und die eigentliche Kunst besteht meist darin, unter Einsatz aller, wirklich aller Mittel Aufmerksamkeit zu erregen. So führt denn die Technik (also die nützliche Kunst) ein kulturelles Schattendasein. Ausnahmen gibt es beispielsweise, wenn man über sehr alte Technik redet, etwa die der alten Griechen (die die Technik selbst nicht geachtet haben), oder wenn es sich um militärisch, d. h. machtpolitisch wichtige Erfindungen handelt. Die heutigen Träger der Technik heißen Naturwissenschaftler (und werden immerhin manchmal durch einen Nobelpreis geadelt), Ingenieure (bedeutet „geistvoll“ oder „Genie“), Techniker oder Handwerker. Die großartige Leistung des Erfindens und Entwickelns hochwertiger Produkte und Verfahren ebenso wie die nicht minder wichtige des sorgfältigen Herstellens findet jedoch keine Anerkennung als kulturelle Leistung, sondern gilt als lästiger Kostenfaktor. So kommt es, dass die Frage „Wie macht man das?“ keinen nennenswerten Teil unserer Kulturdiskussion darstellt. In ihrer geschichtlichen Form – „Wie hat man das früher gemacht?“ spielt sie ebenfalls keine große Rolle. Wenn überhaupt, wird die Technikgeschichte oft vom soziologischen Standpunkt aus betrachtet. Dies ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, aber eben nur einer. Die Frage, warum man etwas zu einem Zeitpunkt so gemacht hat wie vorgefunden, ist meist technischer Natur, nämlich eine Frage der Funktion, des verfügbaren Materials und der vorhandenen Werkzeuge, des genauen Verwendungszwecks, des Standes der naturwissenschaftlichen und technischen Erkenntnis und der handwerklichen Fähigkeiten. Ich möchte für die Beschäftigung mit der Technikgeschichte werben. Erstens ist sie interessant. Zweitens ist sie eine reich sprudelnde Quelle, aus der Ideen, Vorstellungen und Fallbeispiele geschöpft werden können. Damit eröffnet sie auch Zukunftsvisionen. Drittens ist es so, dass die Kenntnis der alten Technik das Verstehen der modernen erleichtert. Manch frühere Entwicklung bringt uns aus heutiger Sicht zum Schmunzeln, manche auch zum Nachdenken darüber, was denn nun Erfolg oder Misserfolg ausgemacht hat. In diesem Buch wird versucht, die Entwicklung der technisch verwendeten Röhren, besonders der „Radio“-Röhren, also der Verstärkerröhren, aber auch der Röntgen-, Gleichrichter-, Schalt-, Sende- und sonstigen Röhren zu beschreiben. Sie alle waren von etwa 1900 an Schlüsselbauelemente der Funk-, Energie-, Steuerungs- und vieler anderer Techniken. Mit ihnen wurden die technischen Systeme, die wir heute wie selbstverständlich benutzen, erstmalig gebrauchsfähig gemacht. Dazu gehören Radio und Fernsehen, Telefonsysteme, Computer, Automatisierung, Röntgentechnik und manches mehr. Allerdings wurde die gute alte Röhre in den meisten Anwendungsfeldern in den Jahren zwischen etwa 1960 bis 1975 von Halbleitern abgelöst; der letzte große Wechsel von der Bildröhre zum Flachbildschirm (Flüssigkristall und Plasma) ist noch in guter Erinnerung. Die Entwicklung der Röhre war international, und ich habe versucht, sie auch so darzustellen. Weil mir deutsche Quellen besser zugänglich waren als andere, dominieren deutsche Röhren möglicherweise. Die Gesamtzahl der weltweit produzierten Röhren geht weit in die Milliarden, und die Zahl der nach Bezeichnung verschiedenen Röhrentypen liegt bei schätzungsweise 40 000. Daher habe ich nicht versucht, auch nur ansatzweise eine Vollständigkeit zu erreichen. Ich hoffe aber, die wichtigsten Röhrenarten in ihren wesentlichen Entwicklungsschritten in knapper Form vorgestellt und damit einen Beitrag zu einem faszinierenden Kapitel der jüngeren Technikgeschichte geleistet zu haben. Sollte ich wichtige Dinge nicht erwähnt oder unrichtig dargestellt haben, so bitte ich um Hinweise und Kritik. In meinem „aktiven“ Berufsleben war ich mit Halbleitern befasst. Die Verbindung zu Röhren kam daher, dass auf dem Gelände meines ersten Arbeitgebers in Hamburg bis 1974 noch Empfängerröhren und danach bis über mein Ausscheiden hinaus Senderöhren, insbesondere Klystrons verschiedener Art, gefertigt wurden. Insoweit stellt diese ganze Arbeit ein Plagiat dar, denn mein Wissen über Röhren stammt nur wenig aus eigener Erfahrung, etwas mehr aus meiner Röhrensammlung, überwiegend aber aus der Arbeit mit sehr vielen fremden Quellen. Sollte sich jemand dadurch in seinen Rechten verletzt fühlen, so bitte ich um Mitteilung. Ich gehe aber davon aus, dass das bei einem technikgeschichtlichen Buch wissenschaftlichen Charakters nicht der Fall sein dürfte. Die Verwendung von Namen und Bildern bedeutet nicht, dass diese frei von Schutzrechten anderer sind. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen so umfangreichen Stoff zu gliedern. Die Hauptabschnitte sind nach den Röhrenarten, also Röntgenröhren, Gleichrichterröhren, Verstärkerröhren usw., eingeteilt und innerhalb dieser Abschnitte nach der zeitlichen Entwicklung. Insbesondere die technologischen Schritte vollzogen sich oft für verschiedene Röhrenarten etwa zu gleicher Zeit. Daher lassen sich Querverweise zwischen den Hauptabschnitten nicht immer vermeiden. Ein Buch wie dieses kann nicht ohne Hilfe entstehen. Viele Menschen haben über lange Zeit dazu beigetragen, durch Gespräche, Literaturhinweise, Beiträge zu meiner Sammlung, Bilder oder auf andere Weise, auch dadurch, dass sie mein Tun meist geduldig ertragen haben. All diesen sei hier gedankt. Ohne die Patentdatenbank Espacenet des Europäischen Patentamtes wären die nötigen Patenrecherchen nicht möglich gewesen. Besonders danken möchte ich der Gesellschaft der Freunde der Geschichte des Funkwesens, namentlich Herrn Dr. Rüdiger Waltz, für die Unterstützung und Förderung, Herrn Wolfgang E. Schlegel für die angenehme Zusammenarbeit und die Korrektur sowie dem Funk Verlag Bernhard Hein für die Herausgabe dieses Buches. Lüneburg, im Dezember 2013 Joachim Goerth
| Erscheint lt. Verlag | 31.10.2014 |
|---|---|
| Zusatzinfo | zahlreiche Abbildungen, historische Fotos, Zeichnungen und Schaltungen |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 2100 x 2980 mm |
| Gewicht | 800 g |
| Einbandart | Paperback |
| Themenwelt | Technik ► Elektrotechnik / Energietechnik |
| Schlagworte | Empfängerröhren • Röhren • Röhren, Empfängerröhren, technische Röhren |
| ISBN-10 | 3-939197-82-3 / 3939197823 |
| ISBN-13 | 978-3-939197-82-9 / 9783939197829 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich