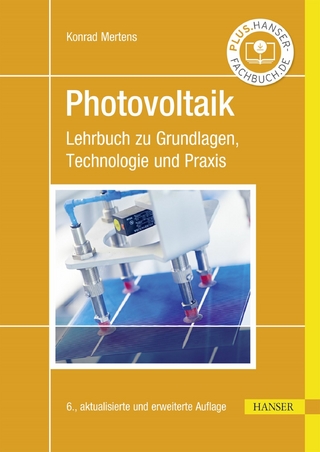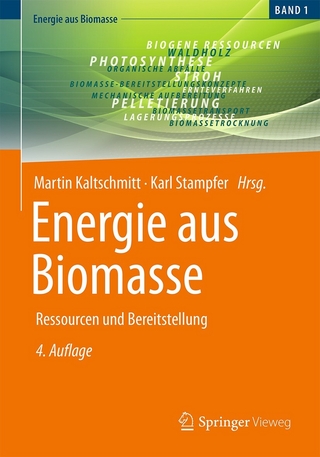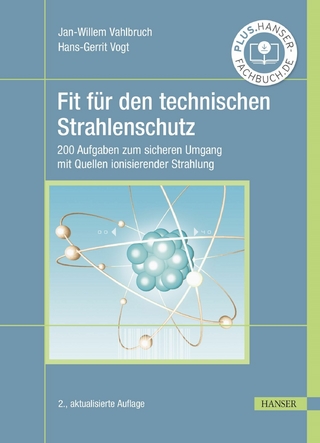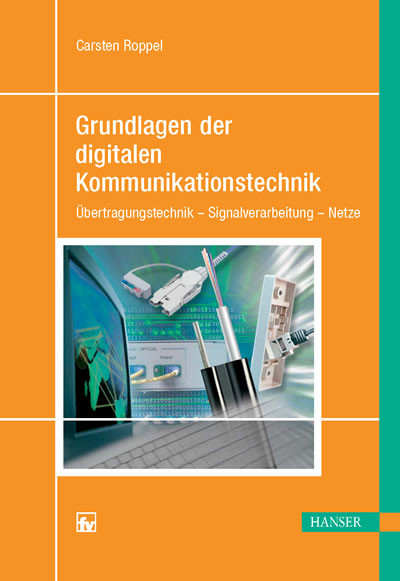
Grundlagen der digitalen Kommunikationstechnik (eBook)
433 Seiten
Carl Hanser Fachbuchverlag
978-3-446-40879-1 (ISBN)
Die Entwicklung, die Planung und der Betrieb von Systemen der Kommunikationstechnik sind ohne den Einsatz von leistungsfähigen Messgeräten, Entwicklungs- und Simulationswerkzeugen nicht denkbar. Die Arbeit mit diesen Werkzeugen setzt ein grundlegendes Verständnis der Funktionsweise des Kommunikationssystems voraus. Dieses Lehrbuch vermittelt das hierzu erforderliche Wissen. Behandelt werden unter anderem die folgenden Themen: Übertragungstechnik: Übertragung von Signalen über lineare, zeitinvariante Systeme, Beschreibung von Zufallssignalen, Leitungscodierung, Intersymbol-Interferenz und Nyquist-Impulsformung, signalangepasstes Filter, Fehlerwahrscheinlichkeit, digitale Modulationsverfahren, OFDM, Empfängerarchitekturen, Kanalcodierung. Signalverarbeitung: Abtastung und Quantisierung, Sprachcodierung, digitale Filter, adaptive Filter.
Netze: Paket- und Leitungsvermittlung, Dimensionierung, Dienstgüte (Quality of Service) und Verkehrsmanagement, Mehrfachzugriffsverfahren, Transport- und Anschlussnetze (xDSL, Kabelmodem), ISDN, ATM, Internet, Voice over IP.
Die grundlegenden Zusammenhänge werden Schritt für Schritt erläutert und detailliert beschrieben. Zahlreiche Beispiele stellen den Bezug zur Praxis her und gehen auf aktuelle Entwicklungen und Anwendungen ein. Im Internet verfügbare Übungsaufgaben mit Lösungen unterstützen das Selbststudium.
Der Autor
Dr. Carsten Roppel ist Professor für Nachrichtentechnik und Signalverarbeitung an der Fachhochschule Schmalkalden in Thüringen.
Vorwort 6
Inhaltsverzeichnis 8
1 Einführung 12
1.1 Digitale Übertragungssysteme 13
1.2 Digitale Signalverarbeitung 16
1.3 Digitale Netze 17
2 Signalübertragung 20
2.1 Lineare zeitinvariante Systeme 20
2.1.1 Impulsantwort und Faltung 21
2.1.2 Fourier-Transformation 26
2.1.3 Übertragungsfunktion 31
2.1.4 Verzerrungsfreies System 34
2.1.5 Der ideale Tiefpass 35
2.1.6 Der ideale Bandpass 36
2.2 Energie- und Leistungssignale 37
2.2.1 Korrelation von Energie- und Leistungssignalen 38
2.2.2 Energie- und Leistungsdichtespektrum 40
2.3 Zufallssignale 42
2.3.1 Zufallsprozesse 42
2.3.2 Verteilungsfunktion und Wahrscheinlichkeitsdichte 45
2.3.3 Wichtige Verteilungsfunktionen 47
2.3.4 Leistungsdichtespektrum von Zufallssignalen 53
2.3.5 Übertragung von Zufallssignalen über LTI-Systeme 57
2.3.6 Weißes Rauschen, Rauschbandbreite und additives Rauschen 58
3 Signalabtastung und Quantisierung 66
3.1 Abtasttheorem 66
3.2 Abtastung von Bandpasssignalen 71
3.3 Lineare Quantisierung 73
3.4 Nichtlineare Quantisierung und PCM 77
3.5 Differenzielle PCM und Sprachcodierung 80
4 Digitale Nachrichtenübertragung im Basisband 85
4.1 Elemente eines digitalen BasisbandÜbertragungssystems 85
4.2 Leitungscodierung 87
4.3 Intersymbol-Interferenz und Nyquist-Pulsformung 90
4.3.1 Nyquist-Bandbreite 90
4.3.2 Das erste Nyquist-Kriterium 92
4.3.3 Kosinus-roll-off-Filter 94
4.3.4 Das Augendiagramm 96
4.3.5 Leistungsdichtespektrum digitaler Basisbandsignale 97
4.3.6 Duobinäre Codierung 101
4.4 Fehlerwahrscheinlichkeit 104
4.4.1 Fehlerwahrscheinlichkeit bei binärer Übertragung 105
4.4.2 Signalangepasstes Filter 109
4.4.3 Fehlerwahrscheinlichkeit bei Mehrpegelübertragung 114
4.5 Kanalverzerrungen 118
4.6 Nebensprechen 119
4.7 Scrambling 121
4.8 Synchronisation 125
4.8.1 Symboltaktsynchronisation 126
4.8.2 Rahmensynchronisation 131
5 Digitale Modulationsverfahren 134
5.1 Bandpasssignale 135
5.1.1 Bandpasssignal und äquivalentes Tiefpasssignal 135
5.1.2 Äquivalentes Tiefpasssystem 139
5.1.3 Hilbert-Transformation 144
5.1.4 Leistungsdichtespektrum von Bandpasssignalen 145
5.2 Grundlegende Modulationsverfahren 147
5.2.1 Amplitudenumtastung 147
5.2.2 Phasenumtastung 149
5.2.3 Quadratur-Amplitudenmodulation 156
5.2.4 Frequenzumtastung 158
5.3 Demodulation und Fehlerwahrscheinlichkeit 169
5.3.1 Kohärente Demodulation 169
5.3.2 Inkohärente Demodulation 180
5.4 Multiträgersysteme 186
5.5 Empfängerarchitekturen 194
6 Kanalcodierung 197
6.1 Blockcodes 198
6.1.1 Eigenschaften von Blockcodes 198
6.1.2 Hamming-Codes 202
6.1.3 Codiergewinn 206
6.1.4 Zyklische Codes 208
6.2 Faltungscodes 213
6.2.1 Codierung 213
6.2.2 Viterbi-Decodierung 218
6.2.3 Decodierung mit/ohne Zuverlässigkeitsinformation 222
6.3 Interleaving 223
7 Grundlagen der Informationstheorie 227
7.1 Information und Entropie 227
7.2 Quellencodierung 230
7.3 Kanalkapazität 233
7.3.1 Diskreter Kanal 233
7.3.2 Kontinuierlicher Kanal 236
7.4 Spektrale Effizienz digitaler Modulationsverfahren 238
8 Digitale Signalverarbeitung 241
8.1 Zeitdiskrete Signale und Systeme 241
8.1.1 Diskrete Faltung 244
8.1.2 Fourier-Transformation zeitdiskreter Signale 248
8.1.3 Diskrete Fourier-Transformation 250
8.1.4 Die z-Transformation 255
8.2 Digitale Filter 259
8.2.1 FIR-Filter 261
8.2.2 IIR-Filter 268
8.3 Entzerrer und adaptive Filter 271
8.3.1 Lineare Entzerrung 272
8.3.2 Adaptive Entzerrung 276
9 Funktions- und Entwurfsprinzipien von Kommunikationsnetzen 279
9.1 OSI-Referenzmodell 279
9.2 Netztopologien 282
9.3 Leitungsvermittlung und Paketvermittlung 283
9.4 Zuverlässige Datenübertragung 285
9.5 Dimensionierung 292
9.5.1 Bediensysteme 293
9.5.2 Paketvermittelte Netze 295
9.5.3 Leitungsvermittelte Netze 298
10 Dienstgüte und Verkehrsmanagement 300
10.1 Qualitätsparameter 300
10.2 Verkehrsmanagement 305
10.2.1 Verkehrsparameter 305
10.2.2 Verkehrssteuerung 308
11 Mehrfachzugriffsverfahren 313
11.1 Prinzipien des Mehrfachzugriffs 313
11.2 Dezentrale Zugriffssteuerung 317
11.2.1 ALOHA 317
11.2.2 Carrier Sense Multiple Access 320
11.3 Zentrale Zugriffssteuerung 323
12 Transport- und Anschlussnetze 326
12.1 Plesiochrone digitale Hierarchie (PDH) 327
12.2 Synchrone digitale Hierarchie (SDH) 329
12.3 Anschlussnetze 332
12.3.1 xDSL-Systeme 332
12.3.2 Kabelmodems 335
13 Integrated Services Digital Network (ISDN) 339
13.1 Grundlagen 339
13.2 Netzzugänge 341
13.2.1 Basisratenanschluss 341
13.2.2 Primärratenanschluss 346
13.3 Vermittlungstechnik 347
13.4 Signalisierung 350
14 Asynchronous Transfer Mode (ATM) 355
14.1 Grundlagen 355
14.2 Protokollreferenzmodell 357
14.2.1 Physikalische Schicht 357
14.2.2 ATM-Schicht 359
14.2.3 ATM-Anpassungsschicht 360
14.2.4 Betrieb und Wartung 368
14.3 Vermittlungstechnik 370
14.4 Verkehrsmanagement 373
14.4.1 Diensteklassen 373
14.4.2 Verkehrsparameter und Verkehrsüberwachung 373
14.4.3 Verkehrssteuerung 377
14.4.4 Qualitätsparameter der ATM-Schicht 379
14.5 Signalisierung 382
15 Internet Protocol (IP) 384
15.1 Grundlagen 385
15.2 Adressierung und Routing 387
15.3 Transportprotokolle 392
15.3.1 Transmission Control Protocol (TCP) 392
15.3.2 User Datagram Protocol (UDP) 396
15.4 Dienstgüte und Verkehrsmanagement 397
15.4.1 Integrated Services 397
15.4.2 Differentiated Services 399
15.4.3 Multiprotocol Label Switching (MPLS) 401
15.4.4 Qualitätsparameter der IP-Schicht 402
15.5 Voice over IP 403
15.5.1 Real-Time Transport Protocol 403
15.5.2 Signalisierung 406
15.6 IP Version 6 409
Anhang 1: Formelsammlung 412
Anhang 2: Tabellen und Theoreme der Fourier- Transformation 415
Anhang 3: Standardisierung 417
Verzeichnis der Beispiele 420
Literaturverzeichnis 422
Sachwortverzeichnis 427
4 Digitale Nachrichtenübertragung im Basisband (S. 84-85)
Wir sprechen von einem Basisband-Übertragungssystem, wenn das Quellensignal in seiner ursprünglichen Frequenzlage übertragen wird. So wird im analogen Fernsprechnetz das Sprachsignal im Basisband, also im Frequenzbereich von 300 Hz bis 3,4 kHz, übertragen. Beispiele für die Übertragung digitaler Signale im Basisband finden sich beim Teilnehmeranschluss des ISDN (siehe Kapitel 13) und bei lokalen Netzen für die Datenübertragung [57]. Die Übertragung im Basisband findet sich also bei leitungsgebundenen Systemen. Im Gegensatz zur Basisband-Übertragung wird bei der Bandpass-Übertragung das zu übertragende Signal auf einen Träger aufmoduliert und so zu höheren Frequenzen hin verschoben. Allerdings erfolgt auch hier die Signalverarbeitung im Wesentlichen im Basisband, so dass die in diesem Kapitel behandelten Konzepte von grundlegender Bedeutung für digitale Übertragungssysteme sind.
Die folgenden Abschnitte verschaffen uns zunächst einen Überblick über die wesentlichen Elemente und deren Aufgabe in einem Basisband-Übertragungssystem. Weitere inhaltliche Schwerpunkte bilden die Intersymbol-Interferenz und deren Vermeidung durch geeignete Pulsformung, die Berechnung der Bitfehlerwahrscheinlichkeit und das signalangepasste Filter als optimales Empfangsfilter.
4.1 Elemente eines digitalen BasisbandÜbertragungssystems
Wir gehen von der in Bild 4-1 gezeigten Struktur eines Übertragungssystems aus. Sender (engl.: transmitter) und Empfänger (engl.: receiver) werden häufig mit den Abkürzungen Tx bzw. Rx gekennzeichnet. Zwischen Sender und Empfänger befindet sich der Übertragungskanal. Der Kanal dämpft und verzerrt das Signal. Dies wird durch die Übertragungsfunktion HK( f ) beschrieben. Störungen überlagern sich additiv zum Signal. Handelt es sich um eine Störung durch weißes gaußsches Rauschen, so spricht man von einem AWGNKanal (AWGN: Additive White Gaussian Noise, siehe Abschnitt 2.3.6).
Der Sender besteht aus einem optionalen Scrambler zur Verwürflung des Datenstroms. Die Verwürflung dient der Vermeidung langer 0- oder 1-Folgen sowie der Dekorrelation von Signalen. Der Leitungscodierer bildet die zu übertragenden binären Symbole auf eine Pulsfolge ab. Wir werden verschiedene Leitungscodes mit unterschiedlichen Eigenschaften kennenlernen, die jeweils bestimmten Anforderungen gerecht werden. Besteht die Pulsfolge aus rechteckförmigen Grundimpulsen und wird dieses Signal über einen bandbegrenzten Kanal übertragen, so laufen die Grundimpulse auseinander mit der Folge, dass benachbarte Symbole sich gegenseitig beeinflussen. Man nennt dies Impulsnebensprechen oder Intersymbol- Interferenz. Aufgabe des Pulsformfilters ist die Erzeugung von Grundimpulsen, die eine Übertragung ohne Intersymbol-Interferenz ermöglichen. Bei der Pulsformung spielt das Kosinus-roll-off-Filter eine herausragende Rolle.
Am Empfängereingang befindet sich zunächst ein Empfangsfilter zur Unterdrückung der Störungen. Ein im Sinne einer minimalen Bitfehlerwahrscheinlichkeit optimales Filter ist das signalangepasste Filter. Durch den Kanal bedingte Verzerrungen sind eine weitere Ursache von Intersymbol-Interferenz. Verzerrungen werden durch einen Entzerrer kompensiert. Der auf den Entzerrer folgende Abtaster tastet das Signal im Symboltakt ab. Die Abtastwerte setzen sich aus dem Nutzsignal und dem Störsignal des Kanals zusammen. Der Entscheider besteht im einfachsten Fall aus einem Schwellenschalter, der das Nutzsignal extrahiert. Im Falle einer Fehlentscheidung kommt es zu Bitfehlern.
Es folgen die dem senderseitigen Leitungscodierer und Scrambler entsprechenden Funktionen des Leitungsdecodierers und des Descramblers. Der vom Abtaster benötigte Symboltakt muss in der Regel aus dem Eingangssignal zurückgewonnen werden. Dies ist die Aufgabe des Blocks Synchronisation. Bei vielen Übertragungssystemen ist der Bitstrom in Rahmen strukturiert. Ein Rahmen besteht aus einer festen Anzahl von Bytes, die zusätzlich zur Übertragung der Nutzdaten weiteren Funktionen wie z. B. der Fehlererkennung oder der Flusssteuerung dienen. Neben der Symboltaktsynchronisation ist dann eine Rahmensynchronisation zur Erkennung des Rahmenanfangs erforderlich.
| Erscheint lt. Verlag | 1.1.2006 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Technik ► Elektrotechnik / Energietechnik |
| Technik ► Nachrichtentechnik | |
| ISBN-10 | 3-446-40879-7 / 3446408797 |
| ISBN-13 | 978-3-446-40879-1 / 9783446408791 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 24,1 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich