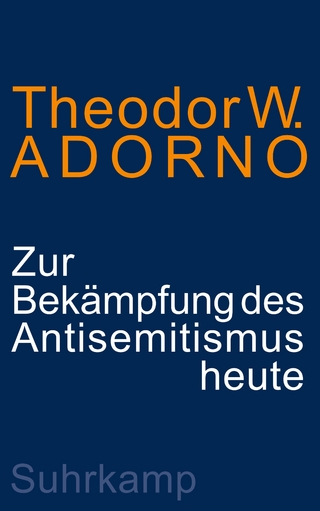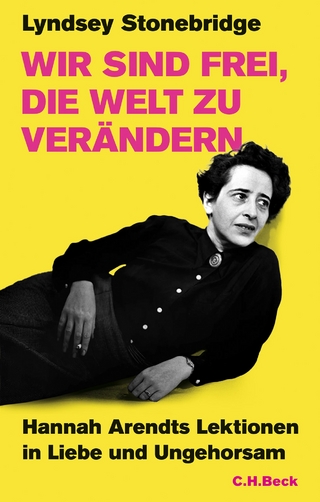"Innere Schulreform" in der Hauptschule
Wochenschau Verlag
978-3-89974-338-8 (ISBN)
- Keine Verlagsinformationen verfügbar
- Artikel merken
Dr. Albert Scherr ist Professor im Fachbereich Soziologie an der Pädagogischen Hochschule, Freiburg.
1. Einleitung
2. Organisationssoziologische Aspekte schulischer Organisationsentwicklung
2.1 Organisationen als operational geschlossene soziale Systeme: Die systemtheoretische Perspektive
2.2 Der institutionalistische Ansatz
2.3 Folgerungen für eine organisationswissenschaftlich fundierte Betrachtung aktueller Schulentwicklungskonzepte
3. Kontextfaktoren einer inneren Reform von Hauptschulen
3.1 Problemlagen des bundesdeutschen Schulsystems
3.2 Unterschiedliche sozialstrukturelle und sozialräumliche Rahmenbedingungen von Hauptschulen
3.3 Administrative Rahmenvorgaben für die Innere Schulreform in Baden-Württemberg
3.3.1 Bildungsstandards, Qualitätsmanagement und Evaluationen
3.3.2 Zurechnungsprobleme im Kontext von Qualitätsentwicklung und Wirkungsevaluationen
3.4 Bildung oder Training? Trivialisierung des ‚Interaktionssystems Unterricht’
3.5 Schulautonomisierung im Rahmen eines regionalen Bildungsnetzwerkes
3.6 Schulübergreifende Entwicklungsprogramme: Zürich und Hamburg
4. Innere Schulentwicklung: Heterogene Ansätze, diskontinuierliche Prozesse und prekäre Perspektiven
4.1 Kurzbeschreibungen der untersuchten Schulen
4.1.1 Spielreinschule: Demokratisierung und Schülerpartizipation als Kernelemente der Strukturreform
4.1.2 Abrahamschule: Lern- und Berufsfähigkeit als Zielbestimmungen des Reformprozesses
4.1.3 Fenichelschule: Prävention und Kompensation familialer Erziehungsdefizite als Leitmotive der Schulentwicklung
4.1.4 Bernfeldschule: ‚Lions Quest’, Sozialdienst und Knigge-Kurse als Integrationskonzept
4.1.5 Balintschule: Soziale Benachteiligung als Reformanlass
4.1.6 Kleinschule: Baden-Württembergische ‚Bildungswerkstatt’ mit Realschulorientierung
4.2 Problemorientierung als relevanter Prozessfaktor
4.2.1 Sozialer und kultureller Familienhintergrund als Reformanlass
4.2.2 Schulexterne Kooperationspartner und Schuladministration als relevante Umwelt
4.2.3 Folgerungen
4.3 Schulprofile und Schulprogramme
Folgerungen
4.4 Reformziele und Reformeffekte: Diskrepanzen zwischen inten dierten und empirischen Ergebnissen der Entwicklungsansätze
4.4.1 Veränderungen in der Lernumwelt: SchülerInnenperspektiven
4.4.2 ‚Absichtvolle Sozialisation’ und Kontrollillusion
4.4.3 Folgerungen
4.5 Operatives Management oder Demokratisierung? Die zentrale Rolle von Schulleitungen und Steuergruppen
Folgerungen
4.6 Funktion und Folgen externer Beratung
Folgerungen
5. Kontextbedingungen und Prozessqualität: Inputabhängigkeit der Hauptschule?
6. Ambivalente Strukturbildungsprozesse zwischen Selbst- und Fremdsteuerung
7. Organisations- und steuerungstheoretische Implikationen der empirischen Untersuchung: Verantwortungsdelegation und Schulautonomie
7.1 Kernprobleme der unvollständigen Modernisierung
7.2 Die Einzelschule als autonome Organisation und eigenständiger Reformakteur?
7.3 Was können/müssen Schulen als Organisationen lernen?
7.4 Die Verschiebung der Strukturfrage: Was bewirkt Schulautonomisierung?
8. Empfehlungen für die weitere Organisationsentwicklung
| Reihe/Serie | Wochenschau Wissenschaft |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Maße | 138 x 210 mm |
| Gewicht | 275 g |
| Einbandart | kartoniert |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung ► Politische Theorie |
| Schlagworte | Hauptschule • HC/Politikwissenschaft/Politische Wissenschaft, Politische Bildung • Schulreform • Schulsystem • Selektivität |
| ISBN-10 | 3-89974-338-5 / 3899743385 |
| ISBN-13 | 978-3-89974-338-8 / 9783899743388 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich