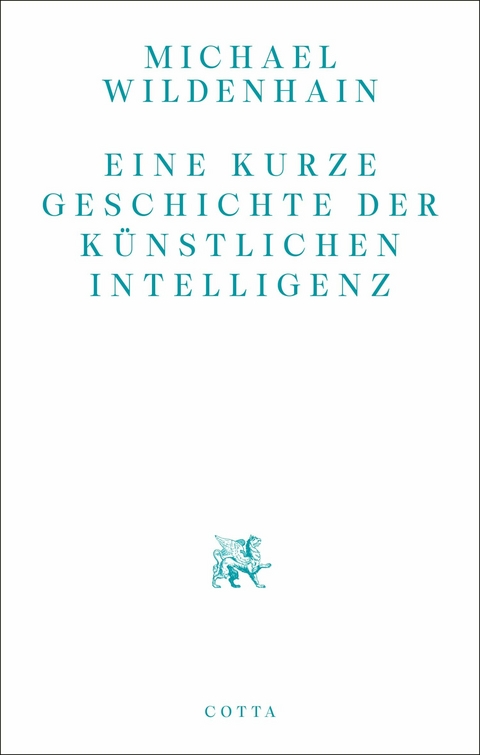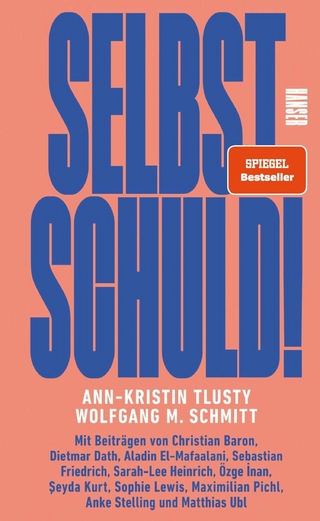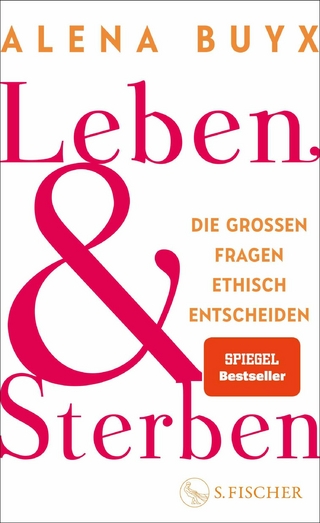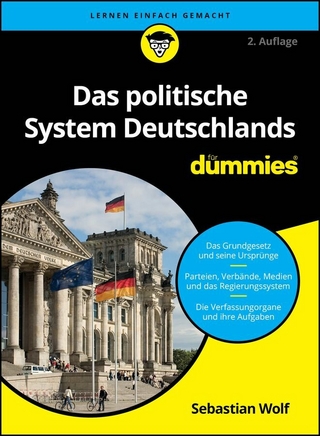Eine kurze Geschichte der Künstlichen Intelligenz (eBook)
120 Seiten
Klett Cotta_ALT (Verlag)
978-3-7681-9826-4 (ISBN)
Schon lange Zeit begleiten uns Faszination und Furcht vor Automaten, Robotern und Künstlicher Intelligenz: Der preisgekrönte Autor Michael Wildenhain rollt exemplarisch ihre spannende Geschichte von vorne auf und untersucht, ob KI schließlich ein eigenes Bewusstsein entwickeln kann.
Mit dem Launch von ChatGPT im November 2022 hat die Debatte um die Nutzung Künstlicher Intelligenz einen weiteren Höhepunkt erreicht. Michael Wildenhain erläutert anhand zentraler Stationen die Entwicklung und Rezeption Künstlicher Intelligenz: Von Literaten wie Mary Shelley hin zu den Pionieren des Programmierens wie Herbert A. Simon, Allen Newell und Alan Turing und den Philosophen Gottlob Frege und John Rogers Searle beschreibt den Werdegang der KI – und diskutiert fesselnd, inwieweit KI-Systeme bemessen am menschlichen Maßstab als intelligent betrachtet werden können, und ob es möglich ist, dass sie mit ihrer zunehmenden Komplexität ein eigenes Bewusstsein entwickeln, das uns Menschen schließlich überlegen sein könnte.
Michael Wildenhain ist 1958 in Berlin geboren, wo er auch heute lebt. Nach einem Philosophie- und Informatikstudium engagierte er sich in der Hausbesetzerszene – Stoff u. a. für seine ersten literarischen Veröffentlichungen: »zum beispiel k.«, »Prinzenbad« und »Die kalte Haut der Stadt«. Für sein literarisches Schaffen wurde er vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Alfred-Döblin-Preis, dem Ernst-Willner-Preis, dem Stipendium der Villa Massimo sowie dem London-Stipendium des Deutschen Literaturfonds. Michael Wildenhain veröffentlichte mehrere Romane. »Das Lächeln der Alligatoren« war für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert und wurde mit dem Brandenburger Kunstpreis ausgezeichnet. »Das Singen der Sirenen« erschien 2017 und war für den Deutschen Buchpreis nominiert. 2026 erscheint sein neuer Roman »Das Ende vom Lied«.
| Erscheint lt. Verlag | 16.3.2024 |
|---|---|
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Ada Lovelace • AI • Alan Turing • Artificial Intelligence • Buch • Bücher • Der Sandmann • E.T.A. Hoffmann • Frankenstein • Goethe • Golem • Gottlob Frege • Harari • Homo Deus • ISAAC ASIMOV • KI • Kulturgeschichte • Künstliche Intelligenz • Leib und Seele • Mary Shelley • Mathematik • neuerscheinung 2024 • Neuerscheinung Sachbuch • Philosophie • Philosophiegeschichte • Programmieren • Sachbuch • Schummeln mit ChatGPT • Stanislaw Lem |
| ISBN-10 | 3-7681-9826-X / 376819826X |
| ISBN-13 | 978-3-7681-9826-4 / 9783768198264 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich