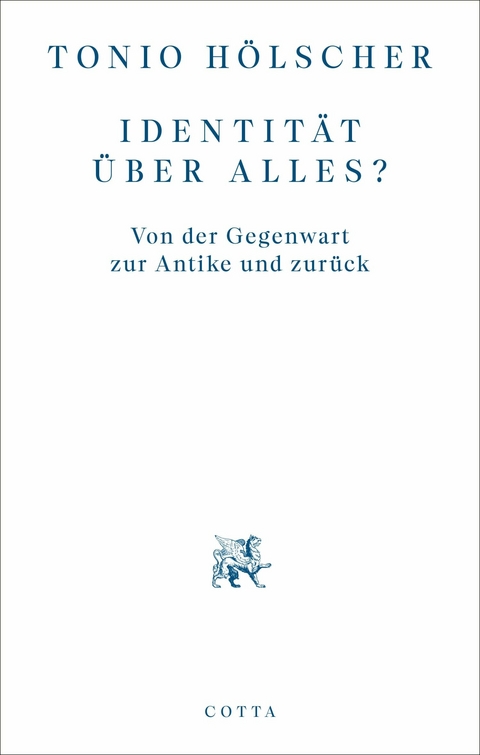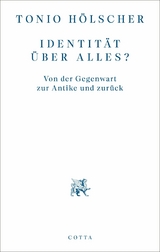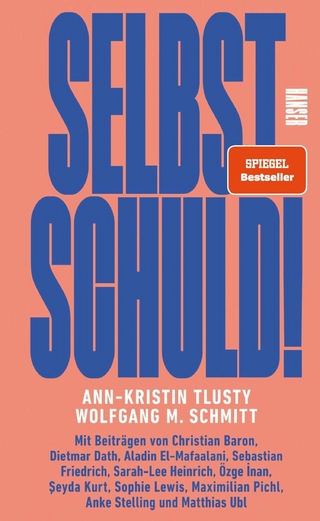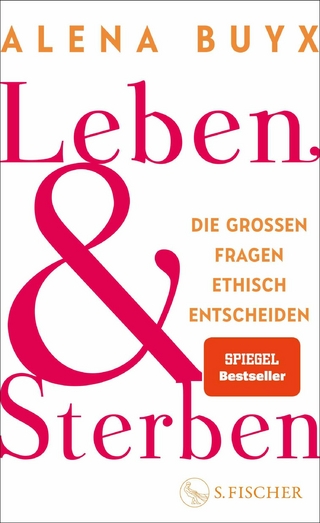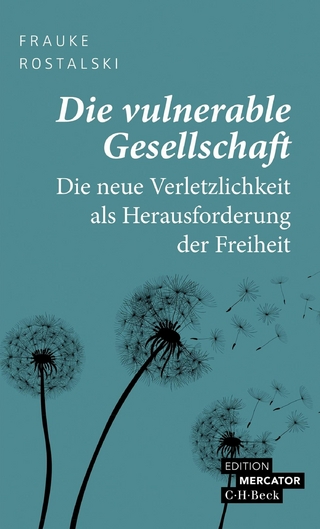Identität über alles? (eBook)
152 Seiten
Cotta (Verlag)
978-3-7681-9827-1 (ISBN)
In einem scharfsinnigen Essay untersucht Tonio Hölscher das inflationär gebrauchte Konzept der kulturellen, sozialen und politischen Identität und befragt es mit einem kritischen Rückblick auf das alte Griechenland. Zur Debatte stehen die Dynamik von politischer und kultureller Identität in der Antike wie auch die Bedeutung des Begriffs in der Gegenwart. Eine brillante wie streitbare Analyse von großer politischer Aktualität.
Das Bewusstsein von Identität ist in der global geöffneten Welt zu einem universalen Fundament des Zusammenhalts von politischen, sozialen, kulturellen und religiösen Einheiten geworden. Als Folge davon ist der Begriff der Identität in den aktuellen Diskursen wie in den historischen Wissenschaften in zwei Richtungen expandiert. Zum einen wird kollektiven Einheiten ihre Identität als ein nicht hinterfragbares Recht zugesprochen; dabei wird die konfliktsuchende Aggressivität kollektiver Identität in Kauf genommen. Zum anderen führt das fundamentalistische Konzept der Identität zu einem inflationären Gebrauch, der dem Begriff jede klärende Präzision nimmt und den Blick auf entscheidende Fragen des Lebens verdeckt.
Tonio Hölscher, geboren 1940, ist Professor em. für Klassische Archäologie an der Ruprecht- Karls-Universität Heidelberg. Von 2002 bis 2004 war er Forschungsprofessor am Deutschen Archäologischen Institut Rom. Zu den Schwerpunkten seiner Forschung gehören griechische und römische Staatsdenkmäler, griechische Mythenbilder und der antike Städtebau.
| Erscheint lt. Verlag | 16.3.2024 |
|---|---|
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Alterität • Andersheit • Anthropologie • Antike • Antikes Griechenland • Differenz • Diversität • Exklusion • Gemeinschaft • Geschichtsdeutung • Geschichtskultur • Geschichtspolitik • Geschichtswissenschaft • Gleichheit • Griechische Kultur • kulturelle Diversität • kulturelle Praktiken • Kulturelles Gedächtnis • kulturelle Techniken • Materielle Kultur • Otherness • Perserkriege • Rituale • Selbstheit • Solidarität • Symbole • Wertvorstellungen |
| ISBN-10 | 3-7681-9827-8 / 3768198278 |
| ISBN-13 | 978-3-7681-9827-1 / 9783768198271 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich