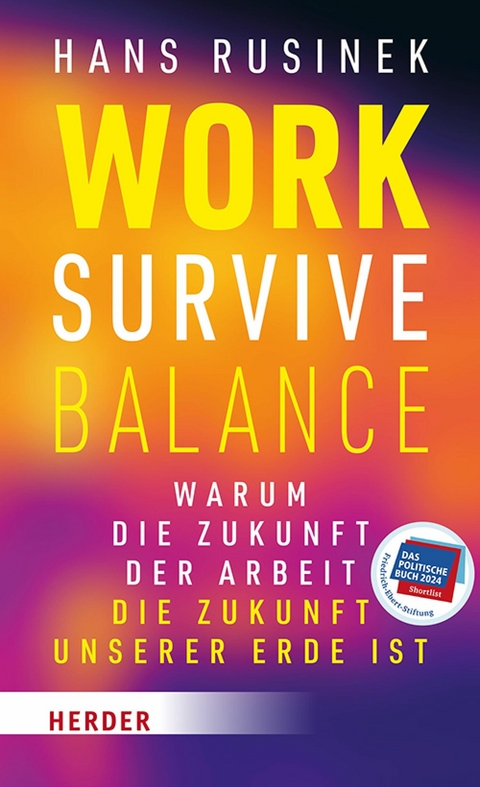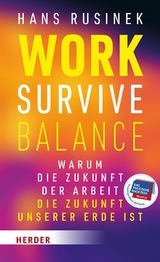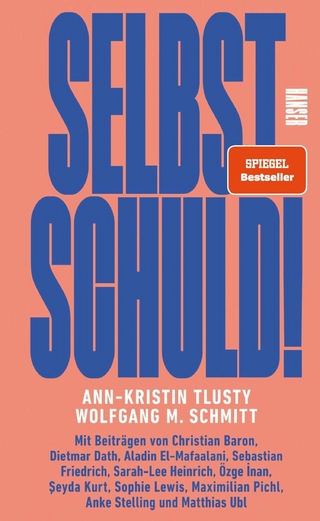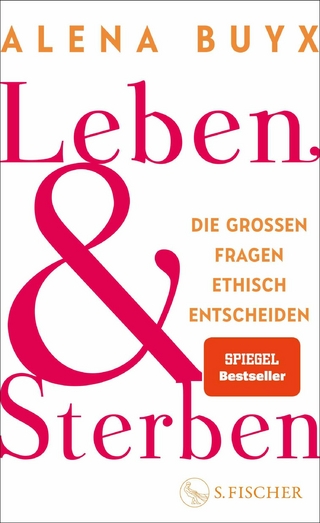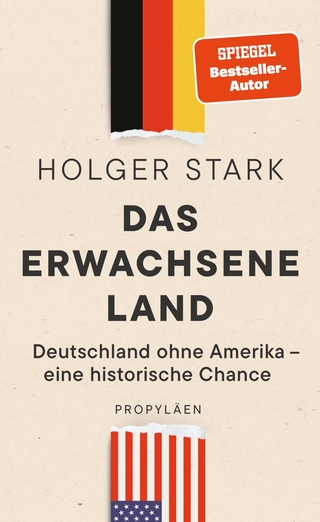Work-Survive-Balance (eBook)
240 Seiten
Verlag Herder
978-3-451-82889-8 (ISBN)
Wie kann also sinnvolles Arbeiten im Anthropozän aussehen? Für diese Frage bringt der Arbeitsforscher Hans Rusinek die Zukunft der Arbeit und die Zukunft des Planeten radikal zusammen. Und dekliniert einmal durch, welche Denk- und Handelsbarrieren wir für eine enkeltaugliche Arbeitswelt überwinden müssen: etwa im Umgang mit Zeit, im Beachten unserer und anderer Körper oder im Entdecken künstlicher Intelligenz. Denn noch können wir unsere Zukunft selbst gestalten!
Hans Rusinek, geb. 1989, forscht, berät und publiziert zum Wandel der Arbeitswelt. Er erfüllt außerdem einen Lehrauftrag zu "Future of Work" an der Fresenius Universität in Hamburg und ist Fellow im ThinkTank30 des Club of Rome Deutschland. Bis 2020 war er Strategiedirektor und erster Mitarbeiter der Purpose-Beratung der Boston Consulting Group, BrightHouse. Zudem beteiligt er sich publizistisch an Debatten zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, etwa in BrandEins, Capital, DIE ZEIT, ThePioneer oder Deutschlandfunk, wofür er 2020 den Förderpreis für Wirtschaftspublizistik der Ludwig-Erhard-Stiftung bekam. Hans Rusinek studierte VWL, Philosophie und Politik an der London School of Economics und in Bayreuth, sowie Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut.
| Erscheint lt. Verlag | 9.10.2023 |
|---|---|
| Zusatzinfo | ca. 5 Abb. |
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | 4-Stunden-Woche • Anthropozän • Arbeit • Bullshit Jobs • Care-Arbeit • carework • Generationenkonflikt • Greenwashing • hypbrides Arbeiten • K.I. • Klimakatastrophe • Klimakrise • Klimawandel • Künstliche Intelligenz • Meritokratie • new work • Selbstverwirklichung • Umwelt • Verantwortung • Zukunft der Arbeit |
| ISBN-10 | 3-451-82889-8 / 3451828898 |
| ISBN-13 | 978-3-451-82889-8 / 9783451828898 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich