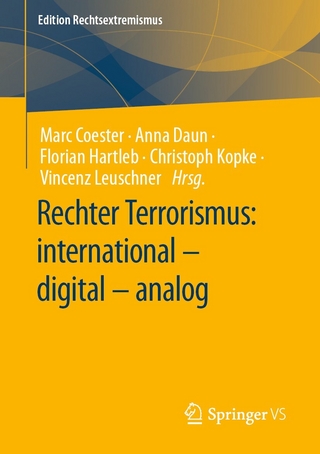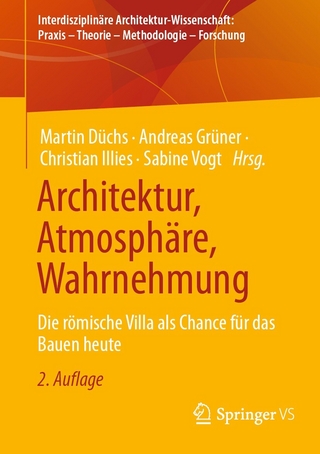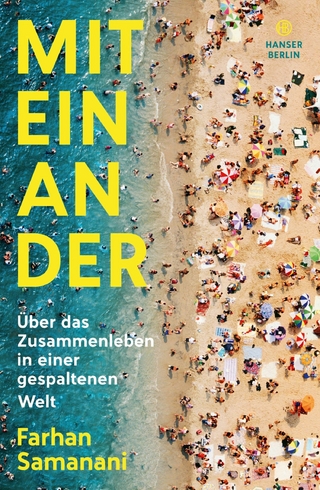Die Grenzen des Zusammenhalts (eBook)
259 Seiten
Campus Verlag
978-3-593-45580-8 (ISBN)
Dr. Axel Salheiser ist Soziologe, seit 2019 wissenschaftlicher Referent am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) Jena und seit Februar 2022 dessen wissenschaftlicher Leiter. Er forscht unter anderem zu Rechtsextremismus, Ethnozentrismus und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Im Rahmen der Beteiligung des IDZ am Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ) ist Axel Salheiser Sprecher des Teilinstituts Jena und Projektleiter. Maria Alexopoulou ist habilitierte Historikerin. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der Migrations- und Rassismusgeschichte. Sie leitet zwei Projekte am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin im Rahmen des »Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt«. Christian Meier zu Verl ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Arbeitsgruppe »Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie« der Universität Konstanz und Mitglied des »Forschungsinstituts gesellschaftlicher Zusammenhalt«. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen qualitative Sozialforschung, Gesundheitssoziologie, Migrationssoziologie, Dis-/Ability Studies sowie Wissenschafts- und Techniksoziologie. Alexander Yendell ist promovierter Soziologe und forscht am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Rechtsextremismus und Autoritarismus, politischer Protest, religiöse Pluralität, Antisemitismus, Islamophobie und soziale Ungleichheit.
Dr. Axel Salheiser ist Soziologe, seit 2019 wissenschaftlicher Referent am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) Jena und seit Februar 2022 dessen wissenschaftlicher Leiter. Er forscht unter anderem zu Rechtsextremismus, Ethnozentrismus und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Im Rahmen der Beteiligung des IDZ am Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ) ist Axel Salheiser Sprecher des Teilinstituts Jena und Projektleiter. Maria Alexopoulou ist habilitierte Historikerin. ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der Migrations- und Rassismusgeschichte. Sie leitet zwei Projekte am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin im Rahmen des »Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt«. Christian Meier zu Verl ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Arbeitsgruppe »Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie« der Universität Konstanz und Mitglied des »Forschungsinstituts gesellschaftlicher Zusammenhalt«. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen qualitative Sozialforschung, Gesundheitssoziologie, Migrationssoziologie, Dis-/Ability Studies sowie Wissenschafts- und Techniksoziologie. Alexander Yendell ist promovierter Soziologe und forscht am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Rechtsextremismus und Autoritarismus, politischer Protest, religiöse Pluralität, Antisemitismus, Islamophobie und soziale Ungleichheit.
Rechtsextreme und rassistische Einstellungen im Kontext von Radikalisierung und Co-Radikalisierung am Beispiel Österreichs
Alexander Yendell
Abstract
In Österreich hat die rechtspopulistische und in Teilen rechtsextreme Partei FPÖ seit Anfang der 1990er Jahre trotz zahlreicher Skandale beachtliche Erfolge. Gleichzeitig ist das Ausmaß an autoritären, ausländerfeindlichen und insbesondere islamfeindlichen Einstellungen in der österreichischen Bevölkerung sehr hoch. Nicht nur die FPÖ macht mit den Ängsten und Vorurteilen der Bevölkerung Politik. Auch die ÖVP stellt in ihrem Kampf gegen den »politischen Islam« Muslim:innen unter Generalverdacht und trägt zu einer islamfeindlichen Stimmung in Österreich bei. Die Lage hat sich nach dem Terroranschlag von Wien im November 2020 und den anschließenden Razzien bei angeblichen islamistischen Unterstützer:innen im Zuge der Operation Luxor verschärft. Äußerst problematisch ist zudem, dass es in Österreich keine breite Rechtsextremismus- und Rassismusforschung gibt und die Diskussion über die nationalsozialistische Vergangenheit in weiten Teilen der Bevölkerung tabuisiert ist. Vor diesem Hintergrund beschäftige ich mich im vorliegenden Beitrag mit dem Ausmaß an rechtsextremen, islamfeindlichen und rassistischen Einstellungen in der österreichischen Bevölkerung und gehe zudem der Frage nach, welche Ursachen diesen Einstellungen zugrunde liegen. Dabei diskutiere ich anhand einer Bevölkerungsumfrage aus dem Jahr 2021 das Erklärungspotenzial zahlreicher Theorien aus der sozialpsychologischen Rechtsextremismus- und sowie im Speziellen Dynamiken der Radikalisierung und Co-Radikalisierung im Kontext von Rechtsextremismus/-populismus und dem Terroranschlag von Wien im November 2020.
Keywords: Österreich; Rechtsextremismus; Rassismus; Islamfeindlichkeit; Radikalisierung
Anders als in Deutschland stellt in Österreich Rechtsextremismus keine verfassungsfeindliche oder strafrechtlich relevante Position dar. Ebenso ist der vorherrschende Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit anders als in Deutschland. Kritisiert wird, dass Österreich sich selbst als Opfer des Nationalsozialismus inszeniert, dabei aber verleugnet, dass antisemitische und demokratiefeindliche Positionen vor dem »Anschluss« an das nationalsozialistische Deutschland weit verbreitet waren (Emmerich 2017, Enderle-Burcel/Reiter-Zatloukal 2018). Der Opfermythos in Österreichs Erinnerungskultur und die damit zusammenhängende mangelhafte Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus führten dazu, dass das Eingestehen der Mitschuld an den Verbrechen des Nationalsozialismus weitestgehend verhindert wurden. Auch deshalb war es nach dem Zweiten Weltkrieg möglich, dass Rechtspopulisten und Rechtsextreme eine bedeutende Rolle in der österreichischen Politik spielten. Einflussreich ist insbesondere die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), die sich bereits zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gründete, deren sonstigen Mitglieder häufig eine nationalsozialistische Vergangenheit hatten und deren erster Parteichef SS-General gewesen war. Die FPÖ wird von zahlreichen Wissenschaftler:innen nicht nur als rechtspopulistisch, sondern als rechtextrem eingestuft (Strobl 2021; Salzborn 2017; Stöss 2010; Jäger 2004; Bergsdorf 2000). Sie fällt wegen ihrer Volksgemeinschaftsideologie, ihres Ethnozentrismus, ihres Rassismus und ihrer xenophobischen und anti-demokratischen Ausrichtung auf. Wie für viele rechtsextreme Parteien sind vor allem der Islam und die Muslim:innen bzw. die angebliche kulturelle Unterwanderung zentral für die aktuelle Politik des Ausgrenzens und des Hasses. Die anti-islamische Rhetorik spielte für die FPÖ seit Ende der 1990er Jahre eine immer wichtigere Rolle, beeinflusste allerdings auch andere politische Parteien und den öffentlichen Diskurs (Hafez u. a. 2022). Im Speziellen konzentriert sich der anti-islamische Diskurs auf die Gefahr des »politischen Islams«. Bislang war die FPÖ seit 1983 viermal in einer Regierung vertreten. Im Jahr 2019 beendete die sogenannte Ibiza-Affäre die letzte Beteiligung der FPÖ an einer Regierung.
Sichtbar war der Rechtsextremismus in Österreich auch während der COVID-19-Pandemie. Bei wiederholten Demonstrationen betrieben Corona-Leugner antidemokratische Hetze und nutzten die Demonstrationen zur Mobilisierung und Rekrutierung. In diesem Kontext kam erschwerend hinzu, dass am 2. November 2020 ein Attentäter einen islamistischen Anschlag verübte, bei dem vier Menschen getötet und 23 teils erheblich verletzt wurden. Nur eine Woche später wurde im Auftrag des österreichischen Innenministeriums eine politische Großrazzia gegen angebliche Netzwerke von Muslimbrüdern und Mitgliedern der Hamas durchgeführt. Deren Ziel wurde bislang verfehlt, da die Razzien zum Teil rechtswidrig waren und es bislang weder Anklagen noch Verurteilungen gab. Mit Blick auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt sind sowohl der islamistische Terrorismus als auch die Reaktionen insbesondere der Rechtspopulist:innen und -extremen relevant, da solche Konflikte zu Co-Radikalisierungen führen können, die Konflikte verschärfen. Gemeint ist damit, dass eine radikale Gruppe jeweils auf die verfeindete Gruppe radikal reagiert und sich somit eine Spirale der Gewalt entwickeln kann.
Vor dem Hintergrund des österreichischen Umgangs mit dem Nationalsozialismus ist es wenig verwunderlich, dass die Rechtsextremismus-, Vorurteils- und Rassismusforschung in Österreich eher in den Kinderschuhen steckt. Ein regelmäßiges Rechtsextremismus- und Rassismusmonitoring gibt es nicht, allerdings immerhin den Demokratiemonitor, den das SORA Institute for Social Research and Consulting seit 2018 einmal jährlich durchführt (SORA 2022). Dieser konzentriert sich auf Fragen zur Unterstützung der Demokratie in Österreich, beinhaltet allerdings keine Fragen zu rechtsextremen oder rassistischen Einstellungen. Auch aus diesem Grund erscheint es notwendig, sich mit rechtsextremen und rassistischen Einstellungen innerhalb der Bevölkerung Österreichs zu beschäftigen. In den folgenden Abschnitten widme ich mich auf Grundlage einer eigens durchgeführten Bevölkerungsumfrage drei Forschungsfragen: 1. Wie muslimfeindlich, rassistisch und rechtsextrem ist die österreichische Gesellschaft? 2. Welche Indikatoren, die sich aus klassischen sozialpsychologischen Erklärungsansätzen ableiten, stehen in Zusammenhang mit Muslimfeindlichkeit, Rassismus und Rechtsextremismus? 3. Inwiefern sind Muslimfeindlichkeit und Anti-Schwarzen-Rassismus mit negativen Einstellungen zu Demokratie, Gewalt, Radikalisierung und Co-Radikalisierung assoziiert?
1.Theorien zur Erklärung rechtsextremer und rassistischer Einstellungen
Für die Erklärung von Rechtextremismus und Rassismus liegen zahlreiche Erklärungsansätze im Speziellen aus der sozialpsychologischen Rechtsextremismus- und Vorurteilsforschung vor. Eine Auswahl davon wurde für die Konzeption der vorliegenden Studie verwendet und wird hier kurz vorgestellt.
Eine der bekanntesten Erklärungen ist die Theorie der autoritären Persönlichkeit (Reich 1933; Horkheimer 1936; Adorno u. a. 1950), die auf der Psychoanalyse von Sigmund Freud und insbesondere auf dessen Konzept des »Narzissmus der kleinen Differenzen« (Freud 1930) basiert. Diese Theorie behauptet, dass es einen Zusammenhang zwischen Autoritarismus, antidemokratischen Einstellungen, Vorurteilen und Diskriminierung gibt. Sie diskutiert auch die Rolle von Religion und Religiosität als sowohl unterstützende als auch hemmende Faktoren für faschistische, ethnozentrische und antisemitische Einstellungen. Basierend auf der Psychoanalyse von Freud gehen die Begründer dieser sozialpsychologischen Theorie davon aus, dass unbewusste Konflikte, die in der Kindheit entstanden sind, nicht nur psychische Beschwerden und Krankheiten verursachen, sondern auch mit ethnozentrischen, antisemitischen und faschistischen Einstellungen verbunden sind. Es wird angenommen, dass Menschen, die einer faschistischen Ideologie zugeneigt sind, in ihrer Kindheit ...
| Erscheint lt. Verlag | 6.3.2024 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Gesellschaftlicher Zusammenhalt |
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Soziologie ► Spezielle Soziologien |
| Schlagworte | Demokratie • Einwanderungsgesellschaft • Exklusion • FGZ • Forschungszentrum Gesellschaftlicher Zusammenhalt • Gesellschaft der Angst • gesellschaftlicher Protest • Gesellschaftlicher Zusammenhalt • Gesellschaftliche Spaltung • Identitätspolitik • Inklusion • Konfliktforschung • Polarisierung • Postmigrantische Gesellschaft • Protest • Radikalisierung • Rassismus • Rechtsextremismus • Rechtspopulismus • Sozialer Ausschluss |
| ISBN-10 | 3-593-45580-3 / 3593455803 |
| ISBN-13 | 978-3-593-45580-8 / 9783593455808 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 5,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich