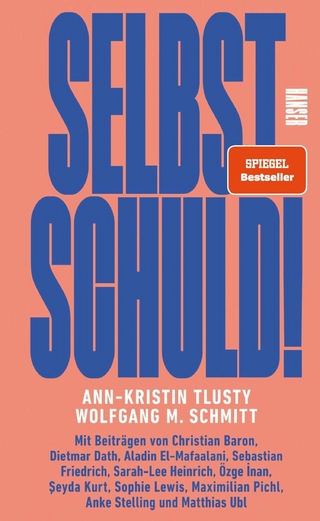Nie mehr leise (eBook)
204 Seiten
Aufbau digital (Verlag)
978-3-8412-3222-9 (ISBN)
Jetzt sind wir dran!
Vom migrantischen Arbeiter:innenkind zur erfolgreichen Akademikerin: Betiel Berhes Kindheit zwischen Hochhäusern hat ihren Blick auf Klassenunterschiede und strukturelle Diskriminierung geschärft. Heute arbeitet sie als Ökonomin und Anti-Rassimus- und -Klassismus-Trainerin und hat das Institut für Social Justice & Radical Diversity in München mitbegründet. Anhand ihrer eigenen Biographie und anderer Lebensgeschichten erzählt sie, wie schwer sozialer Aufstieg ist, welche feinen Unterschiede niemals verschwinden - und wie eine neue migrantische Mittelschicht wächst, die sich gegen strukturellen Klassismus und Rassismus stellt und der Intersektionalität verpflichtet ist. Doch Berhes vielfältige Rollenerfahrungen eröffnen ihr auch den Blick für Solidaritäten, dort, wo andere schon jede Hoffnung aufgegeben haben. Sie zeigt, wie sich momentan eine ganze Gesellschaft im Wandel befindet, indem die Menschen zu Wort kommen und an Einfluss gewinnen, die Diskriminierung und Unterdrückung erfahren haben. Provokant, persönlich, augenöffnend.
Betiel Berhe ist studierte Ökonomin und Aktivistin. In der Vergangenheit war sie für zahlreiche internationale Organisationen sowie NGOs tätig, hat das Social Justice Institut in München mitbegründet und ist in unterschiedlichen rassismuskritischen Netzwerken aktiv. Sie hält Vorträge, gibt Workshops und berät zu den Themen Migration, (Anti-)Rassismus, Diversity und Bildung. Aktuell arbeitet sie schwerpunktmäßig zur Verbindung von »Race und Class« im deutschen Kontext.
1. INTEGRATION
Geschichten von Segregation,
Unterdrückung, Resilienz und Aufstieg
Die Kinder von hinterm Haus
Dort, wo ich aufwuchs, duftete es überall nach Essen, in jeder Wohnung wurde eine andere Sprache gesprochen und die Migrationsgeschichte meiner Eltern war nur eine von vielen. Die Menschen in unserer Hochhaussiedlung kamen aus Eritrea, Palästina und Syrien, den Republiken der ehemaligen Sowjetunion, der Türkei und Kurdistan, Italien, Spanien und den Ländern Ex‑Jugoslawiens. Menschen aus Vietnam, den USA, der Elfenbeinküste und auch Deutschland lebten alle dicht an dicht. Die meisten der Menschen kamen, so wie meine Eltern, in den frühen 80er Jahren nach Deutschland. Unsere Hochhaussiedlung war – ohne Romantisierung – ein Ort der Gleichheit, der Vielfalt und der Differenz. Die unterschiedlichen Sprachen, Religionen und Kulturen, aber auch Gender, Behinderungen, Einkommen oder der formelle Bildungsgrad der Menschen machten die Diversität in unserer Hochhaussiedlung aus. Viele unserer Unterschiede waren sichtbar, einige aber auch nur spürbar. Deshalb kann ich nur erahnen, wie sich die queeren migrantischen Kinder und Jugendlichen gefühlt haben. Oder welche Anpassungsstrategie die wenigen Kinder ohne Migrationsgeschichten entwickelten, um ihre Zugehörigkeit zu demonstrieren. Unsere Hochhaussiedlung war also nicht frei von gesellschaftlichen Zwängen, und dennoch bot sie all ihren Bewohner*innen ein Gefühl von Zugehörigkeit, die nicht auf Gleichheit basierte. Anders als Kinder, die in »weißen, bürgerlichen« Wohnorten aufwuchsen, lebten wir nie in der Illusion einer vermeintlichen Homogenität. Für uns war es so normal wie bereichernd, unterschiedlich zu sein. Wir haben gemeinsam gelacht, geweint und gestritten, uns auch mal geprügelt und wieder versöhnt.
Besonders gerne erinnere ich mich an die langen Sommertage »hinterm Haus«. So nannten wir den Ort zwischen den grauen Hochhäusern, wo keine Autos fuhren und unsere Eltern uns vom Fenster oder Balkon aus zum Essen rufen konnten. Wir haben »hinterm Haus« Baseball, Murmeln und Fangen gespielt. Haben Fahrrad- oder Rollschuhfahren gelernt und sind gummigehüpft.
Und ganz besonders gerne haben wir Klatschkarten gespielt. An jedem noch so kleinen, aber windstillen Ort, an dem es eine glatte Oberfläche gab, saßen wir kniend oder im Schneidersitz auf dem Boden und haben in die Hände oder auf den Asphalt geklatscht, um zu versuchen, die kleinen Sammelbilder von Panini umzudrehen. Wer es schaffte, durch den vom Klatschen erzeugten Luftzug eine oder sogar zwei Karten gleichzeitig zu wenden, hatte das Spiel gewonnen und durfte die Karten der anderen behalten. Meist spielten wir nur zu zweit, ohne Publikum. Doch wenn die Besten gegeneinander antraten, versammelten sich alle um sie herum. Von ihnen konnte man sich immer etwas abschauen, aber dafür mussten wir ganz still sein. Denn wer nicht aufpasste, konnte versehentlich einen kleinen, aber relevanten Luftzug auslösen, dadurch die Position der Karten verändern und somit das Spiel entscheiden. Wenn das passierte, durfte man nur noch von Weitem zuschauen. Manche verzockten vor den Augen aller anderen einen ganzen Stapel der wertvollen Karten. Aber das war nicht weiter schlimm. Spätestens, wenn jemand sagte: »Komm, lass uns spielen!«, und du keine Karten hattest, bekamst du ein paar geschenkt, damit das Duell trotzdem stattfinden konnte.
Diese Klatschkarten-Spiele waren schon richtig cool, aber mein persönliches Highlight waren unsere Gespräche über die »Mini Playback Show«. Nach jeder ausgestrahlten Show trafen wir uns am nächsten Tag, um über die Details der letzten Sendung zu sprechen und natürlich die Lieder nachzusingen. Wie damals wahrscheinlich alle Kinder mit Kabelanschluss träumten auch wir davon, einmal in der Zauberkugel in unseren Lieblings-Superstar verwandelt zu werden. Na ja, fast alle Kinder. Denn ich träumte eher davon, Teil der Ballettgruppe von Lucia Marthas zu sein, die für die spektakulären Tanzeinlagen bei der »Mini Playback Show« sorgte. In den 90er Jahren gab es im deutschen Fernsehen kaum Kinder, die so aussahen wie ich. Doch hier tanzten in jeder Show mindestens drei Schwarze Mädchen mit. Die Sendung war also unterhaltsam und empowernd zugleich, da wir uns zum Teil in den Kindern auf dem Bildschirm wiedererkennen konnten.1
Doch so viel mir die Show damals auch bedeutete, ist sie aus heutiger rassismuskritischer Perspektive eindeutig für das Blackfacing der Kinder zu beanstanden, das regelmäßig stattfand, wenn weiße Kinder beispielsweise Aretha Franklin oder Prince präsentieren wollten. Blackfacing, also die Darstellung Schwarzer Menschen durch angemalte weiße Menschen, hat ihren Ursprung in den USA des 18. und 19. Jahrhunderts. In dieser Zeit fanden sogenannte »Minstrel Shows« statt, beliebte Musik- und Unterhaltungsveranstaltungen, für die weiße Menschen sich das Gesicht mit Farbe beschmierten, um auf der Bühne eine Schwarze Person zu mimen. Zur Unterhaltung eines weißen Publikums wurden in diesen Shows Sprache und Tanz von Afroamerikaner*innen karikiert – mit grotesk überzeichneter Gestik und Mimik und dicken roten Lippen.2 Diese rassistische Praxis überdauert bis in unsere Zeit und ist noch immer besonders in den Niederlanden, in denen die »Mini Playback Show« produziert wurde, tief verwurzelt. Dort ist der »Zwarte Piet« – entsprechend dem deutschen Knecht Ruprecht – der Helfer des Heiligen Nikolaus. Er entspringt geradewegs einer Tradition aus dem 19. Jahrhundert und soll in der Weihnachtszeit in Blackface kleine Kinder zum Lachen bringen und ihnen Angst einjagen. Seit Jahren schon wird Blackfacing von Schwarzen Aktivist*innen und ihren Allies kritisiert, und dennoch weigern sich große Teile der niederländischen Bevölkerung, diese rassistische Praxis abzuschaffen.3 Eine ähnliche Diskussion führen wir auch in Deutschland jedes Jahr aufs Neue am Feiertag »Heilige drei Könige«. Am 6. Januar ziehen deutschlandweit um die 300 000 Sternsinger*innen von Tür zu Tür, um Spenden für die Kirche zu sammeln. Auch hier wird traditionell weißen Kindern das Gesicht angemalt, wenn sie die Rolle von Caspar, dem tradiert Schwarzen unter den drei Königen, übernehmen sollen. Denn das Nachahmen von rassifizierten Menschen ist seit jeher ein großer Bestandteil weißer Kultur, wie Alice Hasters in ihrem Buch »Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten« schreibt. In Bezug auf die Sternsinger*innen fragt die Schwarze Autorin zu Recht, warum die schwarze Farbe für die beabsichtigte Aussage unbedingt nötig sein soll. »Von mir würde doch auch niemand erwarten, dass ich nur mit weißer Farbe im Gesicht einen weißen Charakter verkörpern kann.«4 Mittlerweile empfiehlt der Träger der Aktion Dreikönigssingen, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, auf seiner Homepage, auf schwarze Schminke zu verzichten. Trotzdem gehen jedes Jahr weiterhin schwarz geschminkte Kinder am 6. Januar von Tür zu Tür.
So empowernd die »Mini Playback Show« für mich damals also auch war, ist hieran zu erkennen, wie sich rassistische Strukturen bereits in den Alltag von Kindern einschleichen.
Was sich die weißen Kinder wohl gedacht haben, als sie von ihrer Kirche zum Spendensammeln in unsere Straße geschickt wurden? Dass unser Viertel von Außenstehenden nicht als ein Ort des sozialen Zusammenhalts und der Vielfalt wahrgenommen wurde, ahnten wir schon, als wir jung waren. Welchen Einfluss dies auf unseren weiteren Werdegang nehmen würde, realisierten wir damals aber noch lange nicht. Doch je älter wir wurden und je mehr migrantische Mittelschichtsfamilien unser Viertel verließen, desto mehr bekamen wir den strukturellen Rassismus und Klassismus der weißen Dominanzgesellschaft zu spüren. Sobald wir uns von unserem Schutzraum hinterm Haus entfernten, erlebten wir permanent, was strukturelle Diskriminierung, also die systematische gesellschaftliche Benachteiligung bestimmter Gruppen auf individueller, kultureller und institutioneller Ebene, in der Realität bedeutet: in der Schule, bei Behördengängen, beim Busfahren, beim...
| Erscheint lt. Verlag | 14.3.2023 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Alice Hasters • Alltagsdiskriminierung • Alltagsrassismus • Anti-Rassismus • Aufstieg • Diskriminierung • Emilia Roig • Feminismus • Gemeinschaft • gesellschaftlicher Aufstieg • Gesellschaftlicher Wandel • Intersektionalität • Klassenkampf • Klassismus • migrantische Mittelschicht • Neue Mittelschicht • Rassismus • Rassismuserfahrungen • Solidarität • struktureller Rassismus • Tupoka Ogette • weiße Mittelschicht • white privilege • why we matter |
| ISBN-10 | 3-8412-3222-1 / 3841232221 |
| ISBN-13 | 978-3-8412-3222-9 / 9783841232229 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich