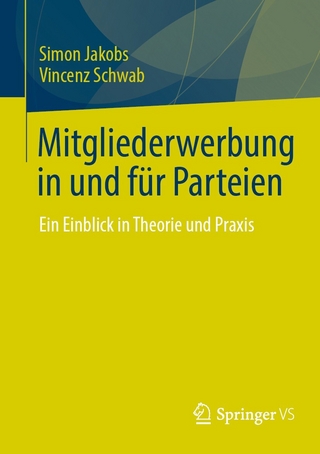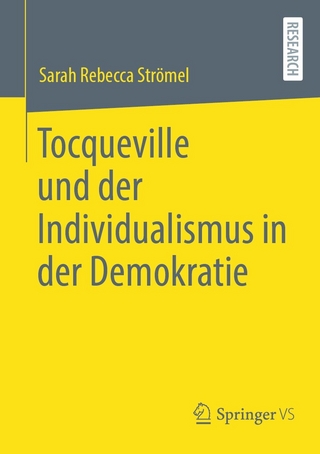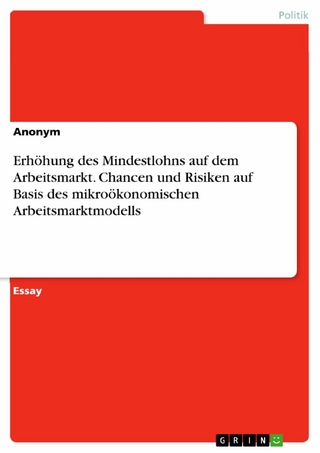Biografische Entwürfe zwischen politischem Wandel und familiärer Überlieferung in Ostdeutschland (eBook)
436 Seiten
Tectum-Wissenschaftsverlag
978-3-8288-7849-5 (ISBN)
Vorwort
Mit den nächsten Zeilen möchte ich dem/der Lesenden1 einen Einblick vermitteln, welche hintergründigen Gedanken ich beim Schreiben dieser Arbeit hatte. Stets war es mein Interesse zu ergründen, wie Menschen auf Umbrüche reagieren, sei es auf persönliche (wie einen Stellenwechsel), gesundheitliche (wie die aktuelle Corona-Pandemie), kriegerische (wie die vergangenen Weltkriege) oder auch politische (wie der Fall der Berliner Mauer). Warum ich mich genau für Umbrüche interessiere, liegt zum großen Teil daran, dass ich in meinem eigenen Leben eine Fülle von Umbrüchen erlebt habe. Sie haben sowohl positive als auch negative Einflüsse auf den Verlauf meines Lebensweges gehabt. Es war nicht immer einfach zu denken und zu sagen, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert und sich positiv entwickeln wird. So fragte ich mich seit langem, ob dies eine Erkenntnis von Menschen ist, die viele oder kaum Umbrüche erlebt haben.
Auf der Suche nach Antworten zu dieser Frage konnte ich im Rahmen meiner Promotionszeit zwischen 2013 und 2021 feststellen, dass das, was Arnold van Gennep schon 1909 als „Folge von Etappen“ bzw. „Übergänge[n]“ (Gennep 2005, 15) beschrieben hat, jeder im Leben zu bewältigen hat. Der eine empfindet einen Schulwechsel als nachhaltiges Ereignis, der andere einen Verlust von Angehörigen, noch andere politische Großereignisse wie die Wende. Gemeinsam ist allen Menschen, mit denen ich während dieser Zeit Gespräche zu ihrem Leben führen durfte, dass die von ihnen erlebten Umbrüche das eigene Leben von Grund auf verändert haben. Es lag an dem Einzelnen selbst, welche Erkenntnis er hieraus zog, wie er damit umging und gegenwärtig bewertet. Keiner kann hierzu sagen: „Ach, hab’ dich nicht so. Das ist doch nicht so schlimm gewesen“, weil der Einzelne dies so empfindet.
Als es beim Auswerten der Lebensgeschichten darum ging, die erlebten Umbrüche zu vergleichen, ist mir immer wieder aufgefallen, wie wichtig es ist, die Perspektive des/der Erlebenden einzunehmen, aus seinen/ihren Augen nachzuvollziehen, warum ein Ereignis ihn/sie leichter oder schwerer getroffen hat, warum er/sie darüber auf eine bestimmte Art und Weise spricht. Denn sein/ihr Leben hat immer eine Vorgeschichte, die zu dem Ereignis geführt hat, das er/sie erzählt, und gleichermaßen bestimmt die zu erzählende Geschichte auch, wie er/sie sich zukünftig selbst sehen will und wie offen sein/ihr Weg hierdurch bleibt.
Daher appelliere ich an jede/n Lesende/n, die Geschichten, die in dieser Arbeit präsentiert werden, sowohl sachlich (was ist in der Weltgeschichte passiert?) als auch emotional-betroffen (wie würde ich dies erleben, fühlen, bewerten?) zu lesen. Ich möchte eine/n forschende/n und selbst betroffene/n Lesende/n ansprechen, durch die Geschichten und meine Reflexionen über diese, was Interpretationen, Ergebnisse und Erkenntnisse auf wissenschaftlichem Niveau im Besonderen sind, über ihr/sein Leben, das Miteinander in Deutschland und der Welt nachzudenken. Wenn selbst ein kleiner Gedanke des „Ach-so-könnte-man-es-auch-Sehen“ entsteht, dann ist mein Ziel erreicht, welches ich mit dieser Monografie verfolgt habe.
Sicherlich gehört hierzu auch das große Teilziel, meine Promotion an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz erfolgreich abzuschließen, doch haben mich die Jahre abwechselnd zu arbeiten und zu forschen gelehrt, dass nur ein höheres Ziel zum Gelingen solch einer Forschung über Umbrüche führen kann: das eigene Leben mit all seinen Facetten weiterzugehen, sich mit Vertrauten und Andersdenkenden auszutauschen sowie selbst Umbrüche zu erleben. Wie meine Interviewperson Frau2 Markgraf3 treffend gesagt hat: „Das Leben ist auch eine Schule“ (R. Markgraf 2013, 03:08:00–03:08:03/1)4. So war es für mich ebenfalls eine, nach der abgegebenen Doktorarbeit in den Gutachten meiner Professoren zu lesen und in der Disputation mit meinen Prüfern/meiner Prüferin zu hören, wie sie meine Arbeit verstanden haben.
Eine wertvolle Erkenntnis hieraus möchte ich dem weiteren Lesen der Arbeit vorausschicken, dass erst, wenn man bereit ist, über seine erlebten Umbrüche zu reden, auch diese weitererzählt werden können. Demnach sind die Erzählungen in dieser Doktorarbeit von Personen, die bereit waren, über sich und ihre Vergangenheit nachzudenken. Sie hatten ein Interesse, sei es für die Familie oder um etwas aufzuarbeiten, warum sie sich zu einem Interview bereit erklärt haben. Das lässt die folgenden Geschichten nicht nur anders lesen, sondern zeigt ebenso die Grenzen meiner Forschung auf: Was ist mit denjenigen, die nicht erzählen wollten (wie der Schwager meiner Interviewperson Herr H. Markgraf, vgl. Kap. V.3.2)? Die nach einem Umbruch nicht mehr auf die Beine gekommen sind (wie die mecklenburgische Familie meiner Interviewperson Julia, vgl. Kap. V.1.3)? Und die keine Aussprache mehr in der Familie haben, wodurch ich sie nicht erreichen konnte, da mein Zugang über das Verhältnis zwischen den Generationen bestimmt war (wie die Ex-Ehefrau meiner Interviewperson Herr Pätzold, vgl. Kap. V.4.3)?
Abbildung 1: Meine Feldforschung
Hierauf können zwar die folgenden Seiten keine bis kaum Antworten geben, aber die Möglichkeit, diese Grenzen gedanklich zu überwinden, indem der/die Lesende diese als Fragen im Hinterkopf behält. Vielleicht kann die Abbildung 1, die im Zusammenhang mit meiner Disputation entstanden ist, hierbei helfen. Sie verbildlicht, mit wem (Ostdeutsche), wie vielen (34 Personen aus 3 Generationen und 9 Familien), wo (vorwiegend in Ostdeutschland) und von wo aus (Mainz und Berlin bzw. Rand-Berlin) ich geforscht habe, aber auch, dass ich ausgewählte Personen (gebürtige Ostdeutsche), Familien (Drei-Generationen-Familien mit einem weitgehend intakten Kommunikationsverhältnis) und Orte (ehemaliges DDR-Gebiet, von meinen Lebensorten ausgehend) besucht und erforscht habe. Damit möchte ich verdeutlichen, dass eine Forschung nicht nur ein Prozess ist, sondern auch eine Konstruktion, d.h. eine einmalige Gesprächssituation mit einer festgelegten Untersuchungsgruppe schafft.
Das führt mich abschließend dazu, meinen Dank an die Personen auszusprechen, die an dieser Forschung zeitweilig bis jahrelang mitgewirkt haben: Als Erstes möchte ich den 34 Gesprächspersonen sowie den 3 Probelauf-Personen danken, die sich mit mir in stundenlangen Interviews mit ihrer persönlichen Vergangenheit auseinandergesetzt haben. Sie haben sich der schwierigen Aufgabe gestellt, nicht nur einer Fremden umfassende und mitunter intime Einblicke in ihr Leben zu gewähren, sondern auch einer Wissenschaftlerin, die die Daten veröffentlicht. Bei den an mich gerichteten Fragen während der Interviews konnte ich immer wieder feststellen, wie viel dazu gehört, sich in solch einem Rahmen zu äußern. Ich danke jedem Einzelnen von ihnen für die bewegenden, lehrreichen und ebenso heiteren Gespräche wie Zusammenkünfte. Ich freue mich, wenn gerade sie sich in diesem Werk wiederfinden. Ein besonderer Dank gebührt in diesem Kontext der Familie Markgraf, die mich 2012 motiviert hat, eine weitere Feldforschung vorzunehmen, und mir wiederholt mit Rat und Tat zur Seite stand.
Als Zweites gilt mein Dank meinem Doktorvater Universitätsprofessor Dr. Michael Simon, der mich im gesamten Forschungsprozess, angefangen von der Gestaltung des Themas bis zum Veröffentlichen der Arbeit, mit bereichernden Anregungen, konstruktiver Kritik und nützlichen Informationen versorgt hat. In stundenlangen Gesprächen habe ich immer wieder durch ihn neue Ansätze zu meinen zentralen Fragen finden können.
Als Drittes möchte ich in meiner Laudatio meine eigene Familie, insbesondere meine Mutter, Marina Claudia Lange, und meinen Ehemann, Robert Walter Grabsch, hervorheben. Sie haben mich beharrlich dazu ermutigt, sowohl meine Untersuchungsansätze beständig zu reflektieren als auch meinen Promotionsprozess abzuschließen. Ihre eigenen Erfahrungen in Ost- und Westdeutschland und unser offen-kritischer Austausch hat mir im Speziellen geholfen, schwierige Forschungsfragen zu beantworten, missverständliche Lebenswege meiner Interviewpersonen nachzuvollziehen und monokausale Erklärungen zu hinterfragen.
Und als Viertes danke ich den Korrektoren/-innen der Arbeit Marina Claudia Lange, Niels-Peter Strenge, Robert Walter Grabsch und Stephan Grefing, der Grafikdesignerin Vanessa Lahr für die Titelabbildung, der Kartografin Angelia Gneckow für die Abbildung 1 sowie meinem Verlag, der der vorliegenden Publikation ihren letzten Schliff verliehen hat.
Löbau, im Februar 2022 Manuela Maria Grabsch
1 Gemäß einer verantwortungsvollen Sprache bevorzuge ich innerhalb der gesamten Arbeit geschlechtsneutrale Bezeichnungen (Forschende statt Forscher/Forscherin). Sofern das nicht möglich oder notwendig ist, nenne ich die geschlechtsspezifischen Endsilben markiert durch einen Schrägstrich (von Mitschülern/-innen) sowie das geschlechtsspezifische Substantiv bei Einzelpersonen (der Ingenieur H. Markgraf). Zitate von Forschenden und Interviewpersonen werden nicht gendergerecht verändert.
2 Die Nennform der Interviewpersonen entspricht der Beziehung, die ich zum Zeitpunkt des Schreibens der Monografie zu ihnen hatte. Der Vorname steht für ein Duzen und die Anredeform „Frau/Herr“ für ein Siezen. Sie drückt demnach die Beziehungsebene aus und ob sich diese im Laufe der Forschung verändert hat.
3 Alle in der Arbeit verwendeten Namen meiner Interviewpersonen sind Pseudonyme (vgl. Anh. 7).
4 Quellenangaben, die keinen...
| Erscheint lt. Verlag | 23.6.2022 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag: Politikwissenschaften |
| Verlagsort | Baden-Baden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung ► Allgemeines / Lexika |
| Schlagworte | Alltägliches Erzählen • Aufarbeitung der Geschichte • Besatzungszeit • Biografien • BRD • Bundesrepublik Deutschland • DDR • DDR-Zeit • Deutsche Demokratische Republik • Deutsche Geschichte • Drei-Generationen-Familien • Drittes Reich • Erinnerung • Erinnerungsarbeit • Erinnerungskultur • Familiengeschichte • Familienleben • Familienzusammenhalt • Heimat • Heimatverlust • Ilse Weinert • Kriegsende • Kulturgeschichte • Lebenserzählung • Lebensgeschichte • Lebenslauf • Lebensweg • NS-Zeit • NVA-Zeit • Ostdeutsche • Ostdeutschland • Ost- und Westteilung • politische Umbrüche • SBZ • Systemwechsel • Vergangenheitsbearbeitung • Vergangenheitsbewältigung • Weimarer Republik • Wende • Zeitgeschichte |
| ISBN-10 | 3-8288-7849-0 / 3828878490 |
| ISBN-13 | 978-3-8288-7849-5 / 9783828878495 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,4 MB
Kopierschutz: Adobe-DRM
Adobe-DRM ist ein Kopierschutz, der das eBook vor Mißbrauch schützen soll. Dabei wird das eBook bereits beim Download auf Ihre persönliche Adobe-ID autorisiert. Lesen können Sie das eBook dann nur auf den Geräten, welche ebenfalls auf Ihre Adobe-ID registriert sind.
Details zum Adobe-DRM
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen eine
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen eine
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich