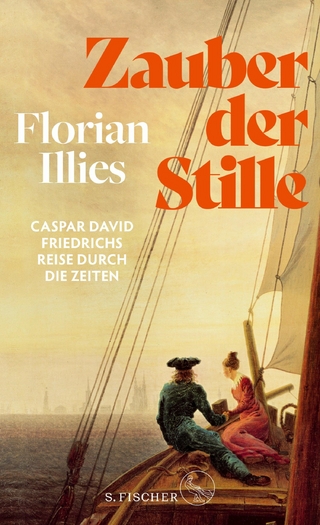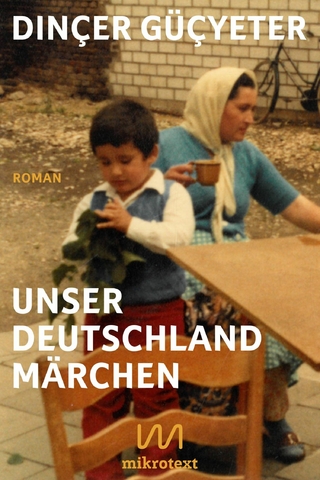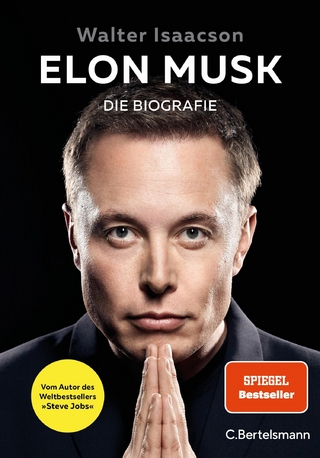Aufbruch ins Ungewisse (eBook)
464 Seiten
Deutsche Verlags-Anstalt
978-3-641-22515-5 (ISBN)
Er war das Gesicht des kritischen Journalismus und die Reizfigur der Mächtigen: Peter Merseburger blickt zurück auf sein Leben und lässt dabei die Geschichte der Bundesrepublik von den Anfängen in Trümmern bis zur Wiedervereinigung lebendig werden. Merseburgers Jahre als Leiter des Fernsehmagazins »Panorama« fielen in eine aufwühlende Zeit: Ostpolitik, RAF, Abtreibungsdiskussion. Seine scharfen Kommentare waren gefürchtet, er übte Kritik an den Regierenden in einer immer noch autoritätsfixierten Zeit. In seinen glänzend geschriebenen Erinnerungen erweist er sich einmal mehr als unabhängiger Kopf, dessen Leben geprägt ist von Aufbrüchen ins Ungewisse: sei es als Jugendlicher in der Sowjetischen Besatzungszone, der sich im Wahlkampf 1946 für die Ost-CDU engagiert und dafür ins Gefängnis wandert, als Korrespondent der ARD in vielen Hauptstädten oder am Ende seiner beruflichen Laufbahn, als er noch einmal einen Neuanfang wagt als Verfasser bedeutender Biographien.
Peter Merseburger (1928-2022) war Journalist bei verschiedenen Tageszeitungen, 1960 bis 1965 Redakteur und Korrespondent beim SPIEGEL, moderierte ab 1967 »Panorama«, wurde 1969 TV-Chefredakteur des NDR und leitete danach die ARD-Studios in Washington, London und Ost-Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher, darunter der Longseller »Mythos Weimar. Zwischen Geist und Macht«. Seine Biographie Willy Brandts wurde 2003 mit dem Deutschen Bücherpreis ausgezeichnet. Zuletzt erschien seine Autobiographie »Aufbruch ins Ungewisse. Erinnerungen eines politischen Zeitgenossen« (2021).
I
Eine Kapitulation als Geburtstagsgeschenk
Der Duft reifer Himbeeren und Aprikosen in Großvaters Garten, die sich an hohen Gestellen am Hang zum Mühlgraben ranken, der Rauch der Kartoffelfeuer bei der Ernte auf den Feldern, die süßlichen Schwaden, die im Herbst durch die Stadt wabern, wenn die Zuckerfabrik die ersten Rüben verarbeitet – es sind Düfte, Gerüche, Aromen, die Erinnerungen lebendig werden lassen. Da ist der schweflig riechende Dunst der umliegenden Brikettfabriken, der die Stadt einhüllt, wenn der Wind entsprechend steht, da ist der stinkende Holzvergaser, der mangels Benzin selbst einen kleinen Lastkraftwagen nur mit Mühe die sanft ansteigende Straße neben der Drahtseilbahn nach oben hieven kann.
Alltäglich und aller Politik bar etwa der durchdringende Geruch der schwarzen Farbe, mit der mein Vater abends seinen Holzschnitt walzt, um – unter den Augen seines neugierigen Knaben – das Ergebnis auf Japanpapier zu überprüfen; alltäglich auch die Abgase aus Tausenden Heizöfen, die mit Braunkohlebriketts betrieben werden und die er viele Jahrzehnte später als DDR-Korrespondent als die typische Duftnote des realen Sozialismus wiederentdecken wird. In der Erinnerung geradezu lieblich die Wolke aus gutem, nicht aus Braunkohlenteer gewonnenem Benzin und aus dem Rauch der süßlichen Virginia, den die einziehenden Amerikaner über die Stadt legen. Und welch ein Absturz, als mit der Ankunft der russischen Panjewagen, auf denen sich die Betten türmten und an denen meist Kanonen hingen, auf die amerikanischen Virginia-Nebel der kokelige Dunst von Machorka-Tabak, gewickelt in Zeitungspapier, folgt. Die Beispiele zeigen, je deutlicher die Erinnerungen, desto politischer ihr Charakter.
Geboren im Mai 1928, gehöre ich ja zu jenen Jahrgängen, die durch die Ereignisse nahezu zwangspolitisiert wurden – unmerklich zunächst und Schritt für Schritt, bald aber unentrinnbar, wie der Rückblick zeigen wird. Auch wenn diese Kindheit zunächst eine frohe und unbeschwerte war, vielleicht auch eine zu behütete, hat selbst meine früheste Erinnerung schon mit Politik zu tun: Ich gehe an der Hand meiner Mutter die Straße hinunter auf das kleine Stadtzentrum zu, als sie plötzlich auf dem Absatz kehrtmacht und eine Nebengasse wählt, weil auf der Kreuzung, die wir nach links hätten überqueren müssen, Demonstranten mit verschiedenen Fahnen in eine Prügelei verwickelt sind. Da nach den Wahlen 1933 und dem folgenden Verbot anderer Parteien nur Hakenkreuz-Aufmärsche geduldet wurden, muss dies wohl im letzten Jahr der Weimarer Republik gewesen sein, als ich gerade einmal vier Jahre alt war.
In der Tat standen sich damals in der Industriestadt Zeitz zwei nahezu gleich starke rechte und linke Lager gegenüber – die Linke gespalten in Sozialdemokraten und Kommunisten, im rechten Lager waren die Nationalsozialisten vor den Deutschnationalen spätestens seit 1930 die bei Weitem stärkste Partei. Aber die Linke hatte in Zeitz und Umgebung traditionelle Wurzeln – schon zu Kaisers Zeiten war der Wahlkreis Naumburg/Weißenfels/Zeitz mit seinen Brikettfabriken, Braunkohletagebauen und seinem hohen Anteil von Industriearbeitern durch einen Sozialdemokraten im Reichstag vertreten. Da es damals ein Mehrheitswahlrecht ähnlich dem jetzigen der Franzosen gab, verdankte er seinen Sieg in der Stichwahl einer – heute würden wir sagen: sozialliberalen – Allianz der SPD mit der Fortschrittlichen Volkspartei. Und wenn ich »unmerklich zwangspolitisiert« schrieb, denke ich auch an Bilder aus den damaligen Kino-Wochenschauen – etwa an die Reportage vom Staatsbegräbnis eines im Text zum mythischen Helden stilisierten Feldmarschalls Paul von Hindenburg, der im Tannenberg-Denkmal, einem an die Deutschordensritter gemahnenden turmbewehrten Festungsbau, im August 1934 mit militärisch-nationalem Pomp in Ostpreußen beigesetzt wurde. Ich habe die Bilder, wenn auch vage, noch heute vor Augen.
Zeitz, im südlichsten Zipfel Sachsen-Anhalts, einem der ärmsten Bundesländer, kämpft heute mit den Folgen der Deindustrialisierung nach der Wende, mit Abwanderung, Arbeitslosigkeit und traurigem Verfall seiner Altstadt. Das Zeitz meiner Jugend dagegen war eine intakte mittlere Industriestadt mit 35 000 Einwohnern, weithin bekannt als Geburtsstätte des Kinderwagens, der dort von einem Stellmacher namens Ernst Albert Naether erstmals gebaut, weiterentwickelt und, von seinen Söhnen zum Exportschlager gemacht, in alle Welt verkauft worden war. Es gab eine Eisengießerei, eine Zuckerfabrik, mehrere Pianofabriken und Buchdruckereien, dazu eine Reihe mittlerer und kleiner Betriebe, die Werkzeugmaschinen, Schokoladenartikel, Textilien oder Schuhe produzierten.
Kennern der DDR-Geschichte mag die Stadt vor allem als der Ort bekannt sein, an dem Pfarrer Oskar Brüsewitz im August 1976 mit seiner Selbstverbrennung vor der Michaeliskirche ein Fanal gegen die Repression in der DDR setzen wollte – eines, das Erich Honecker, der »Mann mit dem Strohhut« (Klaus Bölling), einmal als einen »der größten konterrevolutionären Akte gegen die DDR« bezeichnet haben soll. Märtyrer Brüsewitz, der eine Milchkanne voll Benzin über sich ausgegossen hatte, verbrannte sich vor jener altehrwürdigen Kirche, deren Fundamente aus der Mitte des 12. Jahrhunderts stammen und in der ich getauft und später konfirmiert worden war.
Als Bistum 968 gegründet, um – wie die gleichzeitig ins Leben gerufenen Bistümer Meißen und Merseburg – die Christianisierung der unterworfenen Slawen voranzutreiben, verfügt Zeitz noch heute über stolze Zeugen seiner gut 1200-jährigen Geschichte – barocke Bürgerhäuser mit prächtigen Portalen und ein gotisches Rathaus mit seltenem Giebel, wie er ähnlich nur in Breslau zu finden war. Mein Vater, Grafiker und Heimatkünstler, hat ihn wie andere historische Zeugen der Zeitzer Vergangenheit, seien dies nun romantische Winkel oder mittelalterliche Wehrtürme an verbliebenen Resten der Stadtmauer, gleich mehrfach in Holz gestochen oder auf Lithografien gebannt. Ihm verdanke ich einen Sinn für historische Abläufe, das Wissen um die Stile und die Gedankenwelten früherer Epochen, wahrscheinlich auch jene Portion Einfühlungsvermögen, über die ein Journalist trotz eines kritischen Blicks immer verfügen sollte. Er war ein durch und durch musischer Mensch, dem eine Ausbildung an der Kunstakademie versagt geblieben war, denn sein Vater, der Anteileigner einer Druckerei gewesen war, starb früh und hinterließ wenig. Weil mein Vater weder mit seiner Kunst noch mit seiner Gebrauchsgrafik eine Familie unterhalten konnte, verdingte er sich zunächst als Postbeamter und machte sich erst spät selbstständig.
Er war ein eher weicher Charakter, ganz im Gegensatz zu meiner Mutter, einer energischen Person par excellence, die liebevoll-autoritär den Ton im Hause angab. Als nach dem Einmarsch der Russen unsere Sechszimmerwohnung requiriert wurde und wir sie binnen eines halben Tages räumen mussten, verstaute sie alle Wertsachen – Tafelsilber, kostbare Vasen, Bilder, Tischlampen und natürlich das in jedem gutbürgerlichen Haushalt damals obligate »gute Meissener Porzellan« mitsamt den seinerzeit nicht minder geschätzten hochstieligen bunten kristallenen Weingläsern, Römer genannt – in einem kleineren Zimmer, schloss es ab, stellte sich ebenso trotzig wie mutig vor die Tür und erklärte: »Niemand betritt diesen Raum.« Ich stand dabei und hielt den Atem an – würde das gut gehen, sich dem Vertreter der siegreichen Besatzungsmacht so entschieden entgegenzustellen? Doch der Deutsch radebrechende russische Offizier, an dessen Ehre und Anstand hier appelliert wurde, versprach, das Zimmer nicht zu öffnen. Mutter zog den Schlüssel ab, und als die Wohnung einige Wochen später freigegeben wurde, fand sie die Tür unaufgebrochen und ihre im Zimmer gestapelten Wertsachen unberührt vor. In der Wohnung hatten die Russen keinen größeren Schaden angerichtet, nur die hölzerne Platte auf dem Balkontisch war von Axthieben übersät und roch intensiv nach Hammel. Die siegreichen Rotarmisten hatten hier offenbar Zicklein und Schafe für ihre Mahlzeiten zerlegt.
Rückblickend will mir scheinen, meine drei Jahre ältere Schwester Hella und ich seien Produkte einer klassischen Mesalliance gewesen. Denn Mutter kam aus einer höchst betuchten Familie, war wie so manche »höhere Tochter« vor dem Ersten Weltkrieg nach Lausanne ins Pensionat geschickt worden, um Französisch parlieren zu lernen, danach kam sie in ein Pensionat in Wiesbaden, in dem vorwiegend Englisch gesprochen wurde. Die Rittergutsbesitzer, mit denen ihr Vater sie verheiraten wollte, lehnte sie verächtlich ab und tat sich lieber mit einem armen Künstler zusammen. Nicht zufällig lag eine alte Ausgabe des Zupfgeigenhansel – das Liederbuch der Jugendbewegung – obenauf in dem Schrank, in dem die Zeichnungen und Holzschnitte verwahrt wurden, die Vater abends bis spät in die Nacht anfertigte. Immer wieder von Lokalzeitungen veröffentlicht und von Buchhandlungen vertrieben, hatte er sich damit in der kleinen Stadt einen Namen gemacht.
Vater und Mutter lernten sich beim Wandervogel kennen, und ihre jugendbewegte Liebe zur Natur wurde uns Kindern förmlich eingetrichtert – im gemieteten Garten oder bei sonntäglichen Fahrradausflügen in den Forst oder an die Saale mit ihren Burgen am – leider nur im...
| Erscheint lt. Verlag | 8.2.2021 |
|---|---|
| Zusatzinfo | mit Abbildungen |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | ARD-Korrespondent • Autobiographie • Biografie • Biographien • Der Spiegel • eBooks • Generation Flakhelfer • Geschichte der Bundesrepublik • Journalistenleben • London • Merseburger verstorben • Ost-Berlin • »Panorama« • Panorama Moderator • Washington |
| ISBN-10 | 3-641-22515-9 / 3641225159 |
| ISBN-13 | 978-3-641-22515-5 / 9783641225155 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 14,0 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich