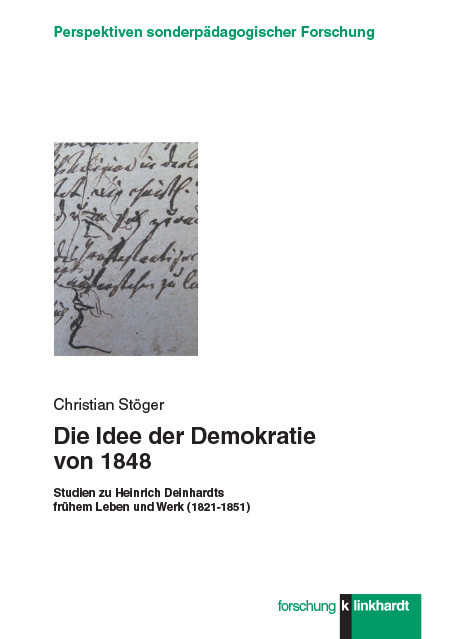
Die Idee der Demokratie von 1848 (eBook)
512 Seiten
Verlag Julius Klinkhardt
978-3-7815-5596-9 (ISBN)
Vorliegende Studien skizzieren Deinhardt deshalb erst biographisch als Oppositionellen des Vormärz und zeichnen sein revolutionäres Engagement auf dem linken Flügel der 1848er-Demokratie nach.
Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt jedoch auf seinen demokratietheoretischen Schriften: Anhand von ca. 150 anonymen bzw. pseudonymen Publikationen wird Deinhardts Idee der Demokratie entfaltet, d.h. sein in Hegels Geschichtsphilosophie verankerter und gesellschaftstheoretisch, politisch, ökonomisch und pädagogisch reflektierter Entwurf einer demokratischen Gesellschaft rekonstruiert.
Die Studien verstehen sich als Vorbereitung zur historiographischen Erschließung des Erziehungsexperiments der Levana (1856 1866), an dem Deinhardt ein Jahrzehnt nach der Revolution beteiligt war.
Die Deinhardt-Studien ermöglichen die Klärung der alten sonderpädagogischen Streitfrage, wer die Theorieschriften der Levana, allen voran die grundlegende Heilpädagogik (1861/63), verfasst hat: Deinhardt allein – und nicht der zum „Nestor der deutschen Heilpädagogik“ erklärte Anstaltsgründer Georgens – zeichnet für das komplexe gesellschaftliche und pädagogische Reflexionsniveau der Schriften verantwortlich.
Christian Stöger: Die Idee der Demokratie von 1848 1
Titelei 4
Impressum 5
Inhaltsverzeichnis 6
Vorwort 10
Einleitung 12
1. Levana-Forschung 20
2. Georgens-Forschung 48
3. Deinhardt-Forschung 77
Erstes Kapitel: Bildungsweg und Politisierung 96
1. Die frühen Jahre von 1821–1840 96
2. Die Universitätsjahre (1840-1845) 102
Zweites Kapitel: Der oppositionelle Journalist (1844–1847) 130
1. Der Übergang vom Studenten zum oppositionellen Literaten 130
2. Deinhardt als „Demokrat“ im Vormärz 141
3. Die demokratische Tendenz der Gegenwart 154
4. Deinhardts demokratischer Nationalismus 167
Drittes Kapitel: Revolutionärer Aufbruch 1848 182
1. Die „Basisrevolution“ vom März 1848 182
2. Deinhardt und die Spaltung des bürgerlichen Lagers in Weimar 191
3. Demokratische Volksversammlungen 199
4. Die Septemberkrise und ihre Folgen 208
Viertes Kapitel: Die Niederlage der Revolution 1849 220
1. Nach der Haft bis zum Jahresende 1848 220
2. Kommentare zur Entstehung der Reichsverfassung 226
3. Die Reichsverfassungskampagne 234
4. Die Bekämpfung des preußischen Unionsprojekts 248
5. Beginnende Reaktion in Weimar 255
Fünftes Kapitel: Die Verarbeitung der Revolutionsniederlage 260
1. Deinhardts Resümee des Revolutionsverlaufs 261
2. Zur dialektischen Deutung der Niederlage 268
3. Selbstkritik der Demokratie 275
Sechstes Kapitel: Geschichtsphilosophie und Demokratie 286
1. Deinhardts Demokratiebegriff 287
2. Freie Gemeinschaft und die Herausforderung des Individualismus 297
Siebtes Kapitel: Das politische Ideal der Demokratie 326
1. Volkssouveränität 326
2. Deinhardts Repräsentativsystem 336
3. Die Aufhebung der „Massenhaftigkeit“ des Volks 344
Achtes Kapitel: Demokratie und Soziale Frage 362
1. Deinhardt und die Pauperismusdiskussion 362
2. Deinhardts Proletariatsbegriff 377
Neuntes Kapitel: Wirtschaftliche Reform und Nationalismus 392
1. Die demokratische Wirtschaftswende 392
2. Deinhardts Wirtschaftsnationalismus 401
Zehntes Kapitel: Zum „pädagogischen“ Deinhardt von 1848 412
1. Demokratischer Entwurf und Erziehung 412
2. Demokratische Schulpädagogik 429
3. Bemerkungen zu den Jahren des Nachmärz 443
Die Vermittlung einer Bekanntschaft 446
Deinhardts Biographie 446
Deinhardts Theorie der Demokratie 456
Suchprofil für den Autor der Theoriebildung der Levana 475
Deinhardt-Bibliographie von 1844–1851 480
Archivalien 487
Gedruckte Quellen und ältere Darstellungen 489
Darstellungen 492
Abkürzungen und Hinweise zur Zitation 500
Anhang 501
1. Heinrich Deinhardt: Handschriftliche Notate: „Aufgabe der Jetztzeit“ 501
2. Heinrich Deinhardt: Konstitution der Hallischen Burschenschaft 501
3. Briefe Emil Anhalts an Heinrich Deinhardt (Sommer 1844–Feber 1845) 504
4. Heinrich Deinhardt: Vorschlag zu einem Programm des demokratischen Vereins in Weimar 512
Rückumschlag 514
Erstes Kapitel Bildungsweg und Politisierung (S. 95-96)
1. Die frühen Jahre von 1821–1840
a.) Beginn der Schullaufbahn
Nachrufe seiner Wiener Freunde setzen überwiegend so ein: „Heinrich Marianus Deinhardt ist geboren im Jahre 1821. Seine Wiege stand in einem Bauernhause zu Niederzimmern, einem Dorfe etwa 3 Stunden von Weimar entfernt. “ Die in der Erinnerungsliteratur zu findende Hervorhebung von Deinhardts bäuerlicher Herkunft ist einer literarischen Inszenierungsabsicht geschuldet, die den Topos des armen, sein Herkunftsmilieu durch hervorstechende Begabung hinter sich lassenden Bauernjungen bemüht. Was ihm die Möglichkeit zu gymnasialer und universitärer Bildung geebnet hat, bleibt so offen. Dazu gibt Deinhardt selbst in einer kurzen handschriftlichen Autobiographie Auskunft. Mit seinen Hinweisen können dem bäuerlichen Hintergrund der Kindheitsjahre ein bildungsbürgerliches Milieu für die Jugendzeit an die Seite gestellt und daran anknüpfend zwei, für Deinhardt prägende Einflüsse identifiziert werden: Die Philosophie Hegels und der deutsche Nationalismus, was im Lauf der weiteren Ausführungen gezeigt wird.
Während Deinhardt den sozialen Standort seiner Familie in seiner Autographie unerwähnt lässt, stellt er sich dagegen als jemand vor, der in seinen Jugendjahren weit herumgekommen ist: Zum Zeitpunkt der Reifeprüfung lagen bereits mehrjährige Aufenthalte in drei Staaten des Deutschen Bundes hinter ihm. Zieht man die Zeiträume, die er selbst angibt, zur Datierung heran, ergibt sich für seine Kindheit und Schullaufbahn folgendes Bild: Die ersten 13 Lebensjahre verbringt er in Niederzimmern, besucht die Dorfschule, ehe er von Ostern 1834 an auf den Besuch des Gymnasiums vorbereitet wird. Ab Herbst des gleichen Jahres ist Deinhardt für zweieinhalb Jahre Schüler des Wittenberger Gymnasiums, wechselt zu Ostern 1837 aber für zwei Jahre an die Gelehrtenschule in Friedland im damaligen Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz. Nach zweijährigem Aufenthalt kehrt er mit Ostern 1839 nach Weimar zurück und schließt dort im Herbst 1840 seine Gymnasialzeit mit der Reifeprüfung ab. Der Weichensteller dieser erstaunlichen Bildungslaufbahn ist sein Onkel Johann Heinrich Deinhardt (1805–1867), der den Neffen 1834 zu sich nimmt und den Besuch des Wittenberger Gymnasiums ermöglicht. Auf ihn lässt sich die biographische Erzählfigur des sozialen Aufsteigers wohl überzeugender einsetzen als auf den Neffen: Johann Heinrich Deinhardt absolvierte – nach der Predigerschule und dem Gymnasium in Erfurt – von 1825–1828 das Studium der Schulwissenschaften an der Berliner Universität, studierte neben Mathematik, Naturwissenschaften (u. a. bei Ohm), Philologie und besonders: Philosophie bei Hegel. Und als wichtigen Vertreter hegelianischer Pädagogik nahmen ihn die Nachschlagewerke des 19. Jahrhunderts auf5, wie er seinen Zeitgenossen überhaupt als „einer der bedeutendsten deutschen Schulmänner“ galt. Im Jahr 1834, als Deinhardt bei seinem Onkel einzieht, ist dieser allerdings noch unbekannt und unterrichtet als Oberlehrer Mathematik und Physik am Wittenberger Gymnasium. Johann Heinrich Deinhardts Karriere nimmt einen rasanten Aufschwung, als er sich mit seinem Werk „Der Gymnasialunterricht nach den wissenschaftlichen Anforderungen der jetzigen Zeit“ in die zeitgenössische Schuldiskussion, besonders in die sogenannte Lorinser-Debatte einbringt. Er antwortet auf den Vorwurf, der Gymnasialunterricht gefährde die körperliche wie geistige Gesundheit der Schüler, mit einer hegelianischen Neubegründung des preußischen Gymnasiums.
| Erscheint lt. Verlag | 20.9.2017 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Pädagogik |
| ISBN-10 | 3-7815-5596-8 / 3781555968 |
| ISBN-13 | 978-3-7815-5596-9 / 9783781555969 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 7,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich


