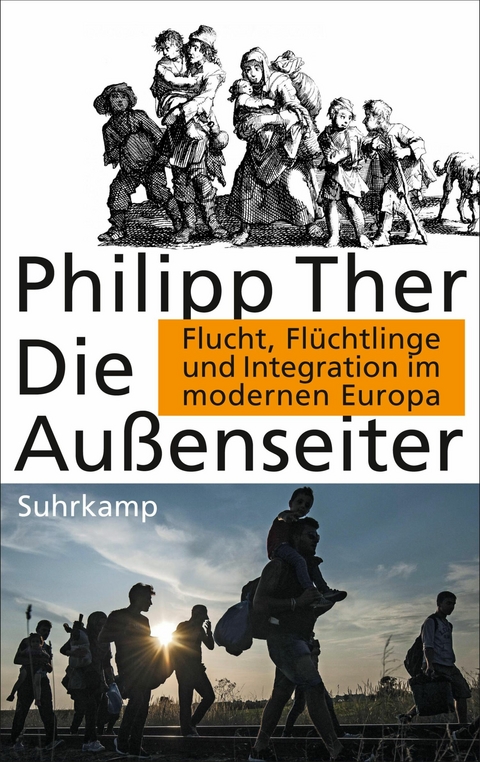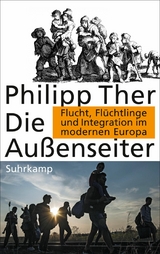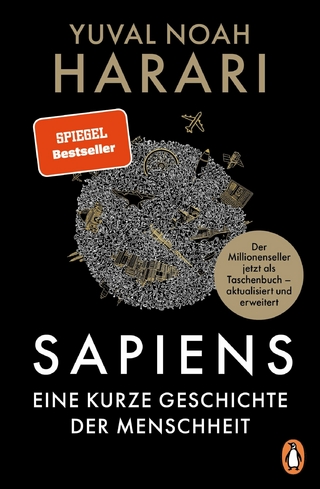Die Außenseiter (eBook)
436 Seiten
Suhrkamp Verlag
978-3-518-75410-8 (ISBN)
Flucht und Integration gehören zu den beherrschenden Themen der Gegenwart. Sie sind ein maßgeblicher Grund für den Aufstieg rechtspopulistischer Parteien und drohen, die EU zu spalten. Ein Blick in die Tiefen der Geschichte relativiert allerdings die »Flüchtlingskrise« des Jahres 2015. Seit 1492 die sephardischen Juden von der iberischen Halbinsel vertrieben wurden, ist Europa immer ein Kontinent der Flüchtlinge gewesen.
Philipp Ther geht den Gründen der Flucht nach: religiöser Intoleranz, radikalem Nationalismus und politischer Verfolgung. Anhand von Lebensgeschichten veranschaulicht er die Not auf der Flucht, identifiziert Faktoren für gelingende Integration und erörtert das wiederholte Versagen der internationalen Politik sowie die Lehren, die daraus etwa in der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 gezogen wurden. Der Humanitarismus ist, wie Ther zeigt, in der Flüchtlingspolitik stets brüchig gewesen. Doch auch wenn heute einmal mehr die Angst vor einem Scheitern der Integration dominiert, haben die Zielländer fast immer von der Aufnahme von Flüchtlingen profitiert. Das belegt insbesondere die deutsche Nachkriegsgeschichte, als gerade die junge Bundesrepublik zu einem Flüchtlingsland wurde.
<p>Philipp Ther, geboren 1967, ist ein deutscher Sozial- und Kulturhistoriker. Nach Stationen u. a. an der FU Berlin, der Viadrina in Frankfurt/Oder, an der Harvard University und am European University Institute in Florenz ist er seit 2010 Professor am Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien. Seine Bücher <em>Die dunkle Seite der Nationalstaaten. »Ethnische Säuberungen« im modernen Europa</em> (2011), <em>Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent. Eine Geschichte des neoliberalen Europa</em> (2014) und <em>Die Außenseiter. Flucht, Flüchtlinge und Integration im modernen Europa</em> (2017) wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet, <em>Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent</em> u. a. mit dem Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse 2015. 2019 erhielt Philipp Ther den Wittgenstein-Preis, den höchstdotierten Wissenschaftspreis Österreichs.</p>
Philipp Ther, geboren 1967, ist Professor am Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien. Ther war zuvor unter anderem John F. Kennedy Fellow an der Harvard University und Professor am European University Institute in Florenz. Sein Buch Ethnische Säuberungen im modernen Europa wurde 2012 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt.
Erster Teil
Religiöse Konflikte und Glaubensflüchtlinge
Erzählungen über Flucht und Flüchtlinge durchziehen bereits das Alte Testament. In den Berichten über die Abwanderung Abrahams aus Kanaan, den Auszug der Israeliten aus Ägypten, das babylonischen Exil und über etliche andere Episoden wurden historische Fluchterfahrungen verarbeitet. Das Neue Testament steht dem nicht nach, Maria und Josef fliehen vor den Häschern des Herodes, erst nach dessen Tod können sie in ihre Heimat in Galiläa zurückkehren.
Die biblischen Texte enthalten bereits alle wichtigen Fluchtmotive: existenzielle Not, ethnische Konflikte, religiöse und politische Verfolgung. Die in der Bibel beschriebene Aufnahme von Flüchtlingen ist einerseits von einem ethischen Imperativ getragen, der auch die »Willkommenskultur« des Jahres 2015 geprägt hat. Andererseits verweist die Bibel auf leere, kaum bewohnte Landstriche, in denen sich Flüchtlinge niederlassen konnten. Diese Voraussetzungen waren auch weit später in der europäischen Geschichte vorhanden, man könnte sogar behaupten, in mancher Hinsicht bis heute. Aufgrund des Einfallens der Mongolen im 13. Jahrhundert, der Pestepidemien ab 1347 und der Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges wurden weite Teile Europas immer wieder entvölkert. Eine Anhebung der Einwohnerzahl und der Landesausbau durch Besiedlung gehörten daher zu den Kernpunkten staatlicher Entwicklungspolitik. Die absolutistischen Monarchien der Frühen Neuzeit sahen Flüchtlinge und andere Zuwanderer in der Regel als eine Bereicherung an, nicht als Last oder Bedrohung. Sie erwarteten eine Steigerung der Wirtschaftskraft und warben deshalb sogar aktiv um jüdische, protestantische und andere Flüchtlinge.
Das Jahr 1492, das in globalhistorischer Perspektive als Beginn der Neuzeit bzw. der modernen Geschichte Europas gilt, eignet sich auch deshalb als Ausgangspunkt einer Synthese über massenhafte Flucht, weil diese Zeitenwende genau damit begann. Während Christoph Kolumbus Amerika »entdeckte«,1 eroberten spanische Truppen im Zuge der Reconquista das letzte muslimisch regierte Königreich auf der Iberischen Halbinsel. Die Kapitulationsverträge sicherten den Muslimen in Granada zwar freie Religionsausübung zu, doch die neuen Landesherren übten entgegen den Vereinbarungen massiven Druck zur Konversion aus. Die bedrängten Muslime reagierten 1499 mit einem Aufstand, der in den Bergen der Sierra Nevada erst nach zwei Jahren und mit rücksichtsloser Kriegsführung unter Kontrolle gebracht werden konnte. Die Regierung, vor allem die Inquisitionsbehörde, ging daraufhin noch härter gegen die muslimische Minderheit vor und erließ eine Vorschrift zur kollektiven Zwangstaufe. Tausende Muslime, die sich nicht bekehren lassen wollten, flohen nach Marokko oder ließen sich in der Küstenregion um Valencia nieder, wo vorerst weniger strenge Gesetze galten.2 Kaiser Karl V. schloss diese Gesetzeslücke und dehnte die Zwangskonversion zwischen 1523 und 1526 auf sämtliche Landesteile Spaniens aus. Diese antiislamische Politik geht vor allem auf die Bigotterie des Hauses Kastilien und der Habsburger sowie die Selbstradikalisierung der Inquisition zurück. Es gab ferner einen außenpolitischen Zusammenhang, denn das Osmanische Reich eroberte in diesen Jahren Ungarn und expandierte im westlichen Mittelmeerraum nach Algerien. Die Furcht vor einer fünften Kolonne und einem osmanischen Einmarsch in Spanien war daher das gesamte 16. Jahrhundert hindurch nicht völlig unbegründet.
Selbst die Konversion verschaffte den Nachfahren der spanischen Mauren, den sogenannten Moriscos, keine Ruhe. Nach einem weiteren Aufstand in den Jahren 1568-70 mussten sie das frühere Königreich Granada ausnahmslos verlassen.3 Die Niederschlagung des Aufstands war erneut von großer Grausamkeit begleitet, so ließ Don Juan de Austria, bald darauf der Sieger der Seeschlacht von Lepanto, nach der Belagerung und Kapitulation der andalusischen Stadt Galera rund vierhundert Frauen und Kinder töten. König Philipp II. nahm bei der Verfolgung der Muslime auch wirtschaftlich keine Rücksichten. Obwohl die massenhafte Flucht zum Zusammenbruch des über Jahrhunderte aufgebauten Bewässerungssystems und zu einer Schwächung von Handel und Gewerbe führte, setzte der König die Verfolgung der Muslime und der Moriscos fort. Sein Nachfolger Philipp III. erließ dann 1609/10 Ausweisungsdekrete für alle in Spanien verbliebenen Moriscos. Wie viele Menschen insgesamt fliehen mussten, lässt sich nicht genau beziffern, weil ihre Flucht meist über mehrere Etappen und Generationen erfolgte.4 Die etwa 300 000 Muslime im Königreich Granada sowie die zahlreichen muslimischen Gemeinden an der valencianischen Küste wurden jedenfalls im Zuge von mehr als einhundert Jahren religiöser Verfolgung vollständig vertrieben.
Wie häufig in der Geschichte von Flucht und Vertreibung ging der Staat nicht nur gegen eine, sondern gegen mehrere Minderheiten gleichzeitig vor. Die spanischen Juden hatten keinerlei Verbindungen zu einer bedrohlichen Großmacht, sie waren niemals Kriegsgegner gewesen, doch die Kirche sah sie als Bedrohung im Inneren an. Kurz vor der Eroberung Granadas inszenierte die Inquisition in Andalusien einen Ritualmordprozess, bei dem der Hauptbeschuldigte, ein konvertierter jüdischer Kaufmann, unter Folter die Schändung von Hostien und die Ermordung christlicher Kinder gestand. Er endete auf dem Scheiterhaufen, aufgepeitschte Massen verübten in mehreren Städten Pogrome. Der spanische Staat und der Klerus stellten die Juden daraufhin vor die Alternative Zwangstaufe oder Exil. Etwa 200 000 Juden flohen 1492 und nach einer zweiten großen Verfolgungswelle 1513 aus Spanien nach Nordafrika, Italien, in die Niederlande und vor allem ins Osmanische Reich.5 Das Schicksal der portugiesischen Juden verlief auf ähnlichen Bahnen, sie mussten 1497 ihre Heimat verlassen, weil das spanische Königshaus der dynastischen Verbindung mit Portugal und der Verheiratung von Prinzessin Isabella mit König Manuel nur unter der Bedingung zustimmte, dass alle Juden aus dem Land geworfen würden.
Wie bei den Muslimen bot nicht einmal der Übertritt zum Katholizismus dauerhaften Schutz vor Verfolgung, denn nach dem Prinzip der »limpieza di sangre« (Reinheit des Blutes) wurde die Religionszugehörigkeit der konvertierten Marranen (der Name leitete sich im Spanischen etymologisch von Schweinen ab und war per se eine Erniedrigung) ähnlich wie bei den Moriscos in manchen Fällen über mehrere Generationen zurückverfolgt. Die Inquisition gehorchte hier im Prinzip einer ähnlichen Logik wie die radikalen Nationalisten des späten 19. Jahrhunderts, die ethnisch und rassisch definierte Abstammungskriterien einführten, um die Mitgliedschaft zu einer Nation zu bestimmen.
Während über das weitere Schicksal der muslimischen Flüchtlinge wenig bekannt ist – die meisten ließen sich im heutigen Marokko und in Algerien nieder –, weiß man über die Sepharden deutlich mehr. Die spanischen und portugiesischen Juden wurden über ganz Europa und seine mediterranen Nachbarräume verstreut (vgl. dazu Karte 1). Einige von ihnen verfügten als Kaufleute bereits über Verbindungen nach Genua, Pisa, Livorno, Venedig und Amsterdam, der größte Teil folgte jedoch einer Einladung des osmanischen Sultans und siedelte sich in Istanbul, Saloniki, Sarajevo, Izmir und anderen Städten des Osmanischen Reiches an. Ähnlich wie im frühneuzeitlichen Polen und Preußen lag das Interesse der Osmanen in einer Mehrung ihrer Untertanen nach dem kriegsbedingten Bevölkerungsrückgang wegen der verlustreichen Eroberung Konstantinopels und des Balkans.6 Demgegenüber war die Konfession der neuen Untertanen zweitrangig, weshalb Istanbul auch nach 1453 eine mehrheitlich christliche Stadt blieb.
Karte 1: Fluchtrouten der sephardischen Juden aus Spanien und Portugal nach 1492
Die Sepharden durften im Osmanischen Reich weiterhin ihren Glauben ausüben sowie Schulen und eigene Gerichte betreiben – das war der Kern des sogenannten Millets.7 Diese sehr weit gehende, nicht territoriale, sondern auf Gruppen bezogene Autonomie war möglich, weil die Regierung noch nicht so nahe an die Bürger heranrückte wie ein moderner Staat. Die Osmanen verlangten von den Sepharden – und analog dazu von ihren christlichen Untertanen – lediglich, dass sie ihre Steuern zahlten und sich allgemein loyal verhielten. Die Gruppenautonomie, die vom 15. bis ins 18. Jahrhundert ganz gut funktionierte, schwächte jedoch auf die Dauer das Osmanische Reich, das sich seit dem Zeitalter des Absolutismus einer verschärften Konkurrenz seitens anderer Mächte ausgesetzt sah. Das hatte mehrere, zunächst einmal wirtschaftliche und machtpolitische Gründe; durch die Expansion Europas nach Übersee verlagerte sich der Schwerpunkt der Weltwirtschaft nach Westen, außerdem rückten England und Frankreich durch den Kolonialismus im 19. Jahrhundert in Korfu und Ägypten ebenso an das Osmanische Reich heran wie das Russische Reich von Norden her.
Die anderen europäischen Imperien gewannen auch deshalb die Oberhand, weil sie sich reformierten, die Verwaltung zentralisierten, auf dem gesamten Staatsgebiet Steuern eintrieben und ihre Wirtschaft durch den Merkantilismus stärkten. Nicht zuletzt aufgrund der verheerenden Niederlagen gegen Russland versuchte das Osmanische Reich, an diese Entwicklung anzuschließen. Die Modernisierung der Verwaltung gelang jedoch auch in der Ära der Tansimat-Reformen im mittleren Drittel des 19. Jahrhunderts nur bedingt, weil hohe Staatsämter nach wie vor verkauft wurden und die...
| Erscheint lt. Verlag | 11.10.2017 |
|---|---|
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte | |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | AfD • bamf • Bestseller • Bestseller bücher • Bestsellerliste • buch bestseller • bücher neuerscheinungen • EU • EU Europäische Union • Flüchtlinge • Fluchtursachen • Neuerscheinungen Sachbuch • Obergrenze • Preis der Leipziger Buchmesse 2015 • Richard G. Plaschka-Preis 2006 • Sachbuch-Bestenliste • Sachbuch-Bestseller-Liste • Schengener Abkommen • Syrien • Wittgenstein-Preis 2019 |
| ISBN-10 | 3-518-75410-6 / 3518754106 |
| ISBN-13 | 978-3-518-75410-8 / 9783518754108 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich