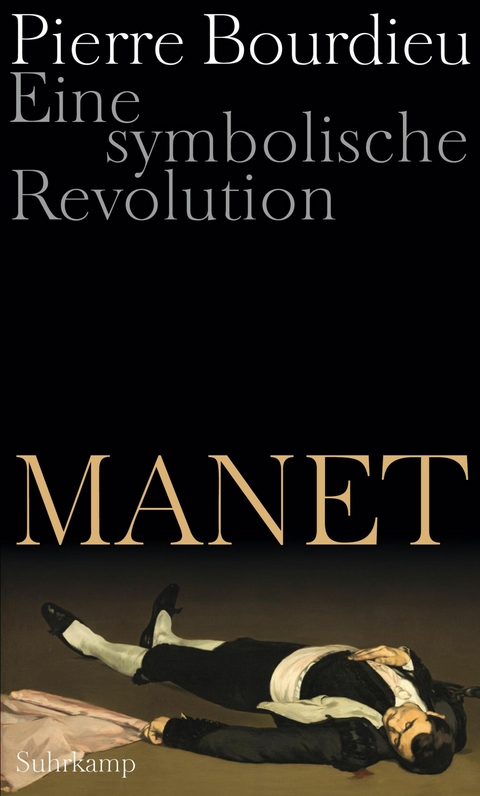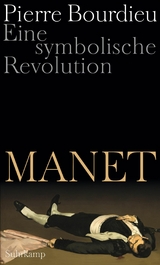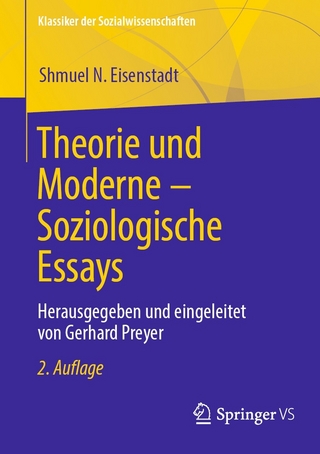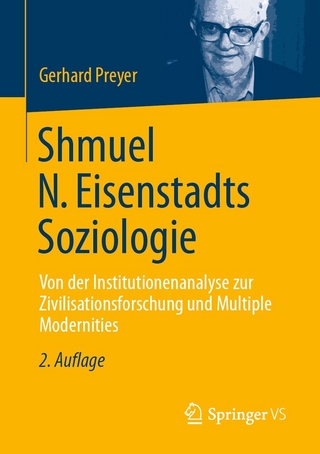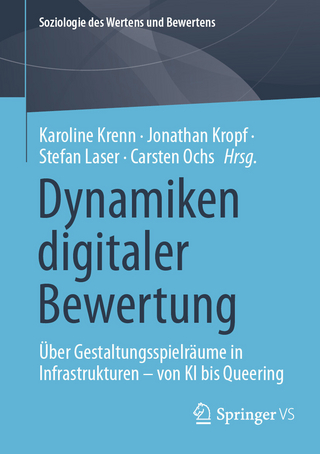Manet (eBook)
921 Seiten
Suhrkamp (Verlag)
9783518741856 (ISBN)
Wie vollzieht sich eine symbolische Revolution? Wann hat sie Erfolg? Am Beispiel des Begründers der modernen Malerei, Édouard Manet, geht Pierre Bourdieu diesen Fragen in seinen bahnbrechenden Vorlesungen am Collège de France aus den Jahren 1998 bis 2000 nach.
Bourdieu situiert Manets Malerei in der Krise der Kunst Mitte des 19. Jahrhunderts. Manet bricht mit den Regeln der akademischen Malerei und revolutioniert die gesamte ästhetische Ordnung. Seine Gemälde sind eine Kampfansage: an den Akademismus, den Realismus, den Eklektizismus und sogar an den Impressionismus. Solche symbolischen Revolutionen, so Bourdieu, sind nur vor dem Hintergrund der Konstellationen des gesamten kulturellen Feldes zu erklären. Mit seinen Studien zu Manet hat Bourdieu ein Grundlagenwerk der Kunstsoziologie vorgelegt.
Mit einem unvollendeten Buchmanuskript von Pierre und Marie-Claire Bourdieu
<p>Pierre Bourdieu, am 1. August 1930 in Denguin (Pyrénées Atlantiques) geboren, besuchte dort das <i>Lycée de Pau</i> und wechselte 1948 an das berühmte <i>Lycée </i><i>Louis-le-Grand</i> nach Paris. Nachdem er die Eliteschule der <i>École Normale Supérieure</i> durchlaufen hatte, folgte eine außergewöhnliche akademische Karriere. Von 1958 bis 1960 war er Assistent an der <i>Faculté des lettres</i> in Algier, wechselte dann nach Paris und Lille und wurde 1964 Professor an der <i>École Pratique des Hautes Études en Sciences Sociales.</i> Im selben Jahr begann er, die Reihe <i>Le sens commun</i> beim Verlag <i>Éditions de Minuit</i> herauszugeben und erhielt einen Lehrauftrag an der <i>Ècole Normale Supérieure</i>. Es folgten Gastprofessuren und Forschungsaufenthalte in Princeton und am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Seit 1975 gibt er die Forschungsreihe <i>Actes de la recherche en sciences sociales</i> heraus. 1982 folgte schließlich die Berufung an das <i>Collège de France</i>. 1993 erhielt er die höchste akademische Auszeichnung, die in Frankreich vergeben wird, die <i>Médaille d&#39;or </i>des<i> Centre National de Recherche Scientifique</i>. 1997 wurde ihm der Ernst-Bloch-Preis der Stadt Ludwigshafen verliehen.<br /> In seinen ersten ethnologischen Arbeiten untersuchte Bourdieu die Gesellschaft der Kabylen in Algerien. Die in der empirischen ethnologischen Forschung gemachten Erfahrungen bildeten die Grundlage für seine 1972 vorgelegte <i>Esquisse d&#39;une théorie de la pratique</i> (dt. <i>Entwurf einer Theorie der Praxis,</i> 1979). In seinem wohl bekanntesten Buch <i>La distinction</i> (1979, dt. <i>Die feinen Unterschiede,</i> 1982) analysiert Bourdieu wie Gewohnheiten, Freizeitbeschäftigungen, und Schönheitsideale dazu benutzt werden, das Klassenbewußtsein auszudrücken und zu reproduzieren. An zahlreichen Beispielen zeigt Bourdieu, wie sich Gruppen auf subtile Weise durch die <i>feinen Unterschiede</i> in Konsum und Gestus von der jeweils niedrigeren Klasse abgrenzen. Mit <i>Le sens pratique</i> (dt. <i>Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen</i> <i>Vernunft,</i> 1987) folgte 1980 eine ausführliche Reflexion über die konkreten Bedingungen der Wissenschaft, in der Bourdieu das Verhältnis von Theorie und Praxis neu zu denken versucht. Ziel dieser ...
Vorlesung vom 6. Januar 1999
Thema der Vorlesung: die von Manet ausgelöste symbolische Revolution. – Eine vollendete symbolische Ordnung. – »Peinture pompier«. – Die Konstruktion der modernen Kunst: ein umkämpftes Thema. – Parenthese: Soziale Probleme und soziologische Probleme. – Staatskunst und Akademismus der Avantgarde. – Die Talmi-Revolution. – Parenthese über wissenschaftlichen Populismus. – Ein unmögliches Forschungsprogramm: der Raum der Kritik. – Vom Banalen zum Skandal. – Ein Bild voller Unstimmigkeiten. – Die Kollision zwischen Edlem und Trivialem. – Die Affinität zwischen den Hierarchien. – Der falsche Gegensatz »Realismus / Formalismus«.
THEMA DER VORLESUNG: DIE VON MANET AUSGELÖSTE SYMBOLISCHE REVOLUTION
In diesem Jahr werde ich über etwas sprechen, was man als eine gelungene symbolische Revolution bezeichnen könnte, nämlich die, die Édouard Manet (1832-1883) initiiert hat, wobei es meine Absicht ist, sowohl diese Revolution selbst in ihrer Besonderheit verständlich zu machen als auch die Werke, die diese Revolution ausgelöst haben. Allgemeiner noch möchte ich versuchen, überhaupt den Begriff ›symbolische Revolution‹ verständlich zu machen.
Wenn gerade erfolgreiche symbolische Revolutionen besonders schwer zu verstehen sind, so deswegen, weil es das schwierigste ist, etwas zu verstehen, was selbstverständlich scheint, insofern eine symbolische Revolution ja die Strukturen produziert, über die wir sie wahrnehmen. Anders gesagt: Ganz wie die großen religiösen Revolutionen wälzt eine symbolische Revolution die kognitiven und manchmal in gewissem Maße die sozialen Strukturen um. Sobald sie gelingt, setzt sie neue kognitive Strukturen durch, die dadurch unmerklich werden, daß sie sich verallgemeinern, sich ausbreiten, alle wahrnehmenden Subjekte eines sozialen Universums prägen. Unsere Wahrnehmungs- und Bewertungskategorien, die wir gewöhnlich benutzen, um die Vorstellungen von der Welt und die Welt selbst zu verstehen, sind dieser gelungenen symbolischen Revolution entsprungen. Die Vorstellung von der Welt, die mit dieser Revolution entstanden ist, ist also evident geworden – so evident, daß der von Manets Werken entfachte Skandal seinerseits erstaunt, ja skandalisiert. Anders gesagt, wir erleben eine Art Verkehrung.
Ich werde Ihnen sinnfällig zu machen versuchen, was ich hier in meiner ersten Vorlesung auf abstrakte Weise darstelle, und das ist nicht so einfach, wie es scheint. Diese Verkehrung von Für und Wider hindert daran, die Arbeit der kollektiven Konversion zu verstehen, die erforderlich war zur Schaffung der neuen Welt, deren Produkt unser eigenes Auge ist – den religiös gefärbten Begriff Konversion verwende ich absichtlich. Natürlich benutze ich das Wort »Auge« im Sinn eines sozial konstruierten Organs, wie es zum Beispiel in dem sehr schönen Buch Die Wirklichkeit der Bilder geschieht, in dem Baxandall die soziale Genese eines historischen Auges, eines Systems von verinnerlichten Wahrnehmungskategorien analysiert.[1] Die Arbeit an der Konversion, die ich hier untersuchen möchte, kann nur verstanden werden, wenn wir das Augenmerk auf unseren eigenen Blick richten, oder genauer gesagt: Sie kann nur kraft einer Arbeit verstanden werden, die darauf abzielt, die Revolution zu entbanalisieren, deren Produkt unser eigener Blick ist, indem wir alles entbanalisieren, was ihr Erfolg banal gemacht hat, nämlich die objektiven und verinnerlichten Strukturen, die sie durchgesetzt hat, angefangen bei den Strukturen unserer eigenen Blickweise.
Ich benutze bewußt das Vokabular Banalisierung und Entbanalisierung, um die Sprache der »Verfremdung« der russischen Formalisten aufzugreifen[2] und nebenbei zwei sehr weit auseinanderliegende Traditionen miteinander zu versöhnen: die der russischen Formalisten und die Webersche Tradition – Max Weber betont, was er die »Veralltäglichung« oder Banalisierung des Charisma nennt.[3] Eine symbolische Revolution ist eine typische charismatische Revolution. Wie die Religionen der großen Religionsgründer setzt sich eine charismatische Revolution in Form mentaler Strukturen durch und tendiert dazu, sich zu veralltäglichen und das zu banalisieren, was durch diese banalisierten Kategorien gesehen wird, das heißt gerade das Objekt der Entbanalisierung, gerade das Objekt des Prozesses der Entbanalisierung. Das Paradox des Großinquisitors bei Dostojewskij,[4] genauer gesagt, das Prinzip dieses Paradoxes, ist in diesen Untersuchungen wiederzufinden. Es ist in keiner Weise erstaunlich, daß eine religiöse Botschaft dadurch, daß sie Erfolg hat und universell wird, sich selbst, insbesondere aber ihre subversive Kraft zerstört.
EINE VOLLENDETE SYMBOLISCHE ORDNUNG
Um diese symbolische Revolution zu verstehen, von der ich, vielleicht zu abstrakt, gesagt habe, daß sie zwangsläufig schwer zu verstehen ist, muß man zunächst einmal die symbolische Ordnung verstehen, die Manet umgestürzt hat, und dann, worin diese Ordnung bestand – eine vollendete symbolische Ordnung ist eine Ordnung, die sich als evident aufzwingt, eine Ordnung, die so ist, daß es niemandem in den Sinn kommt, sie in Frage zu stellen. Mit anderen Worten, eine vollendete symbolische Ordnung vollbringt, daß sie aufgefaßt wird als etwas, das sich von selbst versteht, als taken for granted. Um sich die ganze Macht dieser symbolischen Ordnung zu vergegenwärtigen, muß man sich vor Augen halten, daß diese Erfahrung des »Selbstverständlichen« außergewöhnlich ist, aber paradoxerweise als gewöhnlich erscheint: Sie ist außergewöhnlich, weil sie den fast völligen Einklang zwischen den objektiven Strukturen der Welt, dem Wahrgenommenen, und den kognitiven Strukturen voraussetzt, mit deren Hilfe wahrgenommen wird. Und aus diesem unmittelbaren, unstrittigen, harmonischen Einklang erwächst die Erfahrung des »So-und-nicht-anders«, des »Das-versteht-sich-von-selbst«, des »Anders-geht-es-gar-nicht«.
Eine überlieferte symbolische Ordnung ist so beschaffen, daß die Möglichkeit, anders zu sein oder zu handeln, nicht denkbar ist: Jede andere Ordnung als diese ist undenkbar, es gibt keine Wahrnehmungskategorien, die eine andere Ordnung zu antizipieren gestatten. Utopien beispielsweise schließt eine vollkommene symbolische Ordnung aus – die übrigens nie in vollem Sinne existiert, außer vielleicht in einigen sogenannt »archaischen« Gesellschaften, die völlig abgeschnitten sind von zivilisatorischen Kontakten, durch welche das, was als Natur, physis, erfahren wurde, nun als nomos in Erscheinung tritt, gegründet auf die Willkür einer Konvention, einer Ordnung, eines Gesetzes. Eine symbolische Ordnung verstehen heißt also diesen Einklang zwischen den objektiven Strukturen der sozialen Welt und den kognitiven Strukturen verstehen; heißt den Blickpunkt eines Ethnologen einnehmen, der gegenüber dieser Welt keine äußerliche Position bezieht, der nicht einen normativen Blickpunkt einnimmt, der weder den Blickpunkt der Anprangerung noch den der Rehabilitierung wählt. Allerdings ist bei dem Gegenstand, von dem ich spreche, die Anprangerung schon in der Sprache enthalten, in der wir über ihn sprechen.
»PEINTURE POMPIER«
Von Peinture pompier[5] – die Bezeichnung stammt aus dem akademischen Jargon, letztlich aus dem der Rapins (Malschüler oder »Kleckser«)[6] – sprechen wir, um etwas zu bezeichnen, was wir heute »Peplum« nennen würden, Werke mit Menschen in antikem Kostüm. Diese Peinture pompier, von der wir einige Reste zum Beispiel im Musée d'Orsay sehen können, fordert uns noch heute heraus, wir bleiben nicht gleichgültig. Wir schwanken zwischen Verurteilung und Rehabilitierung. Man kann sagen, diese Kunst sei erledigt, sie sei überholt, wie es heute heißt – in der intellektuellen und künstlerischen Polemik ist das die entscheidende Waffe, dem Gegner nachzusagen, daß er erledigt, daß er überholt ist (wenn man nett sein will, schiebt man ihn zu den Klassikern ab, und wenn man ihn schlachten will, in die Welt von gestern, und man nennt ihn erledigt). Die Kunst der Pompier wird abgetan, ins Archaische, in die Welt von gestern abgeschoben oder auch in manchen Fällen – und diese Sicht greift mehr und mehr um sich – rehabilitiert. Manche sagen, »die Pompiers waren schließlich gar nicht so schlecht«, und ich werde Ihnen Texte von sehr prominenten und respektablen Leuten zitieren, die zu zeigen versuchen, daß die Kunst der Pompiers in mancher Hinsicht gar nicht so abscheulich war, wie man behauptet – paradoxerweise ist die konservative Phantasie unerschöpflich. Zum Beispiel wird hervorgehoben, daß die Pompier-Künstler häufiger von niedriger sozialer Herkunft waren als die Revolutionäre, die sie gestürzt haben – und das trifft auch zu. Ein interessantes soziales Paradox: In den der Sozialordnung gegenüber relativ autonomen Welten, die ich Felder nenne, sind die Revolutionäre üblicherweise Privilegierte, Wohlhabende. Manet ist ein Beispiel dafür, und sicher haben seine Dispositionen zum Revolutionär damit zu tun, daß er ein Privilegierter ist, und vor allem...
| Erscheint lt. Verlag | 8.12.2015 |
|---|---|
| Übersetzer | Achim Russer, Bernd Schwibs |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Manet. Une révolution symbolique. Cours au Collège de France (1998-2000) suivis d'un manuscrit inachevé de Pierre et Marie-Claire Bourdieu |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung |
| Sozialwissenschaften ► Soziologie ► Allgemeine Soziologie | |
| Schlagworte | Ernst-Bloch-Preis der Stadt Ludwigshafen 1997 • Frankreich • Kunst • Malerei • Manet. Une révolution symbolique. Cours au Collège de France (1998-2000) suivis d'un manuscrit inachevé de Pierre et Marie-Claire Bourdieu deutsch • Médaille d'or des Centre National de Recherche Scientifique 1993 • Soziologie • Vorlesungen • Westeuropa |
| ISBN-13 | 9783518741856 / 9783518741856 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich