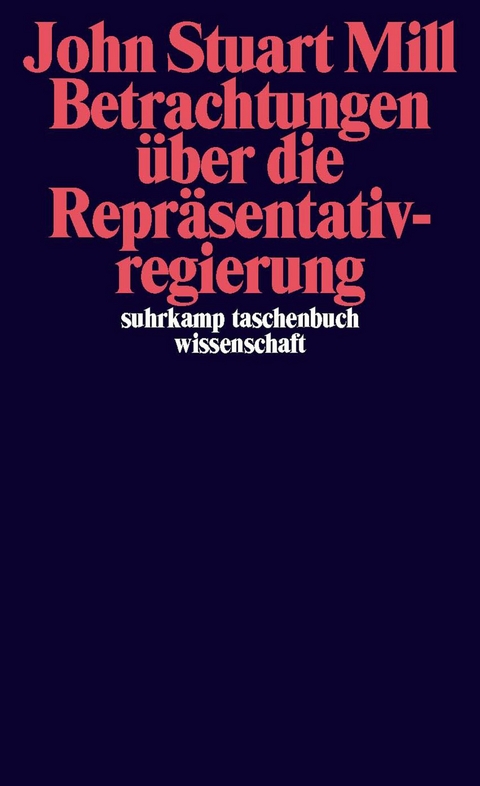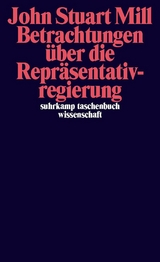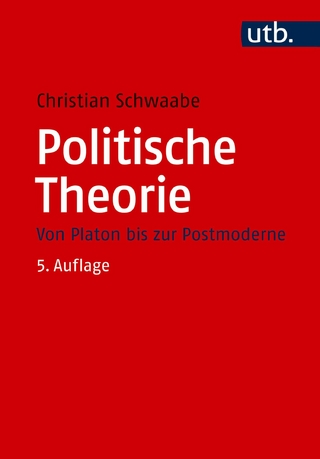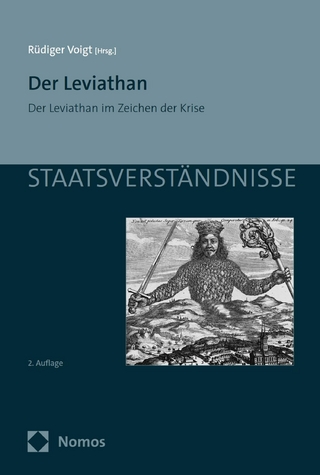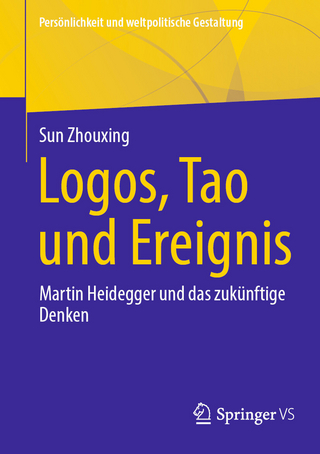Betrachtungen über die Repräsentativregierung (eBook)
336 Seiten
Suhrkamp (Verlag)
978-3-518-73517-6 (ISBN)
<p>John Stuart Mill (1806-1873), englischer Philosoph und Ökonom, war einer der einflussreichsten Denker des 19. Jahrhunderts. Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter des politischen Liberalismus.<br /> </p>
Cover 1
Informationen zum Buch / zum Autor / zu den Herausgebern 2
Impressum 4
Inhalt 5
Vorrede 7
Zur zweiten Auflage 8
I. Inwieweit Regierungsformen Objekt freier Entscheidung sind 9
II. Das Kriterium einer guten Regierungsform 22
III. Die Repräsentativregierung als ideal beste Regierungsform 44
IV. Unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen eine Repräsentativregierung unmöglich ist 64
V. Über die Repräsentativkörperschaften angemessenen Funktionen 77
VI. Schwächen und Gefährdungen der Repräsentativregierung 94
VII. Wahre und falsche Demokratie: Repräsentation der Gesamtheit und Repräsentation allein der Mehrheit 112
VIII. Über die Ausweitung des Wahlrechts 137
IX. Soll der Wahlvorgang aus zwei Phasen bestehen? 158
X. Das Abstimmungsverfahren 165
XI. Über die Mandatsperiode der Parlamente 185
XII. Sollen Parlamentsabgeordnete an Aufträge ihrer Wähler gebunden sein? 188
XIII. Über das Zweikammersystem 200
XIV. Über die Exekutive im Repräsentativsystem 209
XV. Über kommunale Repräsentativkörperschaften 228
XVI. Nationenbildung und Repräsentativsystem 245
XVII. Bundesstaatliche Repräsentativregierungen 254
XVIII. Über das Regieren von Kolonien durch freie Staaten 266
Hubertus Buchstein, Sandra Seubert: Nachwort 289
Namenregister 327
Sachregister 329
9I. Inwieweit Regierungsformen Objekt freier Entscheidung sind
Alle Betrachtungen über Regierungsformen sind mehr oder weniger ausschließlich von zwei gegensätzlichen Theorien über politische Institutionen geprägt; oder genauer: von gegensätzlichen Auffassungen über des Wesens politischer Institutionen.
Einige Theoretiker fassen Regieren als eine im strikten Sinn praktische Kunst auf, die keine andere Frage als jene nach Mitteln und Zweck aufwirft. Regierungsformen werden mit allen anderen Mitteln zur Erreichung menschlicher Ziele auf eine Stufe gestellt. Sie werden ausschließlich als eine Frage des Erfindens und Konstruierens betrachtet. Da sie von Menschen gemacht sind, wird angenommen, dass es in der Entscheidung des Menschen steht, sie zu machen oder nicht, und zu bestimmen, auf welche Weise oder nach welchem Modell sie gemacht werden sollen. Regierung stellt nach dieser Auffassung ein Problem dar, das wie jede andere praktische Aufgabe zu bewältigen ist. Der erste Schritt ist eine Definition der Zwecke, deren Förderung man von Regierungen erwartet. Der nächste ist eine Untersuchung, welche Regierungsform am besten geeignet ist, diese Zwecke zu erreichen. Hat man in diesen beiden Punkten hinreichende Klarheit erlangt und diejenige Regierungsform ermittelt, die größtmögliche Vorteile mit den geringsten Nachteilen verbindet, so bleibt nur noch, die Zustimmung der Mitbürger – bzw. derer, für die die Institutionen bestimmt sind – zu dieser von Einzelnen gewonnenen Auffassung zu erlangen. Die beste Regierungsform zu ermitteln, andere zu überzeugen, dass sie die beste ist, und sie dazu zu bringen, auf deren Einführung zu bestehen: das ist die Gedankenfolge in den Überlegungen derer, die dieser Richtung der politischen Theorie folgen. Sie betrachten – bei Anerkennung von Unterschieden in der Größenordnung – eine Verfassung nicht anders als einen Dampfpflug oder eine Dreschmaschine.
Ihnen gegenüber steht eine andere Richtung von politischen Denkern, die, weit entfernt, eine Regierungsform einer Maschine gleichzustellen, diese vielmehr als eine Art spontanes Produkt und die Regierungslehre gewissermaßen als einen Zweig der Naturge10schichte betrachten. Ihrer Auffassung nach sind Regierungsformen kein Objekt freier Entscheidung. Im Großen und Ganzen muss man sie nehmen, wie man sie vorfindet. Regierungssysteme können nicht nach einem vorgefassten Plan konstruiert werden. Sie »werden nicht gemacht, sondern wachsen«.[1] Unsere Aufgabe ihnen wie allen anderen Naturgegebenheiten gegenüber ist es, ihre Eigenschaften kennenzulernen und uns nach ihnen zu richten. Die grundlegenden politischen Institutionen eines Volkes gelten dieser Schule als eine Art organisches Gebilde, das aus der Natur und dem Leben des betreffenden Volkes erwächst – ein Produkt seiner Gewohnheit, Instinkte, unbewussten Bedürfnisse und Wünsche, kaum je aber seiner bewussten Absichten. Der Wille des Volkes hat bei der Herausbildung seiner fundamentalen politischen Institutionen keine andere Funktion als die, den Erfordernissen des Augenblicks mit entsprechenden Planungen zu begegnen; Maßnahmen, die, sofern sie den Gefühlen und dem Charakter des Volkes einigermaßen entsprechen, in aller Regel fortbestehen und durch allmähliche Ansammlung eine politische Struktur hervorbringen. Diese ist dem betreffenden Volke angemessen, aber sie auf irgendein anderes Volk zu übertragen, aus dessen Eigenart und Lebensbedingungen sie sich nicht von selbst entwickelt hat, müsste scheitern.
Es ist schwer zu sagen, welche dieser Lehren unsinniger wäre, wenn man annehmen müsste, dass eine von beiden ausschließliche theoretische Gültigkeit besitzt. Aber die Thesen, die die Menschen in kontroversen Fragen vertreten, pflegen ihre wirklichen Ansichten nur sehr unvollständig auszudrücken. Niemand wird annehmen, dass jedes Volk in der Lage ist, mit jeder Art von Institutionen umzugehen. So weit man die Analogie zu mechanischen Hilfsmitteln auch treiben mag, nicht einmal ein Werkzeug aus Holz und Eisen wird man einzig aus dem Grunde wählen, weil es an sich das Beste ist. Man wird erwägen, ob auch die anderen Materialien vorhanden sind, in Verbindung mit denen erst seine Anwendung von Vorteil ist, und vor allem, ob diejenigen, die sich seiner bedienen sollen, auch über die für seine Handhabung nötigen Kenntnisse sowie die erforderliche Geschicklichkeit verfügen. Auf der anderen Seite sind jene, die von politischen Institutionen wie von einem 11lebendigen Organismus sprechen, keineswegs die politischen Fatalisten, als die sie sich ausgeben. Sie behaupten nicht, dass der freien Wahl des Menschen in Bezug auf die Regierung, unter der er lebt, durchaus kein Spielraum bleibt oder dass die Erwägung der Konsequenzen, die sich aus den verschiedenen Verfassungsformen ergeben, bei der Entscheidung, welche von ihnen den Vorzug verdient, keinerlei Gewicht hat. Obwohl aber jede Seite ihre Theorie aus Opposition zur anderen übertreibt und wohl niemand einer von beiden uneingeschränkt beipflichtet, entsprechen die beiden Theorien doch einem tief verwurzelten Gegensatz zwischen zwei verschiedenen Denkstilen. Und obgleich offensichtlich keine von beiden völlig im Recht ist, müssen wir, da ebenso klar ist, dass keine ganz unrecht hat, den Versuch machen, ihnen auf den Grund zu kommen und uns des Teils Wahrheit zu bemächtigen, der in beiden zu finden ist.
Erinnern wir uns zunächst, dass politische Institutionen – sosehr diese theoretische Feststellung bisweilen außer Acht geraten mag – ein Werk der Menschen sind, ihren Ursprung und ihr Vorhandensein allein dem menschlichen Willen verdanken. Der Mensch erwachte nicht etwa eines schönen Tages und sah sie fertig vor sich stehen. Ebenso wenig gleichen sie Bäumen, die, einmal gepflanzt, »immerfort wachsen«, während die Menschen »schlafen«.[2] Auf jeder Stufe ihres Daseins sind sie das, was sie sind, durch bewusstes menschliches Handeln geworden. Und wie alle Dinge, die von Menschen gemacht werden, können sie daher gut oder schlecht gemacht sein; bei ihrer Schaffung können Urteilsfähigkeit und Geschicklichkeit oder aber deren Gegenteil gewaltet haben. Wenn hingegen ein Volk es unterlassen hat oder durch äußeren Druck gehindert worden ist, sich selbst eine Verfassung zu geben, indem es in einem tastenden Prozess jedem Übelstand, der sich zeigte, das entsprechende Korrektiv entgegensetzte bzw. die jeweils Betroffenen Kraft zum Widerstand gewannen, so ist diese Verzögerung des politischen Fortschritts zwar unzweifelhaft ein großer Nachteil, beweist aber nicht, dass das, was sich für ein anderes Volk bewährt hat, nicht auch für dieses geeignet gewesen wäre und auch noch sein würde, wenn das betreffende Volk es annehmen wollte.
12Andererseits müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass die politische Maschinerie nicht von selbst funktioniert. Wie sie von Menschen gemacht wurde, so muss sie auch von Menschen – und sogar von gewöhnlichen Menschen – in Betrieb gehalten werden. Sie verlangt nicht deren bloßes Gewährenlassen, sondern ihre aktive Teilnahme; und sie muss den Fähigkeiten und den Eigenschaften ebensolcher Menschen, wie sie zur Verfügung stehen, adäquat sein. Dies setzt drei Bedingungen voraus. Das Volk, für das eine Regierungsform bestimmt ist, muss bereit sein, sie zu akzeptieren – zumindest soweit, dass es ihrer Einführung keine unüberwindlichen Hindernisse entgegenstellt. Es muss bereit und fähig sein, das zu ihrer Aufrechterhaltung Nötige zu tun. Und es muss bereit und fähig sein, zu tun, was die jeweilige Regierungsform, soll sie ihren Aufgaben gerecht werden, von ihm fordert. Das Wort »tun« meint hier sowohl handeln als auch unterlassen. Das Volk muss zum Handeln wie zur bewussten Zurückhaltung vom Handeln in der Lage sein – je nachdem, welches Verhalten das bestehende Verfassungssystem zu seiner Aufrechterhaltung bzw. zur Erreichung jener Ziele fordert, denen es seinen eigenen Voraussetzungen nach verpflichtet ist.
Fehlt auch nur eine dieser Voraussetzungen, so wird eine Verfassung, so geeignet sie auch sonst zu sein verspricht, für den konkreten Fall ungeeignet.
Das erste Hindernis, die Abneigung des Volkes gegen eine bestimmte Regierungsform, bedarf kaum einer Erläuterung, da es von keiner Theorie übersehen werden konnte. Der Fall begegnet uns immer wieder. Nur fremde Gewalt könnte einen nordamerikanischen Indianerstamm bestimmen, sich den Beschränkungen zivilisierter, geregelter Herrschaft zu unterwerfen. Dasselbe ließe sich, wenn auch weniger absolut, von den Barbaren, die das Römische Reich überrannten, sagen. Es bedurfte mehrerer Jahrhunderte und einer vollständigen Veränderung der Verhältnisse, um sie – außerhalb der Zeit des eigentlichen Kriegsdienstes – zu diszipliniertem Gehorsam auch nur gegen ihre eigenen Führer zu erziehen. Es gibt Nationen, die sich freiwillig keiner anderen Regierung fügen wollen als derjenigen bestimmter Familien, die seit unvordenklichen Zeiten das Vorrecht besitzen, den Herrscher zu stellen. Manche Völker können nur durch fremde Eroberung gezwungen werden, sich mit einer Monarchie abzufinden; andere sind ebenso entschie13dene Gegner einer Republik. Oft macht also die Ablehnung, zumindest für den gegebenen Zeitraum, ein bestimmtes System nicht praktikabel.
Aber es gibt auch Fälle, in denen ein Volk, obwohl es eine Regierungsform nicht nur nicht ablehnt, sondern sie möglicherweise sogar wünscht, doch nicht bereit oder fähig ist, ihren Erfordernissen zu entsprechen. Ein Volk kann unfähig sein, selbst die Bedingungen der formalen Aufrechterhaltung eines Regierungssystems zu erfüllen. Es mag zwar einer freien Regierung theoretisch...
| Erscheint lt. Verlag | 21.8.2013 |
|---|---|
| Übersetzer | Hannelore Irle-Dietrich |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung ► Politische Theorie |
| Schlagworte | Demokratie • Parlamentarismus • Repräsentation • STW 2067 • STW2067 • suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2067 |
| ISBN-10 | 3-518-73517-9 / 3518735179 |
| ISBN-13 | 978-3-518-73517-6 / 9783518735176 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich