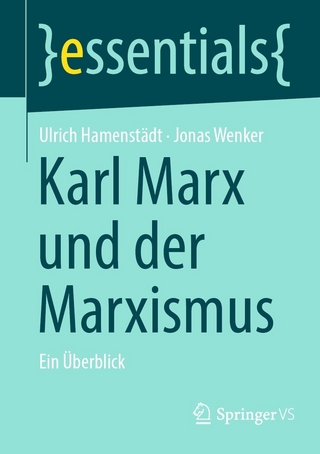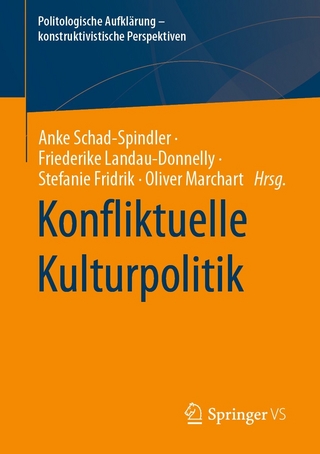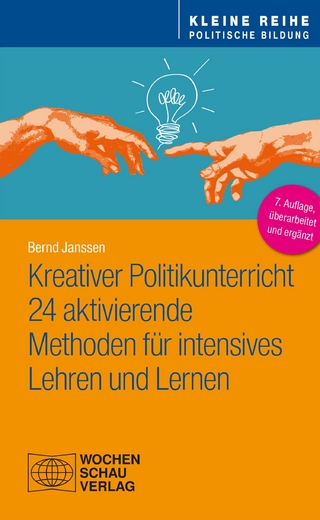Postdemokratie (eBook)
159 Seiten
Suhrkamp (Verlag)
978-3-518-78530-0 (ISBN)
<p>Colin Crouch, geboren 1944, lehrte bis zu seiner Emeritierung Governance and Public Management an der Warwick Business School. Für sein Buch <em>Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus</em> erhielt Crouch 2012 den Preis »Das politische Buch« der Friedrich-Ebert-Stiftung.</p>
Cover 1
Informationen zum Buch 2
Impressum 4
Inhalt 5
1. Was heißt »Postdemokratie«? 7
Der Augenblick der Demokratie 14
Eine Krise der Demokratie? Welche Krise? 20
Politische Beteiligung jenseits von Wahlen 24
Symptome der Postdemokratie 30
Postdemokratie als Gegenstand der Politikwissenschaft 41
2. Das globale Unternehmen 45
Phantomunternehmen 50
Das Unternehmen als institutionelles Modell 55
Regierungen ohne Selbstvertrauen 57
Ökonomische Eliten und politische Macht 60
Die besondere Rolle der Medienunternehmen 63
Märkte und Klassen 69
3. Soziale Klassen im postdemokratischen Zeitalter 71
Der Niedergang der traditionellen Arbeiterklasse 71
Der fehlende Zusammenhalt der übrigen Klassen 76
Die Rolle der Frauen in der Demokratie 80
Die Widersprüche reformistischer Positionen 83
4. Zur Lage der Parteien 91
Die postdemokratische Herausforderung 93
5. Postdemokratie und die Kommerzialisierung öffentlicher Leistungen 101
Der Markt und die Rechte der Bürger 108
Verzerrung 110
Die Erosion öffentlicher Leistungen 114
Unvollkommene Märkte 116
Privatisieren oder auslagern? 120
Der Begriff der staatlichen Autorität verliert an Bedeutung 123
Die Ansprüche der Bürger werden nicht länger erfüllt 129
6. Und jetzt? 133
Gegen die Macht der Unternehmen 133
Das Dilemma der Bürger 140
Parteien und Wahlen sind immer noch wichtig 143
Neue Identitäten mobilisieren 148
Fazit 155
Literaturverzeichnis 158
2. Das globale Unternehmen
Die Schlüsselinstitution der postdemokratischen Welt
Während des Großteils des 20. Jahrhunderts hat die europäische Linke die Bedeutung des Unternehmens als soziale Institution vernachlässigt. Ursprünglich hielt man es lediglich für ein Instrument, mit dem der Eigentümer Profit machen und seine Arbeiter ausbeuten konnte. Zwar sind Unternehmen äußerst empfänglich für die Ansprüche der Konsumenten, doch angesichts der Armut der Arbeiter war dies nicht wirklich ein Pluspunkt, da diese Klasse selten die Chance hatte, ihre Konsumwünsche zum Ausdruck zu bringen. Und während der angenehmen Jahre des wachsenden Wohlstands im dritten Viertel des 20. Jahrhunderts, als sich der Massenkonsum durchsetzte, waren die großen Unternehmen als bequeme Wohlstandsgeneratoren längst eine Selbstverständlichkeit.
In dieser von der Theorie John Maynard Keynes’ geprägten Ära setzten beinahe alle Parteien in der Wirtschaftspolitik auf makroökonomische Ansätze. Man ging davon aus, daß es einzelnen Unternehmen keine Schwierigkeiten bereiten würde, auf dem Markt Nischen für ihre Produkte zu finden und diese zu nutzen, solange diese Märkte durch makroökonomische Maßnahmen belebt wurden. Vertreter der neoliberalen Rechten, die den Primat der Mikroökonomie und die Probleme der Unternehmen hervorhoben, wurden weitgehend ignoriert. Und in einem gewissen Sinn konnten auch die Unternehmen damit sehr gut leben: Solange die Regierungen damit beschäftigt waren, einen stabilen ökonomischen Kontext zu gewährleisten, anstatt sich mit den Details der Arbeit in den Unternehmen zu beschäftigten, mischten sich die Politiker nicht allzu sehr in die Angelegenheiten der Wirtschaftsbosse ein.
Als das keynesianistische Paradigma im Zuge der Inflationskrise der siebziger Jahre zusammenbrach, änderte sich alles von Grund auf. Da man die Gesamtnachfrage nicht mehr steuern konnte, war auf die Warenmärkte nicht länger Verlaß. Dieses Problem wurde durch andere Entwicklungen verstärkt: rapide technologische Veränderungen und Innovationen, wachsender globaler Wettbewerb und die steigenden Ansprüche der Konsumenten. Firmen, in denen man vorher uninspiriert und ohne viel unternehmerische Phantasie vor sich hin gewerkelt hatte, verloren nun den Boden unter den Füßen. Die Unterschiede zwischen erfolgreichen und erfolglosen Firmen wuchsen dramatisch, die Zahl der Bankrotte stieg und die Arbeitslosigkeit wuchs. Es war nicht länger selbstverständlich, daß auch mäßig erfolgreiche Firmen überlebten. Plötzlich fanden die Lobbys und pressure groups der Unternehmen mit größerer Wahrscheinlichkeit Gehör, schließlich nimmt man es ernster, wenn sich ein Kranker über den Luftzug beschwert, als wenn dies ein Gesunder tut.
Eine ganze Reihe weiterer Veränderungen folgte. Unter diesen Bedingungen gelang es den Unternehmen, sich in robuste und anspruchsvolle Organismen zu verwandeln; doch obwohl sie nun nicht länger einem Invaliden glichen, hat diese Entwicklung eine paradoxe Konsequenz: Man schenkte ihren Forderungen nun noch größere Aufmerksamkeit. Ein weitgehend unhinterfragtes Klischee in der politischen Diskussion besagt, daß dafür die Globalisierung verantwortlich sei. Tatsächlich hat sich der internationale Wettbewerb intensiviert, die Unternehmen können ihre Schwachstellen nicht länger verbergen, doch in dieser Situation überleben nur die zähesten und die härtesten, und diese Härte zeigt sich nicht nur – oder nicht in erster Linie – gegenüber den Konkurrenten, sondern gegenüber Regierungen und Beschäftigten. Wenn den Eigentümern eines globalen Unternehmens ein lokales Steuer- oder Arbeitsmarktsystem nicht gefällt, werden sie damit drohen, anderswohin zu gehen. Sie können daher weit wirkungsvoller auf Regierungen einwirken und ihre Politik beeinflussen, als die Bürger der entsprechenden Staaten, obgleich sie dort nicht leben, keine Bürgerrechte besitzen und keine Steuern zahlen. Robert Reich hat in Die neue Weltwirtschaft (1993) über diese Gruppe und die hochbezahlten Fachleute geschrieben, deren Fähigkeiten in aller Welt gefragt sind, und er hat über die Probleme berichtet, die sich aus der Tatsache ergeben, daß sie über beträchtliche Macht verfügen, während sie keiner identifizierbaren oder abgrenzbaren Gemeinschaft zur Loyalität verpflichtet sind. Vergleichbare Wahlmöglichkeiten stehen der breiten Masse der Bevölkerung nicht zur Verfügung; sie ist in der Regel gezwungen, in dem Staat zu bleiben, in dem sie geboren wurde und verwurzelt ist, sie muß dort die Gesetze befolgen und Steuern zahlen.
In vielerlei Hinsicht ähnelt dies der Situation im vorrevolutionären Frankreich, wo der Monarch und die Aristokraten, die die politische Macht innehatten, von den Steuern befreit waren, während die Mittelklasse und die Bauern Steuern zahlten, doch keinerlei politische Rechte besaßen. Es war dieses offenkundig ungerechte System, das die Gesellschaft zum Gären brachte, den Kampf um die Demokratie auslöste und diesen Konflikt mit Energie versorgte. Die Mitglieder der globalen Unternehmenselite tun nichts derart Skandalöses, sie nehmen uns nicht das Wahlrecht weg (zur Erinnerung: wir erleben eine parabelförmige Entwicklung, keine kreisförmige). Sie weisen eine Regierung einfach nur darauf hin, daß sie in diesem Land nicht investieren werden, wenn die nationalen Politiker beispielsweise darauf bestehen sollten, gewisse weitreichende Rechte der Arbeitnehmer beizubehalten. Die wichtigen Parteien des Landes werden sich hüten, diese Drohungen öffentlich zu machen, vielmehr erzählen sie ihren Wählern, antiquierte Regelungen des Arbeitsrechts müßten dringen reformiert werden. Die Wähler geben dann – ob sie sich nun darüber im klaren sind, daß hinter diesen Vorschlägen ein großangelegtes Deregulierungsprojekt steht oder nicht – diesen Parteien pflichtschuldigst ihre Stimmen, da sie ohnehin keine große Auswahl haben. Man kann somit behaupten, daß sich die Menschen in einem freien demokratischen Prozeß für die Deregulierung des Arbeitsmarktes entschieden haben.
Analog können die großen Firmen auch eine Senkung der Unternehmenssteuern fordern, wenn die Politiker wollen, daß sie weiterhin in einem Land investieren. Die Regierungen kommen ihnen entgegen, und die Steuerlast wird von den Unternehmen auf die einzelnen Steuerzahler abgewälzt, die dann wiederum wegen der hohen Steuersätze aufgebracht sind. Die großen Parteien reagieren darauf, indem sie Parlamentswahlen als Steuersenkungswettbewerbe inszenieren; die Wähler geben ihre Stimme der Partei, die die größten Geschenke verspricht, und einige Jahre später stellt man dann fest, daß alle öffentlichen Dienstleistungen bedrohlich an Qualität verloren haben. Doch die Bürger haben es ja nicht anders gewollt: Alle Entscheidungen sind auf demokratischem Weg zustande gekommen (Przeworski/Meseguer Yebra 2002).
Wir müssen uns davor hüten, die Bedeutung dieser Vorgänge zu übertreiben. Die Vorstellung, das Kapital habe sämtliche Fesseln abgestreift, ist ein Zerrbild, das seltsamerweise von Linken und Rechten gleichermaßen aufrechterhalten wird. Die Linken instrumentalisieren diese Version der Dinge, um ein Szenario an die Wand zu malen, in dem die Mächtigen der Wirtschaft vollkommen außer Kontrolle geraten sind. Die Rechten benutzen sie, um Arbeitsmarktreformen und Steuersenkungen im Interesse der Unternehmen durchzusetzen. In Wirklichkeit sind nicht nur viele Unternehmen weit davon entfernt, wirklich global zu agieren, sondern selbst die transnationalen Giganten können auf der Suche nach den niedrigsten Steuern und den schlechtesten Arbeitsbedingungen nicht permanent in der ganzen Welt herumhüpfen, weil sie durch die Struktur ihrer bestehenden Investitionen sowie die Fachkenntnisse und Netzwerke, auf die sie angewiesen sind, daran gehindert werden. Wirtschaftswissenschaftler sprechen an dieser Stelle von »sunk costs«. Auf gut deutsch heißt das: Umzüge sind teuer. Daran wurden alle Beteiligten nachdrücklich erinnert, als sich im Jahr 2000 sowohl BMW als auch Ford entschlossen, die Produktion in England zugunsten ihrer deutschen Fabriken zurückzuschrauben. Öffentlich wurde dafür zwar vor allem der überhöhte Kurs des britischen Pfundes als Grund angeführt, allerdings spielte ein weiterer Aspekt eine wichtige Rolle: Es erwies sich nämlich als schwieriger und kostspieliger, einen Unternehmensbereich in Deutschland zu schließen. Mit anderen Worten: Ebenjene Anstrengungen, die zunächst die konservativen Regierungen und dann New Labour unter Tony Blair unternommen hatten, um ausländische Investoren ins Land zu holen, indem sie hervorhoben, wie flexibel die Vorschriften in Großbritannien seien, machten es zugleich wahrscheinlicher, daß die ausländischen Investoren eine Fabrik in Großbritannien auch wieder schließen würden – wie gewonnen, so zerronnen.
Während es also wesentlich wahrscheinlicher ist, daß die deutsche Wirtschaft ihre bestehenden industriellen Strukturen bewahren wird, als daß dies der englischen Ökonomie gelingen sollte, dürfte die britische Strategie eher geeignet sein, neue Unternehmen anzuziehen – vorausgesetzt, daß sie weiterhin den ungebundenen globalen Unternehmen das bietet, was diese wünschen. Wenn diese Politik Erfolg hat, werden nach und nach alle Länder beginnen, sie nachzuahmen und darum wetteifern, wer den ausländischen Investoren das bieten kann, was sie verlangen. Unter diesen Bedingungen wird es wirklich zu jenem »Unterbietungswettkampf« bzw. race to the bottom im Arbeitsrecht, bei den Steuern und somit auch bei der Qualität der öffentlichen Leistungen kommen, den viele Autoren vorhersagen. Davon ausgenommen sein werden lediglich öffentliche Güter, die...
| Erscheint lt. Verlag | 22.10.2012 |
|---|---|
| Übersetzer | Nikolaus Gramm |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Postdemocrazia |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung ► Politische Theorie |
| Schlagworte | Demokratie • edition suhrkamp 2540 • ES 2540 • ES2540 • grexit • Griechenland • Neoliberalismus • Postdemokratie |
| ISBN-10 | 3-518-78530-3 / 3518785303 |
| ISBN-13 | 978-3-518-78530-0 / 9783518785300 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,1 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich