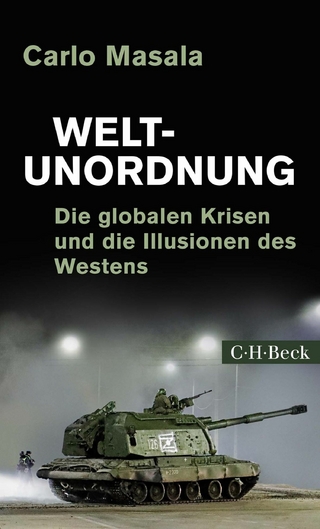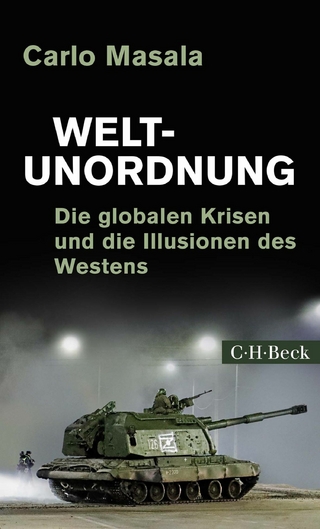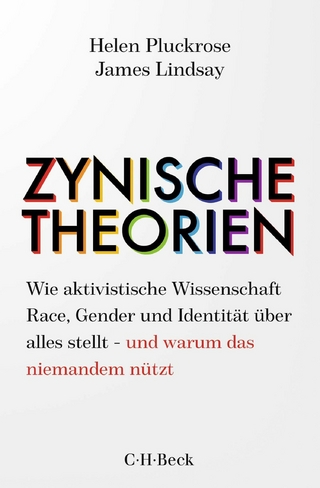Warum Jungen nicht mehr lesen (eBook)
285 Seiten
Campus Verlag
978-3-593-41496-6 (ISBN)
Katrin Müller-Walde, Dipl.-Volkswirtin, arbeitete nach ihrem Studium als freie Journalistin für Zeitungen sowie öffentlich-rechtliche und private Fernsehanstalten. Seit 1991 ist sie im ZDF als Moderatorin und Filmautorin für diverse Politik- und Gesellschaftsmagazine tätig. Sechs Jahre lang moderierte sie die Hauptausgabe der Nachrichtensendung heute. 2005, nach einem mehrjährigen Arbeitsaufenthalt in den USA, entstand ihr Buch 'Warum Jungen nicht mehr lesen und wie wir das ändern können', das sie nun komplett überarbeitet und aktualisiert hat. Katrin Müller-Walde ist Vorsitzende des Bundesvorstands 'Mentor - die Leselernhelfer e.V.'.
Katrin Müller-Walde, Dipl.-Volkswirtin, arbeitete nach ihrem Studium als freie Journalistin für Zeitungen sowie öffentlich-rechtliche und private Fernsehanstalten. Seit 1991 ist sie im ZDF als Moderatorin und Filmautorin für diverse Politik- und Gesellschaftsmagazine tätig. Sechs Jahre lang moderierte sie die Hauptausgabe der Nachrichtensendung heute. 2005, nach einem mehrjährigen Arbeitsaufenthalt in den USA, entstand ihr Buch "Warum Jungen nicht mehr lesen und wie wir das ändern können", das sie nun komplett überarbeitet und aktualisiert hat. Katrin Müller-Walde ist Vorsitzende des Bundesvorstands "Mentor - die Leselernhelfer e.V.".
Inhalt
Vorwort 13
Teil I
Warum Jungen nicht mehr lesen …
1.Warum Sie dieses Buch lesen sollten27
2.Das "gute Buch" und sein schlechter Ruf 36
3.Was bedeutet Lesen? 47
4.Vom kleinen (großen) Unterschied64
5.Das Gehirn sieht Lesen nicht vor 73
6.
Das Phänomen Boys' Underachievement -
und was die Schule leisten könnte85
7.Jungen fördern, Mädchen sind schon stark genug!97
8.Und wenn's die Gene sind …? 113
Teil II
… und wie wir das ändern können
1.Wie ich es schaffe, mein Kind zum Lesen zu bewegen 123
2.
Was Lehrer tun, Eltern wissen und sie gemeinsam
erreichen können 141
3.Was ist ein gutes Jungenbuch? 169
Teil III
Der Jungen Wahl: "Coole Bücher" aus der Sicht von Heranwach-senden
1.12- bis 14-Jährige 179
2.14- bis 15-Jährige 210
3.16- bis 18-Jährige 226
4.Der Jungen Wahl - 2010 240
5.Und jetzt?253
6.Zehn goldene Regeln für anhaltende Leselust 255
Epilog: Ottos Mission 257
Anmerkungen 265
Liste der empfohlenen Bücher 273
Bibliografie: Bücher, Zeitschriftenartikel und Websites 276
Danksagung 280
Register 281
Vorwort 'Und es verändert sich doch.' Dieser Satz wirkte auf mich wie eine Extradosis Glückshormone nach dem Joggen. Mein Herz schlug hö-her, der Blick ging weit nach vorn und ich fühlte: Diese Erkenntnis eröffnete Perspektiven für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Wissenschaftler bislang für unmöglich gehalten hatten. Das Gehirn kann sich also verändern. Und nicht nur das. Es kann sich reparieren und sogar bis ins hohe Alter hinein erneuern. Was für eine Chance. Norman Doidge, Psychiater und Psychoanalytiker aus Kanada, hatte das in seinem Buch Neustart im Kopf überzeugend nachge-wiesen, indem er zahlreiche Forschungsergebnisse aus verschiede-nen Disziplinen wie der Neurologie, der Psychiatrie und der Linguis-tik zusammenführte. Was bislang unter dem Schlagwort Neuroplasti-zität in der medialen Welt waberte, wurde plötzlich greifbarer und damit auch für mich und mein Interesse als Journalistin an Fragen der Lesekompetenzförderung bei Mädchen und Jungen alltagsrelevant. Vor diesem Hintergrund wollte ich die Kernaussagen meines im Jahr 2005 erschienenen Buches Warum Jungen nicht mehr lesen ... noch einmal durchdenken und insbesondere den zweiten Teil, ... und wie wir das ändern können, auf neue Möglich-keiten der Unterstützung für Erziehende in Schule und Elternhaus hin prüfen. Bevor ich mit der Arbeit begann, stand eines für mich fest: Endlich durfte ich eine zentrale These meines Buches, die mich damals schon schmerzte, verwerfen. Sie lautete: Wer bis zu seinem 15. Lebensjahr das Abenteuer Lesen nicht wirklich kennen gelernt hat, wird es vermut-lich nie kennen lernen - oder anders ausgedrückt, wer bis zu diesem Alter das wunderbare Gefühl, fasziniert wissen zu wollen, wie eine Geschichte ausgeht, nicht erfahren hat, wird über das Entziffern von Buchstaben und Wörtern aller Voraussicht nach nicht hinauskommen - mit allen einschränkenden Konsequenzen für die spätere Lesemotiva-tion, Schreib- und Bildungskompetenz der Betroffenen, für deren Be-rufs- und Lebensglück. Aus Sicht der Leseforschung war das 2005 noch aktueller Stand der Erkenntnis. Doch nun gibt es neue Hoffnung - auch für die Altersgruppe, die Leseforscher schon längst abgeschrieben hatten. 61 Prozent aller in Deutschland lebenden Jungen im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren hatten damals bei unserer repräsentativen Um-frage unter mehr als 2?000 Schülern angegeben, noch nie freiwillig ein Buch in die Hand genommen zu haben. Zu entdecken, dass auch die Lesewiderständigsten möglicherweise eine realistische Chance haben sollten, ans Lesen herangeführt zu werden (wenn wir es richtig anstellten), motivierte mich, noch einmal tiefer in die Materie Lese-kompetenzforschung einzusteigen. Ich darf sagen: Nie habe ich mich über einen wissenschaftlichen Irrtum mehr gefreut. Seit beinahe zehn Jahren suche ich nun nach Gründen, weshalb Mädchen und Jungen im Land der Dichter und Denker das Buch zu-nehmend aus ihrem Kinderzimmer verbannen. Zuerst beobachtete ich dieses Phänomen vereinzelt in den eigenen vier Wänden, dann beim Nachwuchs von Freunden, die in Großstädten wie Berlin, Hamburg, Frankfurt oder Washington lebten. Später lernte ich durch meine Re-cherchen in den USA, Kanada, Frankreich oder Australien, dass die zunehmende Leseunlust von Heranwachsenden kein singuläres deut-sches Problem ist, sondern eines, das sich in allen hochindustrialisier-ten Ländern gleichermaßen nachweisen lässt, und das schon seit Mitte der neunziger Jahre. Ich war auf ein neues gesamtgesellschaftliches Phänomen gesto-ßen - ein Wohlstandsphänomen sozusagen, das bis Anfang des 21. Jahrhunderts in der medialen Öffentlichkeit der Bundesrepublik so gut wie keinen Niederschlag gefunden hatte. Deutsche Wissenschaftler hatten es wohl als Thema erkannt, forschten aber überwiegend im Elfenbeinturm - hoch über den Köpfen von Eltern und Pädagogen. Was ich suchte, waren indes praktische Antworten (... wie wir das ändern können), und diese fand ich: in englischsprachigen Publikatio-nen - gesammelt und aufgeschrieben von Erziehern und Lehrern, die schon jahrelang mit Liebe und Feuereifer um jedes Kind rangen, indem sie gegen das Phänomen der Leseunlust in den Kampf zogen wie gegen eine Krankheit - mal mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, sprich Schulmedizin, mal mit gesundem Menschenverstand, also Hausmitteln. Diese Mischung gefiel mir. Sie versprach genügend Material, um ei-ne belastbare Brücke hinein in den deutschen Alltag bauen zu können. Je länger ich recherchierte, desto klarer wurde: Das Phänomen zuneh-mender Leseinkompetenz glich einer gesellschaftlichen Zeitbombe. Nach wie vor dankbar bin ich deshalb der damaligen Programmlei-terin des Campus Verlags, Britta Kroker. Sie erkannte schon im Jahr 2003 die Relevanz und gesellschaftliche Dynamik des Themas. Hier ging es nicht nur um das Lesen von Fahrplänen oder Kinderbüchern. Hier ging es um viel mehr - um das Ausbilden der Schlüsselqualifika-tion, um in einer Wissensgesellschaft glücklich werden zu können. Zunehmende Leseinkompetenz von Jungen würde auf lange Sicht auch Folgen für die Demokratiefähigkeit einer ganzen Generation haben und unter Umständen einen neuen Geschlechterkampf provo-zieren. Nachdem jahrzehntelang Mädchen gefördert wurden, galt es nun, Jungen gleichermaßen zu unterstützen. Jenseits von Kosten-Nutzen-Rechnungen folgte Kroker meinem Vorschlag zum Buch, wenn auch nicht ganz ohne Bedenken: 'Das wird nicht einfach', meinte sie. 'Noch schwimmen wir damit gegen den Strom. Aber, ja, wir müssen was tun.' Zwei Jahre später erschien Warum Jungen nicht mehr lesen und wie wir das ändern können. Der Spiegel kom-mentierte: 'Eine schonungslose Analyse der jugendlichen Bücher-verweigerung, v.?a. eine praktische Anleitung für Wege aus der Lesekrise.' Heute, im Frühsommer 2010, da ich das Buch überarbeite, ist die Lesekrise und die sich daraus in alle Bereiche hinein entwickelnde 'Krise der Jungen' auch in Deutschland von höchster Stelle erkannt. Nach den ideologischen Schlachten der sechziger und siebziger Jahre im Kampf um die Gleichberechtigung von Frauen sprechen auch rot-grüne Politikerinnen offen von einem 'feminisierten Schulsystem' und nennen damit Gründe. Als Vorsitzende der Kultusministerkonfe-renz gehörte Ute Erdsiek-Rave (SPD), Bildungsministerin in Schles-wig-Holstein zwischen 2005 und 2009, mit zu den Ersten, die sich trauten, wider den Zeitgeist zu reden. 2006 lud sie mich zu einem Kongress nach Berlin ein. Er beschäftigte sich mit Chancengleichheit in der Schule für - man achte auf die Reihenfolge - Jungen und Mäd-chen und stützte zudem die Forderung des Berner Biobliothekentages 2005 nach geschlechtsspezifischer Leseförderung. Heute gehört die Idee der Jungenförderung zum bildungspolitischen Allgemeingut über Deutschlands Grenzen hinaus. Lehrer wissen, so zumindest meine persönliche Beobachtung, dass Jungen anders le-sen, anders lernen und deshalb in der Schule anders gefördert werden müssen als Mädchen. Ganze Bücherlisten deutscher Lehrpläne sind seither auf den Prüfstand gehoben worden. Der deutsche Philologen-verband forderte eine Leseoffensive für Jungen. Wissenschaftliche Studien und Foren lieferten seither immer neue Daten und Erkenntnis-se zum Thema, wenngleich sich die Diskussion darüber im Zuge von PISA zunächst vor allem auf Schüler sogenannter bildungsferner Fa-milien sowie auf Migranten fokussierte. Inzwischen ist klar: Betroffen sind Jungen in allen gesellschaftlichen Schichten. Sie brauchen ande-re, geschlechtsspezifische Lernangebote. Lehrer, die sich regelmäßig weiterbilden, kennen sie und tragen das Wissen zunehmend bewusst auch in die Elternhäuser. Mit Freude darf ich sagen, zu diesem Erkenntniswandel hat Warum Jungen nicht mehr lesen und wie wir das ändern können entscheidend beigetragen. Am 31. August 2006 begrüßte Ulrich Wickert die Zu-schauer der Tagesthemen mit den Worten: 'Jungen fördern, Mädchen sind schon stark genug! Das ist das Ergebnis eines Kongresses, der heute in Berlin zu Ende ging ...' Meine zentrale Forderung aus Kapitel I.7., die auf dem Kongress transportiert wurde, fand so millionenfach Verbreitung. Zuvor war das Buch zum Lehrmaterial an Universitäten geworden. Doch neue Entwicklungen sind selten frei von Rückschlägen. Ge-sellschaftliches Bewusstsein wandelt sich nur langsam, und so titelte Der Spiegel im September 2008 doch noch einmal: 'Angela Merkel tourt auf Bildungsreise durch die Republik. Aber ein Thema spielt keine Rolle. Jungen werden in der Schule benachteiligt.' Der Frankfurter Bildungsforscher Frank Dammasch bestätigte auf Nachfrage erneut: Ja, Jungen erhielten bei gleicher Kompetenz schlechtere Noten. Der Unterrichtsstoff gehe seit Jahren an männlichen Interessen vorbei. Der Unterricht sei eher an weibliche Formen des Lernens und Gestaltens angepasst. Doch wen stört's, wenn Mädchen an Jungen vorbeiziehen? Auch Frau von der Leyen, damals noch Familienministerin, offenbar nicht, wie Der Spiegel berichtet. Jungenförderung, das klinge doch irgendwie gestrig. Ein Jahr später, 2009, einigten sich Familienpolitiker von Union und FDP darauf, eine 'eigenständige Jungen- und Männerpolitik' zu ent-wickeln und dabei insbesondere deren Bildungs- und Entwicklungs-chancen in den Fokus zu nehmen. Das war neu. In dieser Deutlichkeit hatte das noch in keinem Koalitionsvertrag gestanden. 'Es war längst überfällig', sagt die Mitinitiatorin Miriam Gruß, jugendpolitische Spre-cherin und stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion dem Spiegel. Und Recht hat sie. Jungen ebenso wie Mädchen zu fördern ist nötiger denn je - aus der Sicht beider Geschlechter, aus der Sicht heranwachsender Frauen und Männer wie aus der Sicht von Eltern oder Erziehern. Geradezu überfällig nahm sich deshalb für mich der Programm-Schwerpunkt des Hessischen Rundfunks 'Jungen als Bildungsverlierer' am 10.3.2010 aus. In Wiesbaden regiert seit 2009 Schwarz-Gelb. Noch vor fünfzig Jahren sind Jungen die Bildungsgewinner gewe-sen. Mittlerweile sind sie die Bildungsverlierer. Ungeachtet zahlreicher, vielgestaltiger Lese-Initiativen und Aufklärungskampagnen (nach dem PISA-Schock 2000), die vonseiten des Bundes und der Länder, von Stiftungen und privaten Trägern ausgingen, hat sich die Leselust und damit auch die Lesekompetenz unter beiden Geschlechtern bis heute nicht nur nicht verbessert, bei Jungen hat sie sich auch noch ver-schlechtert. Im November 2009 klagt die ZEIT, neuerlich einen Schwerpunkt setzend: 'Ein Land verlernt das Lesen ...', und bezieht sich in der Argumentation auf aktuelle Forschungs-Ergebnisse der Stiftung Lesen. Deutsche halten Lesen zwar für wichtig, tun es aber immer weniger, heißt es hier. Jeder Vierte in Deutschland lese gar nicht. 27 Prozent aller Männer nie. Die bislang noch lesende Mittelschicht sei im Schwinden begriffen, lese, wenn überhaupt, nur noch aus Angst vor dem Abstieg - um Informationen zum Bestehen einer Prüfung zu sammeln. Kinder bekommen immer weniger Bücher geschenkt, noch weniger werden aufgeschlagen und gelesen. Und - nur 42 Prozent der Eltern unter dreißig Jahren sind der Meinung, dass die Lesefreude ihrer Kinder überhaupt beeinflussbar sei. Wenig überraschend gibt denn auch die Hälfte der 6- bis 13-Jährigen zu Protokoll, 'nie', 'gar nicht gern' oder 'nicht so gern' zu lesen. Die so wichtige Lesefreude, die Lust, wissen zu wollen, wie eine Geschichte ausgeht, die Motivati-on für alles, was an jahrelangem Lesetraining nötig ist, verspüren Kin-der immer weniger. Die Konsequenz des Lesefrustes springt einem dann beim Morgen-kaffee immer öfter in Form von Überschriften ins Gesicht: 'In Hamburg ohne Klassiker zum Abitur', 'Studenten verstehen abstrakte Texte nicht mehr', 'Unipräsident muss BWL-Studenten das Lesen erst wie-der lehren', 'Banker besuchen Lesekurse'. Zu den vier Millionen funktionalen Analphabeten, die nicht lesen können, so die ZEIT, gesel-len sich nun also auch noch jene, die es zwar können, aber nicht mehr wollen. Im Westen also nichts Neues? Die OECD warnt 2009: Lesekom-petenz ist heute wichtiger denn je. Nur wer gut lesen kann, wird in der modernen Gesellschaft systematisch begünstigt. Die Fähigkeit zu lesen beeinflusse direkt Einkommen, Arbeit und Gesundheit. Menschen mit geringer Lesekompetenz bräuchten mit erhöhter Wahrscheinlichkeit staatliche Unterstützung und würden eher krimi-nell. Kein Zweifel: Die Gesellschaft des digitalen Zeitalters rückt von der Buchkultur ab - und dieser Trend ist unwiderruflich auch bei den sozial Privilegierten angekommen. Bildungsferne Mittelschichten entstehen, in denen trotz guter materieller Verhältnisse kein Wert mehr auf klassi-sche Bildungsinhalte oder genussvolles Lesen gelegt wird. Hinzu kommt: Fünf Jahre nach Erscheinen dieses und vieler anderer Bücher zur Lesemotivation, nach Lesekampagnen mit und ohne Promis, Lesetagen im Rundfunk und Lesenächten in Schulen treffe ich immer noch - man mag es kaum glauben - auf Menschen, die sagen: 'Wie bitte? Wir sollen Jungen fördern? Wieso das denn?' Oder: 'Was? Jungen lesen weniger? Das war doch schon immer so', oder 'Ach ja, die mit Migrationshintergrund ...' Nein. Nein. Nein. Am liebsten möchte ich es über allen Marktplätzen ausrufen lassen: Die Formel Leseinkompetenz - Bildungsnot - Leistungsverweigerung - Lebensangst beschreibt schon lange nicht mehr nur Sprachschwie-rigkeiten von Jungen in sogenannten bildungsfernen Familien. Mal abgesehen davon, dass Migrantenkinder aus Familien mit hohen Bil-dungsabschlüssen sogar mehr Bücher lesen als deutsche - die Jun-genkrise ist über Haupt- und Realschulen längst hinausgewachsen und hat die Gymnasien voll erreicht. In der Zusammenfassung der PISA-III-Ergebnisse aus dem Jahr 2006 schreibt das Konsortium: 'In einer Reihe von (deutschen, KMW) Ländern hat sich die Lesekompe-tenz in den Gymnasien seit PISA I im Jahr 2000 tendenziell ver-schlechtert, in Niedersachsen sogar signifikant.'1 Auf meinen Lesereisen erlebe ich Deutschland partiell sehr unter-schiedlich. In Mönchengladbach, wohin ich im März 2010 zu einer Fortbildungsveranstaltung eingeladen wurde, spreche ich mit Biblio-thekaren und Lehrern, die ganz bewusst und kenntnisreich Sisyphos-arbeit am Kind leisten. Einfach toll. Der Erfahrungsaustausch mit solch engagierten Menschen macht Spaß. Einen Monat später, im nur 90 Kilometer entfernten Bonn, erlebe ich genau das Gegenteil. Lustlosig-keit. Pessimismus. Ignoranz. 'Das hat doch alles keinen Sinn!', er-klärte mir eine Gymnasialpädagogin um die Fünfzig. 'Außerdem geht mir das gegen den Strich, Jungen zu fördern.' Und jetzt? Nachlassende Lesekompetenz könnte nun auch an deutschen wei-terführenden Schulen durch Notennachregulierung im Zeugnis ver-tuscht werden. US-Professoren beklagen diesen Umstand seit Jahren, und zwar nicht nur an amerikanischen Highschools. Vergleichbares ist auch in Kanada und Großbritannien zu beobachten. Warum also sollte Deutschland von dieser Entwicklung verschont werden? Die gesamte G8-Diskussion setzt Lehrer einmal mehr gewaltig unter Druck und öffnet zudem all jenen Tür und Tor, die ohnehin schon meinen, Kinder in Deutschland würden überfordert. Gemessen am Potenzial, das Norman Doidge in seinem Buch Neustart im Kopf, aber auch Maryan-ne Wolf in Das Lesende Gehirn beschreiben, sind die zusätzlichen Belastungen, denen sich G8-Schüler und deren aufgebrachte Eltern momentan noch ausgesetzt sehen, eher Aufwärmübungen. Hier halte ich es mit den beiden oben genannten Autoren ebenso wie mit Dr. Bernhard Bueb, dem ehemaligen Leiter des Internates Salem, und ermuntere dazu, das Glück der Anstrengung wieder Stück für Stück kennen lernen zu wollen. Dieser Gedanke gilt übrigens für Gymnasiasten wie für alle anderen Schüler. Deutschen Schulabgängern fehlen immer öfter die Grundvor-aussetzungen für eine berufliche Ausbildung, meldet die Nachrichten-agentur Reuters am 8. April 2010 und bezieht sich auf eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, DIHK, unter 15?000 Unternehmen. Die Hälfte aller Betriebe organisiere inzwi-schen Nachhilfe, heißt es. Sie müssten ausbügeln, was Elternhaus, Schule und Gesellschaft in 16 Jahren Erziehung versäumt hätten. Dabei gehe es um Lesen, Schreiben, Rechnen und Sekundärtugenden wie Disziplin, Pünktlichkeit und Teamgeist. Wir können unseren Kindern nicht alle Schwierigkeiten abnehmen. Wir können ihnen aber dabei helfen, stark und belastbar zu werden. Wer in der Wissensgesellschaft sein Lebensglück finden möchte, braucht erstklassige Medien-, Informations- und Lesekompetenz - und dazu mehr denn je im Kern tägliches, angemessenes Lesetraining von frühester Kindheit an bis ins Erwachsenenalter hinein. Anfangs sind es Fühlbücher, dann Mal- und Bilderbücher oder Comics, später Zeitun-gen, Zeitschriften, Serien und Bücher zum Film und schließlich Roma-ne, Sachbücher oder elektronische Texte; alles zu seiner Zeit, stets verbunden mit unterschiedlichen Zielen hinsichtlich der erwünschten Medien- und Informationskompetenz. Folgen wir jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnissen, kann unser Gehirn viel mehr leisten als wir je angenommen haben: Es kann nicht nur bis ins hohe Alter komplexe Texte lesen und verstehen, ja Fremd-sprachen lernen, das Gehirn selbst wächst auch in seinem Potenzial über sich hinaus - vergrößert seine Kapazitäten, hält Gebildete be-sonders lang auch körperlich fit -, sofern wir zunehmend und anhal-tend lesen, unser Gehirn also fordern, ja regelrecht trainieren. Was für Aussichten auch für das Älterwerden, sofern wir biologisches Potenzial ausnutzen und uns wieder mehr disziplinieren wollen. Hinzu kommt (so belegen jüngste Forschungsergebnisse der Stanford University): Das Sprechen, Lesen und Schreiben einer Sprache prägt unsere Sicht auf die Welt. Lange war dies umstritten. Das Erlernen einer zweiten, vom Deutschen völlig verschiedenen Sprache wie Griechisch, Türkisch oder Chinesisch verändert nicht nur die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns, sondern auch die Art unseres Denkens.2 Die Aussage des Sprachphilosophen Ludwig Wittgenstein, 'Die Grenzen unserer Spra-che sind die Grenzen unserer Welt', erhält vor diesem Hintergrund neue Ladung. Als mich im Dezember 2009 Sabine Niemeier vom Campus Verlag anrief, um mit mir über eine Neuauflage von Warum Jungen nicht mehr lesen und wie wir das ändern können zu sprechen, ging es für mich nicht mehr um das 'ob', sondern nur noch um das 'wie'. Die Ideen im Gespräch mit meiner neuen Lektorin sprudelten: Was war seit 2005 passiert? Welche Erfahrungen hatte ich mit Eltern und Pädagogen und sie wiederum mit dem Buch gemacht? Hatten sich die von mir empfoh-lenen Konzepte in der Praxis bewährt? Waren die Bücher, die Jungen damals Jungen empfohlen hatten, heute noch aktuell? Oder gab es längst andere, die zum Lesen verführten? Es freut mich sagen zu können: Eines der wichtigsten Ergebnisse des Buches funktioniert bis heute: Die Kriterien für ein 'gutes Jungen-buch', das Muster, das Jungen motiviert, Texte und Bücher zu lesen, hatte sich in der Praxis bewährt. Nicht jeder Titel aus unserer reprä-sentativen Umfrage des Jahres 2004 funktionierte gleichermaßen gut, wie ich vor Ort von Lehrern und Schülern selbst erfuhr, aber die Mi-schung machte es. Insofern ist die Empfehlungsliste von Jungen für Jungen (Teil III) größtenteils nach wie vor aktuell. In Vorbereitung der Neuauflage haben wir die dort aufgelisteten Titel um weitere Empfeh-lungen aus Jungensicht ergänzt. Gymnasiasten in Hessen hatten sich bereiterklärt, Neuerscheinungen des Jahres 2010 zu lesen und zu kommentieren. Das Ziel dieser Buchtests bestand wieder darin, Jun-gen dort abzuholen, wo sie sich hinsichtlich ihrer Lesekompetenz selbst fühlen. Ich wollte sie werten lassen, nicht die Jungen in ihrer Lesekompetenz bewerten. Die Rezensionen der ergänzten Stichprobe vermitteln das Stim-mungsbild einer sogenannten 'guten Schule' mitten in Deutschland, genauer gesagt, der Anna-Schmidt-Schule in Frankfurt am Main. Deut-lich wird hier der Graben zwischen dem, was deutsche Feuilletonisten einerseits nach wie vor als erstrebenswert ansehen, und deren künfti-ge Leserschaft andererseits bereit ist, freiwillig zu lesen. Um diesen Graben zu schließen, braucht es Tausende zusätzlicher Lesetraining-stunden. Um nicht missverstanden zu werden, ich rede weder der einen noch der anderen Seite das Wort, wichtiger ist es mir, auf den nach wie vor gravierenden Unterschied zwischen Anspruch und Wirk-lichkeit aufmerksam zu machen, weil er Konsequenzen für unser aller Leben hat. Ebenfalls neu und auf Anregung von Eltern mit in die aktuelle Aufla-ge aufgenommen haben wir das Kapitel 'Wenn's die Gene sind' (Teil I.8.). Es beschäftigt sich mit der Frage, wie Eltern mit Kindern umge-hen sollten, die möglicherweise Legastheniker sind. Mein Ziel war es zunächst, ganz praktische Hilfestellung bei der Diagnose zu leisten. Begriffe wie 'Lese-Rechtschreib-Schwäche' (LRS) und 'Legasthe-nie' werden in deutschen Medien unscharf verwendet, was häufig zu Unsicherheiten (Verdrängung der Problematik einerseits beziehungs-weise übertriebene Fürsorge andererseits) führt. Legasthenische Kin-der haben es, wie wir später noch sehen werden, in Deutschland deut-lich schwerer als anderswo in Westeuropa, aber nicht alle, die als leseschwach wahrgenommen werden, haben Legasthenie. Wenn in einem 'gefragten' Gymnasium in Frankfurt am Main, kon-kret in der Wöhlerschule, 50 Prozent der Schüler eines Jahrgangs Schwächen wegen LRS nachgesehen werden, im gesamten Bundes-gebiet aber nach offiziellen Schätzungen nicht mehr als 10 Prozent der Kinder durchschnittlich betroffen sind, kann es natürlich sein, dass es hier tatsächlich fünfmal mehr Betroffenen gibt als anderswo. Mir scheint aber in diesem Zusammenhang die Frage durchaus berechtigt: Wie professionell ist die Diagnostik gewesen? Oder anders ausge-drückt: Könnte es sein, dass sich hier Lehrer dem Druck verunsicherter Eltern beugen? Noch einmal zurück zur Frage: Was war zwischen 2005 und 2010 geschehen? Seit Erscheinen des Buches wurde ich immer wieder zu Workshops und Vorträgen eingeladen - innerhalb und außerhalb Deutschlands: in den USA und in Belgien, in Österreich und in der Schweiz. Radio- und TV-Auftritte bei ARD und ZDF folgten. Die Buch-rechte wurden nach Korea verkauft ... doch das Wichtigste war: Ich verspürte immer mehr das Bedürfnis, praktisch etwas tun zu wollen, das der Misere entgegenwirkte - über das Reden und Schreiben für ein interessiertes Publikum hinaus. Irgendwann im Frühjahr 2006 überraschte mich der Anruf eines Buchhändlers aus Hannover. Otto Stender teilte mir begeistert mit: 'Wir nutzen übrigens ihr Buch als Arbeitsmittel. Das wollte ich Ihnen nur mal sagen.' Ich bedankte mich für die Blumen und fragte ge-spannt: 'Wer ist wir?' Er erzählte mir von einer Initiative, die er unmit-telbar nach PISA I ins Leben gerufen hatte, um Kindern Mentoren an die Seite zu stellen, die sie beim Lesen unterstützten. Genau das Prin-zip, das ich in all den Studien, die ich zur Lesekompetenzförderung durchgearbeitet hatte, als das nachhaltigste kennen lernte, war seines - das One-on-One-Prinzip: Ein Erwachsener betreut stets ausschließ-lich ein Kind. Spontan fragte ich ihn, ob ich seine gemeinnützige Initia-tive 'Mentor - die Leselernhelfer-Hannover e.?V.' unterstützen kön-ne. 'Natürlich', erwiderte er. 'In Hessen haben wir noch keine Mento-ren. Fangen Sie dort an.' Ich begann also mit sieben Freiwilligen. Heute sind wir bundesweit circa 4?000 aktive Mentoren, die jeden Tag dazu beitragen, Kindern - Deutschen wie Nichtdeutschen - beim Erwerb unserer Mutterspra-che zu helfen. Doch warum erwähne ich das? Als Vorsitzende des Bundesverbandes gehört es ganz sicher zu meinen Aufgaben, auf die gemeinnützige Initiative aufmerksam zu machen, und mehr zu 'Ottos Mission' finden Sie auch im gleichnamigen Kapitel 4. Doch es gibt noch einen anderen, für mich viel wichtigeren Grund: Durch diese Förderarbeit konnte und kann ich regelmäßig auf andere Art und Wei-se erfahren, was Kinder in Deutschland wirklich lesen wollen und welche Texte sie bewältigen. Wenn ein Kind in der sechsten Klasse nicht beschreiben kann, welche Kleidung ein Lehrer trägt, weil es Vokabeln wie Gürtel oder Hemd nicht kennt, oder nicht weiß, was ein Horizont ist; dann ist der Gedanke, Bücher lesen zu wollen, gar ver-schiedene sprachliche Ebenen zu genießen, schlicht unrealistisch. Noch einmal: Der Graben zwischen Anspruch und Wirklichkeit in Sa-chen Sprach- und Lesekompetenz ist viel größer als Eltern, vor allem aber kinderlosen Akademikern, bewusst ist, und er wird immer größer. Was also tun? Meine Art, Herausforderungen unterschiedlichster Qua-lität anzugehen, war von jeher lösungsorientiert. Und so möchte ich auch das Buch bis heute verstanden wissen. Dabei wurde ich gewarnt: Mit dieser Herangehensweise machst du dir unter Wissenschaftlern keine Freunde. 'Die zerreißen dich in der Luft', hörte ich Kollegen und Freunde immer wieder sagen. Die Befürchtung bestätigte sich in fünf Jahren nicht. Vielmehr war es nur konsequent, dem lebensweisen Rat von Professor Ring, dem früheren Dekan der Frankfurter Universität, zuletzt Geschäftsführer der Polytechnischen Gesellschaft in Frankfurt am Main, zu folgen und konsequent pragmatisch vorzugehen. Heute ist Ring im Ruhestand. Wenn ich es recht bedenke, war es gerade seine Ermunterung, die für mich entscheidend war, jahrelang am The-ma dran zu bleiben. Als Leiter der Stiftung Lesen sah er im Jahr 2003 den Leseinkompetenz-Zug in Deutschland bereits rollen. Gemeinsam, jeder auf seine Art, versuchen wir bis heute, seine Insassen zum Ab-sprung zu bewegen. Am meisten aber, so vermute ich, wird sich mein früherer Deutsch-lehrer Karl-Detlef Schmutzler über diese Neuauflage freuen. Über weite Strecken bis zum Abitur hatte er mich immer wieder mit überraschenden Gedanken aus der Leseecke ins Leben gelockt. Ihm verdanke ich nicht nur meine Liebe zu Büchern, sondern auch meinen unerschütterlichen Optimismus und den Mut zum Widerspruch. In der DDR war das beinah das Wichtigste, was ein Lehrer vermitteln konnte. Ich wollte ihm das immer schon mal sagen. Vielleicht liest er diese Zeilen ja und meldet sich unter www.warumjungennichtmehrlesen.de. Ich würde mich freuen. Viele Zuschriften sind über diese Webadresse an mich weitergelei-tet worden. Eltern, Lehrer, Pädagogen, Politiker und Studenten, die ihre Diplomarbeit schreiben, haben sich inzwischen gemeldet und tun dies noch. Nicht alle Zuschriften konnte und kann ich sofort beantwor-ten. Dafür bitte ich um Nachsicht. Danken möchte ich aber Ihnen allen für Ihr Interesse sowie Ihre Geduld im Umgang mit Kindern. Sie tun etwas, das in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern viel zu wenig Anerkennung findet, aber die größte Wertschätzung verdient. Sie sorgen sich um unser aller Zukunft, jeder für sich, jeden Tag, ohne dabei Schlagzeilen zu machen oder ins Fernsehen zu kommen. Stellvertretend für all jene, die diese wertvolle Erziehungsarbeit leis-ten, habe ich die E-Mail einer Mutter angefügt. Gemeinsam mit ihrem Mann fördert sie jeden Tag die Lesefreude ihrer Kinder. Katharina Eggenschwiler aus der Schweiz schrieb am 13.9.2009, 21.22 Uhr: Liebe Frau Müller-Walde, ich lese im Moment gerade Ihr Buch. Es begeistert mich, dass Sie schreiben, was meinen Erfahrungen mit meinen eigenen Söhnen, 11 und 15 Jahre alt, entspricht. Vielen Dank! Auch für die Buchtipps. Hier noch eine Frage ... Sie schreiben von den Warhammer-Regeln , die Ihr Sohn vereinfacht hat. Dies muss ja schon einige Jahre her sein, doch vielleicht existiert diese Fassung noch immer. Ist es möglich, davon eine 'Ausgabe' zu erhalten? Und dann ist da noch ... Tilman, unser Sohn, ist heute 22 Jahre alt und studiert Maschinenbau. Fünf Jahre nach Erscheinen von Warum Jungen nicht mehr lesen und wie wir das ändern können fällt mir zu ihm vor allem ein Satz ein: Es ist wunderbar zu sehen, wie Saat aufgeht. Katrin Müller-Walde, Juni 2010
| Erscheint lt. Verlag | 13.9.2010 |
|---|---|
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Bildung • Leseentwicklung Jungen • Leseerziehung • Leseförderung • Leseforschung • Lesekompetenz • Lesen • Lesen Ratgeber • Lesestörung • Lesestörung Jungen • Pädagogik |
| ISBN-10 | 3-593-41496-1 / 3593414961 |
| ISBN-13 | 978-3-593-41496-6 / 9783593414966 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 10,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich