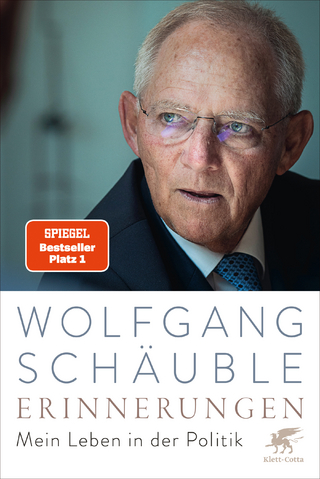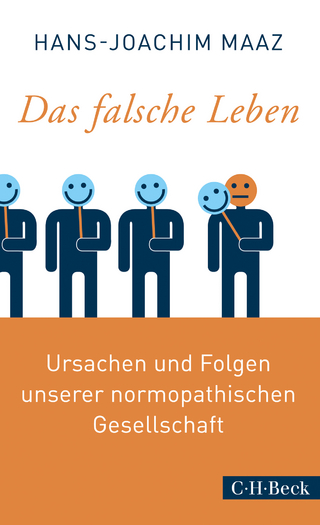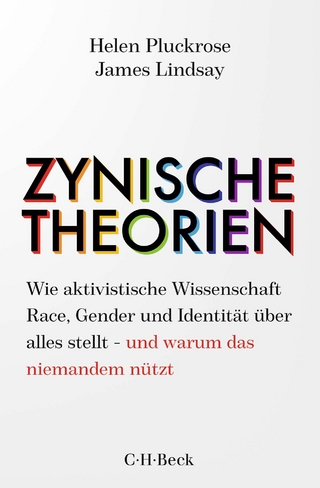Die Akten schließen
Campus (Verlag)
978-3-593-37885-5 (ISBN)
- Titel ist leider vergriffen;
keine Neuauflage - Artikel merken
Übergangsjustiz und erklärt, warum in manchen Fällen die Täter hart, in anderen sehr milde bestraft werden, und warum den Opfern mal großzügige, mal gar keine Entschädigungen zugestanden werden. Er beschreibt die Zwänge und Grenzen der Justiz, die Rolle von Emotionen und die Brüche und Kontinuitäten, die in der Politik zu beobachten sind. Nur selten, so sein Fazit, erfolgt freilich ein radikaler Wechsel der politischen Führungsschicht – ein Ergebnis, das zu denken gibt.
Jon Elster ist Robert Merton Professor of Social Science an der Columbia University.
Vorwort und Danksagung
Erster Teil: Das Universum transitionaler Justiz
1. Athen in den Jahren 411 und 403 v. Chr.
Die athenische Demokratie
Die erste Oligarchie und ihr Ende
Die zweite Oligarchie und ihr Ende
Lysias
Zusammenfassung
2. Die französischen Restaurationen von 1814 und 1815
Grenzen der Übergangsjustiz
Bestrafungen
Reparationen
Zusammenfassung
3. Weitere Fälle transitionaler Justiz
Wiederherstellung der Monarchie und Übergang zur Unabhängigkeit
Westeuropa und Japan
Südeuropa
Lateinamerika
Osteuropa
Afrika
Eine Klassifikation der Fälle
Zweiter Teil: Die Analyse transitionaler Justiz
4. Die Struktur transitionaler Justiz
Gerechtigkeit als Motivation
Institutionen der Gerechtigkeit
Ebenen transitionaler Justiz
Die Akteure transitionaler Justiz
Die Entscheidungen der Übergangsjustiz
5. Täter
Täterprofile
Rechtfertigungen mutmaßlicher Verbrechen
Ausflüchte und mildernde Umstände
6. Opfer
Materielles Leid
Persönliches Leid
Immaterielles Leid
Die Beweislast
7. Schranken
Die Beschränkungen ausgehandelter Regimewechsel
Der Fall Deutschland
Ökonomische Schranken transitionaler Justiz
Unvereinbare Forderungen
8. Emotionen
Emotion und Handeln
Emotion und der Wunsch nach Vergeltung
Die Vergeltungsemotionen
Die Umwandlung von Emotion
Zu wenig Schuldbewusstsein - oder zu viel?
9. Politik
Wahlpolitik
Ehemalige Nazis und Postkommunisten
Politische Ideologien und Übergangsjustiz
Anmerkungen
Literatur
Sachregister
Personenregister
Das Thema transitionaler Justiz beschäftigt mich auf die eine oder andere Weise schon seit langem. Ich will das an Hand von drei Begebenheiten deutlich machen. Am 10. April 2003, einen Tag nach der Eroberung Bagdads durch amerikanische Truppen, erhielt ich eine E-Mail von einem kanadischen Journalisten, der mir ein paar Fragen zur "Ent-Baathifizierung" im Irak stellen wollte. (Ich erklärte, die wichtigsten politischen Optionen seien Säuberungen, Gerichtsverfahren sowie die Einsetzung von Wahrheitskommissionen, wobei es in jedem dieser Fälle noch verschiedene Subvarianten gebe.) Eine der ersten Fragen, die einem zu Beginn des 21. Jahrhunderts durch den Kopf geht, wenn ein autokratisches Regime gestürzt wird, lautet denn auch: Wie kann man die Staatsführung zur Rechenschaft ziehen und dafür sorgen, dass sie künftig keinerlei Einfluss mehr nimmt? Zum anderen geht es natürlich auch darum, wie man ein neues und besseres Regime auf die Beine stellen kann. Und drittens schließlich ist zu fragen, wie man mit den Opfern des Regimes umgehen soll. Das vorliegende Buch beschäftigt sich in erster Linie mit den beiden rückblickenden Fragen: Wie reagieren Gesellschaften auf Verbrechen und Leid? Ich befasse mich zwar auch mit zukunftsgerichteten Themen wie dem wirtschaftlichen Wiederaufbau und der Ausarbeitung einer Verfassung, allerdings nur insoweit, als sie mit den vergangenheitsorientierten Fragen in Zusammenhang stehen. Ich versuche vor allem zu beschreiben und zu erklären, auf welch unterschiedliche Art und Weise Gesellschaften nach Regimewechseln ihre offenen Rechnungen aus der Vergangenheit begleichen. Indirekt kommen dabei jedoch auch normative Überlegungen ins Spiel, und zwar über die Vorstellungen von Gerechtigkeit und Fairness, von denen die Akteure des Übergangs beseelt sind und die in die Erklärung ihres Verhaltens einfließen. Meine eigenen normativen Ansichten mögen zwar mitunter durchschimmern, doch um sie soll es in diesem Buch nun wahrhaft nicht gehen. Meine Versuche, systematisch über diese Themen nachzudenken, reichen bis in den Juni 1990 zurück. Damals nahm ich an einer Konferenz im ungarischen Pécs teil, bei der es darum ging, wie man in Osteuropa neue Institutionen und Verfassungen schaffen sollte. Zwangsläufig stellten sich in diesem Zusammenhang auch Fragen zu Bestrafung und Reparation. In den Notizen, die ich mir anschließend machte, fasste ich die Diskussionen folgendermaßen zusammen: "Mehrere der anwesenden Politiker stimmten darin überein, dass es zu keinen Strafmaßnahmen kommen sollte außer gegen jene, die eindeutig Verbrechen (etwa das der Folter) begangen hatten. Die einzige brauchbare Lösung sei das ›spanische Modell‹ einer vollständigen Amnestie. Die damit verbundene Ungerechtigkeit sei der Preis, den man für die Demokratie zu zahlen habe. Der ehemalige ungarische Justizminister beharrte ganz besonders auf diesem Punkt. Wie er bemerkte, seien seit Mitte des 19. Jahrhunderts vierzehn ungarische Premierminister hingerichtet oder ins Exil getrieben worden; es sei an der Zeit, mit dieser Tradition einer hochgradig politisierten Justiz zu brechen. In Ungarn hatte eine Kommission damit begonnen zu untersuchen, woher der Reichtum hoher Amtsträger stammte. Etwa 4 500 Dossiers hatte man angelegt, doch nach einer Weile hörten die Nachforschungen auf. Seiner Ansicht nach waren sie eindeutig verfassungswidrig. Zwar war er selbst an den Gesprächen am Runden Tisch nicht beteiligt gewesen, doch glaubte er nicht, dass es dabei jemals um Bestrafung gegangen sei oder irgendwelche Amnestieversprechungen gemacht worden seien. In der DDR beruft sich die alte Führung gerne gerade auf die Prinzipien, gegen die sie selbst verstoßen hat. So hat sie beispielsweise ständig das Legalitätsprinzip verletzt (nulla crimen sine lege) und macht es nunmehr geltend gegen alle Versuche, sie vor Gericht zu bringen. Der polnische Senatspräsident vertrat die Ansicht, das Beispiel Polens sei von großer Bedeutung für den Übergang in der DDR gewesen, denn es habe gezeigt, dass es möglich war, "ruhig in der neuen Gesellschaft zu leben". (Das hatte ihm der ostdeutsche Botschafter zu verstehen gegeben.) Er berichtete weiter, der Sejm habe kürzlich entschieden, die Renten für Parteifunktionäre in normale Altersbezüge ohne besondere Privilegien umzuwandeln. Ein polnischer Rechtsprofessor vertrat die Ansicht, ehemalige Parteimitglieder könnten degradiert werden, beispielsweise vom Schulleiter zum einfachen Lehrer. Später kam man auf das Thema der Rektifikation zu sprechen, also die Rückgabe von Grund und Boden an diejenigen, die enteignet worden waren. Wiederum tendierte man allgemein dazu, sich gegen diese Form rückwärts gewandter Gerechtigkeit auszusprechen." Ich bin mir nicht sicher, ob über diese Vorstellungen damals wirklich so sehr Konsens herrschte, wie ich das notiert habe, doch wurden sie durch die anschließenden Entwicklungen mit Sicherheit nicht bestätigt (außer in gewissem Maße in Ungarn). Die spanische Lösung wurde nicht übernommen. In einigen Ländern kam es zu eingehenden Säuberungen in der öffentlichen Verwaltung. In mehreren Ländern erfolgte eine umfassende Restitution von Grundbesitz. Gerichtsverfahren freilich gab es nur wenige. Anhand eines früheren Regimewechsels will ich eine Erfahrung schildern, die das oftmals außergewöhnliche Klima in solchen Zeiten deutlich macht. Am 9. Mai 1945, einen Tag nach der deutschen Kapitulation, kehrte mein Vater aus Stockholm zurück, wo er die letzten Kriegsjahre verbracht hatte. Als er seinem Lieblingslokal im Zentrum von Oslo, dem Theatercaféen, einen Besuch abstattete, nahm ihn der Oberkellner beiseite und flüsterte ihm zu: "Herr Elster, in der Herrentoilette liegt ein toter deutscher Offizier. Könnten Sie mir helfen?" Irgendwie "entsorgte" mein Vater diesen Offizier. Ich war damals fünf Jahre alt und mir gar nicht bewusst, was das zu bedeuten hatte. In den Jahren nach dem Krieg konnte ich jedoch nicht mehr umhin zu bemerken, wie Menschen im öffentlichen und mitunter auch im Privatleben nach dem beurteilt, gewählt oder abgelehnt wurden, was sie während der deutschen Besatzung zu welcher Zeit getan oder nicht getan hatten. Wen im April 1940 Panik ergriffen hatte, den würde man nie wieder als völlig zuverlässig einschätzen, ganz gleich, wie er sich in den späteren Phasen des Krieges verhalten haben mochte. Die Erinnerung an die vielen Schattierungen des Defätismus und Opportunismus durfte nicht verblassen. Selbst die Kinder von Kollaborateuren hatten auf vielfache Weise zu leiden. In einem mir bekannten Fall erklärte eine Mutter ihren beiden Töchtern, es sei unpatriotisch, mit den Kindern eines verurteilten Nazi-Kollaborateurs zu spielen. Insofern stellen die rechtlichen und administrativen Verfahren, die den Kern dieses Buches bilden, nur den sichtbarsten Teil eines viel größeren Komplexes dar. Diese frühen Erinnerungen haben möglicherweise den Ansatz, den ich in diesem Buch verfolge, entscheidend geprägt. Zwar berücksichtige ich eine breite Palette von Fällen, von der griechischen Antike bis in die Gegenwart, doch gilt der Übergangsjustiz im Gefolge des Zweiten Weltkriegs meine besondere Aufmerksamkeit. Für diese Einseitigkeit (falls es sich denn um eine solche handelt) gibt es freilich auch noch einen anderen, weniger persönlichen Grund. Denn das Schicksal der Täter und Opfer des Holocaust bietet das herausragende historische Beispiel dafür, wie die Verbrechen eines Regimes vor Gericht verhandelt werden. Die Verbrechen des Stalinismus hatten möglicherweise ein ähnliches Ausmaß, doch die Täter mussten lediglich dafür bezahlen, indem sie selbst Opfer wurden. Wer nur Opfer war und nicht zunächst zum Kreis der Täter gehört hatte, erhielt nur eine geringe Entschädigung. Im Gegensatz dazu waren die strafrechtliche Verfolgung des NS-Regimes und die Entschädigung seiner Opfer zwar häufig unzureichend, doch erfolgten sie in einem nie dagewesenen und bislang nicht wieder erreichten Maße. Es spricht deshalb einiges dafür, diese Prozesse ausführlicher zu behandeln als andere (vor allem in den Kapiteln 5 und 6). Das vorliegende Buch hat weder eine Einleitung noch einen Schlussabschnitt. Würde ich über eine Theorie transitionaler Justiz verfügen, hätte ich diese natürlich zunächst dargelegt und abschließend bewertet. Da ich aber über keine derartige Theorie verfüge, erschien mir eine solch konventionelle Gliederung wenig brauchbar. Ich hoffe, dass die Leser, die sich geduldig an die Sichtung des von mir vorgelegten Materials machen, Themen finden, die ihren Interessen entsprechen. Moralphilosophen werden einige schwer wiegende Dilemmata entdecken, die ihrer Aufmerksamkeit bisher entgangen sind, und dazu angeregt, über die Rolle des Kontrafaktischen in moralischen Fragen nachzudenken. Rechtstheoretiker werden erkennen, dass sich hinsichtlich der Vorstellung, die Bestrafung müsse dem Vergehen entsprechen, ganz neue Schwierigkeiten ergeben. Politikwissenschaftler werden sehen, dass die Übergangsjustiz ein fruchtbares Untersuchungsfeld darstellt, wenn es darum geht, welche Rolle Emotionen in der Politik spielen. Historiker sind vielleicht überrascht, dass das Problem der "doppelten Eigentümerschaft" an Grund und Boden nach einem Regimewechsel in Athen 403 v. Chr., während der zweiten französischen Restauration und nach der deutschen Wiedervereinigung auf die gleiche Weise gelöst wurde. Ich schreibe somit vor allem für jene, die sich intellektuell durch gesellschaftliche Feinheiten und Nuancen anregen lassen und nicht nach dem umfassenden Bild verlangen; wäre ich der Ansicht gewesen, es gebe ein solches Bild, hätte ich ebenfalls danach gesucht. Meine ersten wissenschaftlichen Schritte auf diesem Feld unternahm ich unter der Anleitung von Gerhard Casper (der auf der Konferenz in Pécs ebenfalls zugegen war) am Center for the Study of Constitutionalism in Eastern Europe, das 1990 an der Law School der University of Chicago eingerichtet wurde. Später leistete Geoffrey Stone unermüdliche Arbeit für das Center. Meine dortigen Co-Direktoren Stephen Holmes, Wiktor Osiatynski und Cass Sunstein halfen mir dabei, die Beobachtungen, die ich auf mehreren Reisen in Osteuropa machte, besser zu verstehen. Später dann waren die Einsichten, die mir Vojtech Cepl, Rumyana Kolarova, Claus Offe und Andras Sajo zum Umbruch in Osteuropa vermittelten, von unschätzbarem Wert. Ihnen allen sei herzlich dafür gedankt. Diese Erfahrung veranlasste mich dazu, allgemeiner über das Phänomen der Übergangsjustiz nachzudenken. 1998/99 organisierte ich mit großzügiger finanzieller Unterstützung der Mellon Foundation ein Seminar an der Columbia University, das sich ein Jahr lang mit "rückwirkender Justiz" befasste (der Begriff der transitionalen oder Übergangsjustiz hatte sich damals noch nicht durchgesetzt). Die Vorträge dieses Seminars (sowie einige zusätzliche Beiträge) erscheinen unter dem Titel Retribution and Reparation in the Transition to Democracy als Begleitband zu diesem Buch. Etwa zur gleichen Zeit initiierten Hans Fredrik Dahl, Stein Ugelvik Larsen, Øystein Sørensen und ich ein Projekt, das vom norwegischen Forschungsrat finanziert wurde und sich mit der Übergangsjustiz in Norwegen 1945 befasste. Meinen Kollegen bei diesem Projekt danke ich für Diskussionen und Kommentare. Wertvolle Unterstützung leisteten zudem das Wissenschaftskolleg in Berlin sowie die norwegische Akademie der Wissenschaften. Mein besonderer Dank geht an Monika Nalepa für unschätzbare Hilfe bei den Forschungsarbeiten und für viele erhellende Diskussionen, an Avi Tucker für seine Hinweise zu einer früheren Fassung des Manuskripts sowie an zwei anonyme Kritiker für wertvolle Hinweise.
| Übersetzer | Andreas Wirthensohn |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Maße | 140 x 213 mm |
| Gewicht | 419 g |
| Einbandart | kartoniert |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Schlagworte | Demokratie • Deutschland • Diktatur • Frankreich • Griechenland (Antike) • HC/Sachbücher/Politik, Gesellschaft, Wirtschaft/Politik • Historische Soziologie • Irak • Politische Justiz • Politische Soziologie • Regimewechsel • Transformation (pol.) • Transformation (Politik) • Übergangsjustiz |
| ISBN-10 | 3-593-37885-X / 359337885X |
| ISBN-13 | 978-3-593-37885-5 / 9783593378855 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich