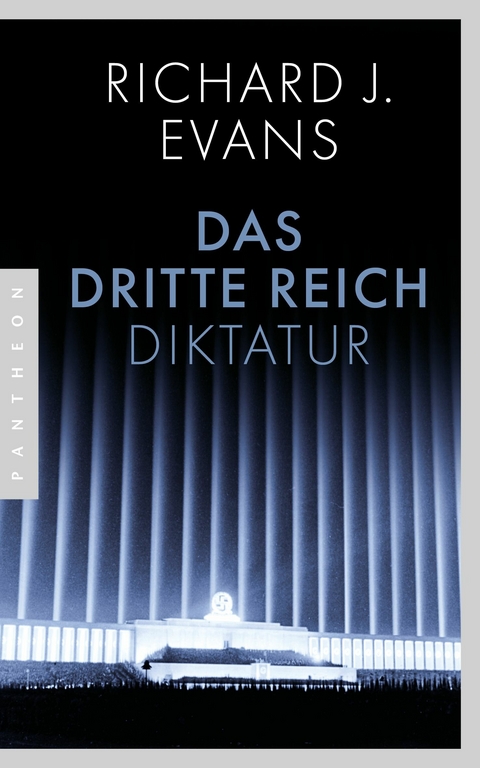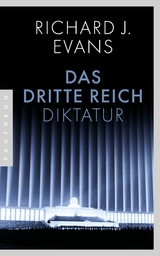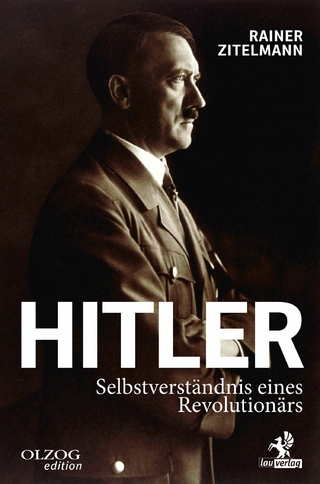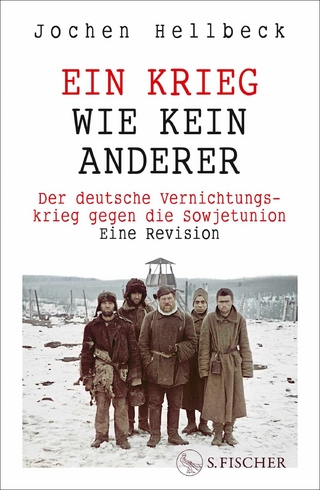Das Dritte Reich (eBook)
1542 Seiten
Pantheon Verlag
978-3-641-30695-3 (ISBN)
Im zweiten Band seiner monumentalen Trilogie zum Aufstieg und Fall des Dritten Reiches widmet sich Richard J. Evans den Anfangsjahren der Diktatur 1933 bis 1939. Vermeintlichen Erfolgen wie dem Rückgang der Arbeitslosigkeit, erkauft durch eine massive Aufrüstung, einem erstarkten nationalen Selbstbewusstsein und der gigantischen Selbstdarstellung des Dritten Reiches während der Olympischen Spiele 1936, steht eine Bilanz des Terrors gegenüber. Mit der Machtergreifung 1933 setzt ein gnadenloser innerer Krieg gegen Regimegegner, Randgruppen und Juden ein. Das System der Konzentrationslager wird errichtet, die Nürnberger Gesetze erlassen, und der Novemberpogrom 1938 ist ein Vorbote des Holocausts.
Richard J. Evans, geboren 1947, war Professor of Modern History von 1998 bis 2008 und Regius Professor of History von 2008 bis 2014 an der Cambridge University. Seine Publikationen zur deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und zum Nationalsozialismus waren bahnbrechend. Zu seinen Auszeichnungen zählen der Wolfson Literary Award for History und die Medaille für Kunst und Wissenschaft der Hansestadt Hamburg. 2012 wurde Evans von Queen Elizabeth II. zum Ritter ernannt. Zuletzt sind von ihm erschienen 'Das europäische Jahrhundert. Ein Kontinent im Umbruch - 1815-1914' (DVA 2018), 'Das Dritte Reich und seine Verschwörungstheorien' (DVA 2021) und 'Tod in Hamburg. Stadt, Gesellschaft und Politik in den Cholera-Jahren 1830-1910' (Pantheon 2022).
Prolog
I
Die Nationalsozialisten kamen in der ersten Jahreshälfte 1933 an die Macht, das Dritte Reich entstand auf den Trümmern des ersten Versuchs einer Demokratie in Deutschland, der unglücklichen Weimarer Republik. Bis zum Juli hatten die Nationalsozialisten praktisch alle wesentlichen Bestandteile des Regimes geschaffen, das Deutschland bis zu seinem Zusammenbruch fast zwölf Jahre später, 1945, beherrschen sollte. Sie hatten die offene Opposition auf allen Ebenen ausgeschaltet, einen Einparteienstaat ins Leben gerufen und alle wichtigen Institutionen der deutschen Gesellschaft mit Ausnahme der Reichswehr und der Kirchen »gleichgeschaltet«. Viele haben versucht zu erklären, wie es den Nationalsozialisten gelungen ist, innerhalb so kurzer Zeit eine solche Position der totalen Herrschaft über die deutsche Politik und Gesellschaft zu erringen. Ein Erklärungsmuster verweist auf seit langem bestehende Schwächen im deutschen Nationalcharakter, die dafür verantwortlich gemacht werden, daß die Deutschen der Demokratie ablehnend gegenüberstanden, bereitwillig rücksichtslosen Führern folgten und für die Parolen der Militaristen und Demagogen empfänglich waren. Doch wenn man auf das 19. Jahrhundert blickt, findet man hierfür kaum Belege. Liberale und demokratische Bewegungen waren nicht schwächer als in vielen anderen Ländern. Bedeutsamer war dagegen vielleicht die relativ spät erfolgte Schaffung eines deutschen Nationalstaats. Deutschland war, vor allem nach dem Zusammenbruch des Heiligen Römischen Reiches 1806, das tausend Jahre zuvor von Karl dem Großen ins Leben gerufen worden war – das berühmte tausendjährige Reich, das Hitler nachahmen wollte – zersplittert bis zu den von Bismarck provozierten Kriegen zwischen 1864 und 1871, die zur Bildung des später sogenannten Zweiten Reichs führten, an dessen Spitze der Kaiser stand. In vieler Hinsicht war dieses Deutsche Reich ein moderner Staat: Es hatte ein nationales Parlament, das im Unterschied etwa zu seinem Gegenstück in England nach einem allgemeinen Männerwahlrecht gewählt worden war; die Wahlbeteiligung lag bei über 80 Prozent, und die politischen Parteien waren gut organisiert und ein akzeptierter Bestandteil des politischen Systems. Die größte von ihnen am Vorabend des Krieges, die Sozialdemokratische Partei, zählte über eine Million Mitglieder und hatte sich der Demokratie, der Gleichheit, der Frauenemanzipation sowie der Bekämpfung der Rassendiskriminierung und -vorurteile einschließlich des Antisemitismus verschrieben. Die deutsche Wirtschaft war die dynamischste Europas und hatte die britische um die Jahrhundertwende eingeholt, und in den fortschrittlichsten Sektoren wie der Elektro- und der Chemieindustrie lag sie sogar fast mit den Amerikanern gleichauf. Um die Jahrhundertwende waren in Deutschland die Werte, die Kultur und der Lebensstil des Bürgertums tonangebend. Moderne Kunst und Kultur machten sich in den Bildern von Expressionisten wie Max Beckmann und Ernst Ludwig Kirchner, den Bühnenstücken von Frank Wedekind und den Romanen Thomas Manns bemerkbar.
Natürlich hatte das Kaiserreich auch seine Schattenseite. In manchen Bereichen blieben die Privilegien des Adels erhalten, die Befugnisse des Reichstags waren eingeschränkt, und die großen Industriellen standen ebenso wie ihre Pendants in den Vereinigten Staaten den Gewerkschaften der Arbeiter feindselig gegenüber. Bismarcks Verfolgung zunächst der Katholiken in den Jahren nach 1870 und dann der jungen Sozialdemokratischen Partei in den achtziger Jahren gewöhnte die Deutschen an die Vorstellung, daß die Regierung ganze Teile der Bevölkerung zu »Reichsfeinden« erklären und ihre bürgerlichen Freiheiten drastisch beschneiden konnte. Die Katholiken reagierten darauf, indem sie sich bemühten, sich stärker in das soziale und politische System zu integrieren, die Sozialdemokraten, indem sie sich strikt an das Gesetz hielten und die Idee eines gewaltsamen Widerstandes oder einer gewaltsamen Revolution verwarfen, beides Verhaltensweisen, an die 1933 mit katastrophalen Folgen wieder angeknüpft werden sollte. In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts kamen auch extremistische Parteien und Bewegungen auf, die behaupteten, das Reichseinigungswerk Bismarcks sei unvollständig, da Millionen ethnischer Deutscher noch immer außerhalb des Reiches lebten, vor allem in Österreich, aber auch in vielen anderen Teilen Mittel- und Osteuropas. Während einige Politiker forderten, Deutschland brauche ein großes Kolonialreich in Übersee wie die Engländer, begannen andere, aus den Ressentiments des Kleinbürgertums Kapital zu schlagen: die Angst der kleinen Ladenbesitzer vor den Warenhäusern, die Befürchtungen der männlichen Angestellten angesichts der zunehmenden Zahl weiblicher Angestellter oder die Verstörung von Bürgerlichen gegenüber expressionistischer und abstrakter Kunst sowie anderer beunruhigender Wirkungen der stürmischen sozialen, ökonomischen und kulturellen Modernisierung Deutschlands. Solche Gruppen fanden ein leichtes Ziel in der winzigen jüdischen Minderheit Deutschlands. Die deutschen Juden konstituierten nicht mehr als 1 Prozent der Bevölkerung, und viele von ihnen waren in der deutschen Gesellschaft und Kultur seit ihrer Emanzipation von den gesetzlichen Beschränkungen im Lauf des 19. Jahrhunderts erstaunlich erfolgreich. Für die Antisemiten waren die Juden die Ursache aller ihrer Probleme. Sie verlangten, die bürgerlichen Freiheiten für die Juden einzuschränken und ihre wirtschaftlichen Aktivitäten zu beschneiden. Sehr bald verloren bürgerliche Parteien wie das Zentrum und die Konservativen Stimmen an antisemitische Splitterparteien. Sie reagierten darauf, indem sie in ihre Programme das Versprechen aufnahmen, den angeblich zersetzenden Einfluß der Juden in der deutschen Gesellschaft und Kultur einzudämmen. Zur gleichen Zeit verbreiteten in anderen Bereichen der Gesellschaft Sozialdarwinisten und Eugeniker die Behauptung, die deutsche »Rasse« müsse gestärkt werden, indem man die christliche Achtung vor dem Leben aufgebe und die Schwachen, die Behinderten, die Kriminellen und die Geisteskranken sterilisiere oder töte.
Solcherlei Ideen und Denkweisen hegte vor 1914 nur eine kleine Minderheit, und es gab auch noch niemanden, der sie in einem kohärenten System zusammengefaßt hätte. Der Antisemitismus war in der deutschen Gesellschaft zwar weitverbreitet, aber offene Gewalt gegen Juden war die Ausnahme. Der Erste Weltkrieg änderte das. Im August 1914 begrüßten jubelnde Menschenmengen den Kriegsausbruch auf den zentralen Plätzen der deutschen Großstädte, so wie sie es auch in anderen Ländern taten. Der Kaiser erklärte, von nun an kenne er keine Parteien mehr, sondern nur noch Deutsche. Das Augusterlebnis wurde zu einem mythischen Symbol der deutschen Einheit, so wie das Bild Bismarcks eine mythische Sehnsucht nach einem starken und entschlossenen Führer heraufbeschwor. Die militärische Pattsituation, zu der es 1916 gekommen war, hatte zur Folge, daß die weitere Führung des Kriegs in die Hände von zwei Generälen gelegt wurde, die bedeutende Siege an der Ostfront errungen hatten, Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff. Es herrschte von da an quasi eine Militärdiktatur der Obersten Heeresleitung. Doch trotz ihrer straffen Organisation der Kriegsanstrengungen und ihrer Ausübung einer quasi-diktatorischen politischen Macht hatte das Kaiserreich den mächtigen Vereinigten Staaten, die 1917 in den Krieg eingetreten waren, nichts mehr entgegenzusetzen, und Anfang November 1918 war der Krieg verloren.
Die Niederlage im Ersten Weltkrieg hatte für Deutschland verheerende Folgen. Die Friedensbedingungen, die freilich kaum härter waren als die Bedingungen, die Deutschland im Fall seines Sieges seinen Gegnern auferlegen wollte, wurden von fast allen Deutschen mit Erbitterung aufgenommen. Zu den Forderungen gehörten umfangreiche finanzielle Reparationen für die Schäden durch die deutsche Besetzung Belgiens und Nordfrankreichs, die Zerstörung der deutschen Kriegsmarine und Luftwaffe, die Beschränkung des stehenden Heeres auf 100000 Mann und das Verbot moderner Waffen wie Panzer, die Abtretung von Territorium an Frankreich und vor allem an Polen. Der Krieg hatte auch die internationalen Wirtschaftsbeziehungen zerstört, und die Weltwirtschaft sollte sich in den folgenden 30 Jahren davon nicht mehr erholen. Nicht nur daß enorme Summen bezahlt werden mußten, der Zusammenbruch des Habsburgerreiches und die Schaffung neuer, unabhängiger Staaten in Mittel- und Osteuropa leisteten nationalen Egoismen Vorschub und machten eine internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit unmöglich. Insbesondere Deutschland hatte den Krieg mit gedruckten Banknoten und Kriegsanleihen bezahlt in der Erwartung, die Schulden durch die Annexion belgischer und französischer Industriegebiete sowie durch Reparationen zurückzahlen zu können. Die geforderten Reparationen konnten ohne Steuererhöhung nicht bezahlt werden, und keine deutsche Regierung war hierzu bereit, weil sie sonst von ihren Gegnern beschuldigt worden wäre, sie wolle mit deutschen Steuergeldern die Franzosen bezahlen. Das Ergebnis war eine Inflation. 1913 stand der Dollar bei 4 Papiermark; Ende 1919 stand er bei 47, im Juli 1922 bei 493 und im Dezember 1922 bei 7000 Mark. Die Reparationen mußten in Gold und Handelsgütern bezahlt werden, und bei dieser Inflationsrate waren die Deutschen weder willens noch in der Lage, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Im Januar 1923 besetzten belgische und französische Truppen das Ruhrgebiet und begannen mit der Demontage und dem Abtransport von Industrieanlagen. Die deutsche Regierung stellte daraufhin alle Reparationszahlungen ein und forderte die Bevölkerung zu passivem Widerstand auf. Jetzt begann, mit ausgelöst durch die Finanzierung des...
| Erscheint lt. Verlag | 10.8.2023 |
|---|---|
| Übersetzer | Udo Rennert |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | The Third Reich in Power |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► 20. Jahrhundert bis 1945 |
| Schlagworte | 2023 • 2. Weltkrieg • Antisemitismus • das dritte reich: aufstieg • das dritte reich: krieg • das dritte reich und seine verschwörungstheorien • Deutschland • Diktatur • Drittes Reich • eBooks • Faschismus • Geschichte • Gleichschaltung • Hitler • Holocaust • Nationalsozialismus • Neuerscheinung • Politische Ideologie • Rassismus • Standardwerk • tod in hamburg • Totalitarismus • Volksgemeinschaft • Weltkrieg • Zweiter Weltkrieg |
| ISBN-10 | 3-641-30695-7 / 3641306957 |
| ISBN-13 | 978-3-641-30695-3 / 9783641306953 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich