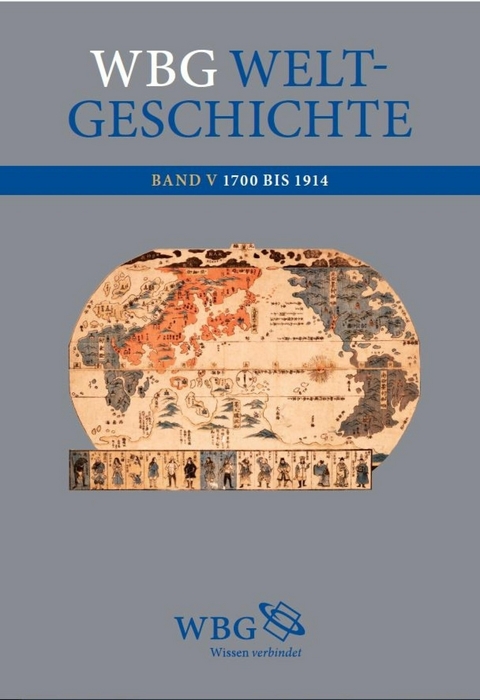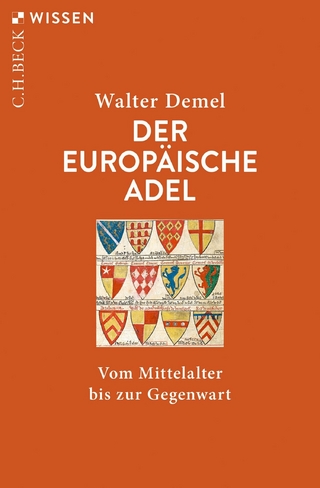wbg Weltgeschichte Bd. V (eBook)
509 Seiten
wbg Academic (Verlag)
978-3-534-74043-7 (ISBN)
Die Herausgeber: Johannes Fried, geb. 1942, ist Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Walter Demel, geb. 1953, ist Professor für die Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität der Bundeswehr in München. Ernst-Dieter Hehl, geb. 1944, seit 1998 apl. Professor, ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Albrecht Jockenhövel, geb. 1943, war bis zu seiner Emeritierung 2008 Professor für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Gustav Adolf Lehmann, geb. 1942, ist Professor für Alte Geschichte und Direktor des Althistorischen Seminars der Georg-August-Universität Göttingen. Helwig Schmidt-Glintzer, geb. 1948, ist Sinologe und seit 1993 Direktor der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel.
Die Herausgeber: Johannes Fried, geb. 1942, ist Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Walter Demel, geb. 1953, ist Professor für die Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität der Bundeswehr in München. Ernst-Dieter Hehl, geb. 1944, seit 1998 apl. Professor, ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Albrecht Jockenhövel, geb. 1943, war bis zu seiner Emeritierung 2008 Professor für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Gustav Adolf Lehmann, geb. 1942, ist Professor für Alte Geschichte und Direktor des Althistorischen Seminars der Georg-August-Universität Göttingen. Helwig Schmidt-Glintzer, geb. 1948, ist Sinologe und seit 1993 Direktor der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel.
Demographische Revolution – Die Geschichte der Weltbevölkerung
Georg Fertig
Demographie und Geschichte
Es ist kein Zufall, dass die Demographie in einer Weltgeschichte ein eigenes Kapitel einnimmt, und zwar besonders in dem Band, der sich mit der Entstehung der Moderne befasst. Die demographischen Entwicklungen dieser Epoche sind ziemlich gewichtig. Sie sind aber auch im Verhältnis zu anderen Aspekten der Geschichte etwas Eigenes. Demographie ist viel weniger als die Geschichte der Staaten und Gesellschaften, des Wissens und des Glaubens einem verstehenden und interpretierenden Blick zugänglich, auch wenn ihre Auswirkungen auf all diese Bereiche nicht zu ignorieren sind. Was man von der Historischen Demographie nicht erwarten sollte, ist, dass sie auf Grund der sehr persönlichen Daten, die sie verarbeitet (Namen, Geburts-, Heirats- und Todesdaten) und mit Hilfe geheimnisvoller Methoden irgendwie die Menschen in ihrem Kern und in allem, was ihnen wirklich wichtig war, erfasst und so den vielen von der politischen Geschichte nicht zum Sprechen gebrachten Menschen ein eigenes Gesicht und eine Stimme in der Geschichte gibt. In der Demographie geht es zunächst einmal nur um das blanke Präsent-Sein von zählbaren Menschen. Dazu gehören auch die Fragen, wie es zu diesem Präsent-Sein kommt (Kinder werden gezeugt, Zuwanderer kommen ins Land), wie es sein Ende findet (durch Abwanderung und Tod) und was für Konsequenzen das Präsent-Sein von Menschen hat – es kann nämlich ebenso gut das Blühen aufstrebender Landstriche anzeigen, wie es drangvolle Enge verursachen kann.
Untersuchung der Präsenz von Menschen
Präsent-Sein mag ein trockenes und sperriges Thema sein, aber ohne Menschen gibt es keine Geschichte, ohne Geburt und Tod keinen Lebenslauf, ohne Familien keine Wirtschaft. Die eigentümlichen Methoden der Demographie – bei denen es im Kern um mathematische Eigenschaften nicht der Individuen, sondern von Kohorten gleichzeitig geborener Menschen über die Zeit hinweg geht – bieten dabei eine Chance, die Ebenen des Einzelnen und des Kollektivs auf eine spezielle Art zu verbinden. Es geht hier nämlich nicht darum, dass das Einzelschicksal multipliziert mit Hundert oder mit einer Milliarde eben eine sehr große Zahl ergibt. Vielmehr hat das Vorhandensein der Hunderte oder Milliarden in einem bestimmten Raum (oder auch ihre kollektive Lebenserwartung und Fruchtbarkeit) Konsequenzen für die Einzelnen: Wo niedrige Lebenserwartung und niedrige Fruchtbarkeit vorwiegen, haben die meisten Menschen nur wenige Verwandte; wo die Bevölkerung wächst, kann es zum Verfall der Arbeitslöhne kommen; wo der Anteil der arbeitsfähigen Jahrgänge gering ist, muss man darüber nachdenken, wie die Gesellschaft Transferleistungen für die Alten und die Jungen organisiert. Mit der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte ist die Demographie also eng verbunden.
Demographie und Kultur
Da es bei der Demographie nicht nur um das Zustandekommen der Bevölkerungszahl geht, sondern auch um ihre Konsequenzen, hat sie letztlich aber auch ganz erhebliche Implikationen für die Kulturgeschichte – nicht, wie es die ältere Forschung in nur selten gelingender Weise versucht hat, in der Art, dass aus der Zuständigkeit der Historischen Demographen für das Thema Heirat auch eine Expertise für das Thema Liebe und Emotion erwüchse, aus ihrer Zuständigkeit für illegitime Geburten eine Expertise für das Thema der Sexualität oder aus ihrer Zuständigkeit für das Thema Tod eine Expertise für die Frage der Kunst des Sterbens. Zu Liebe und Tod können wir bei Theologen, Soziologen und Literaturwissenschaftlern oft Kompetenteres anstelle solcher „demographischer Psychologie“ lesen. Es ist aber so, dass die Bevölkerung – vom Einzelnen aus betrachtet – immer aus anderen Menschen besteht, die auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen werden. Diese Wahrnehmungen werden ganz besonders dort akut, wo jemand kommt oder geht. Demographische Ereignisse und Strukturen stellen also Bruchlinien dar, an denen in historisch unterschiedlicher Weise „demographische Konflikte“ auftreten. Heute sind bei uns Zuwanderung, Altersversorgung, Abtreibung und Sterbehilfe solche aktuellen, heißen Themen. Im Übergang zur Moderne stritt man eher über Familiengründung, Abwanderung und die Verantwortung für Kinder. Historische Demographie hat also auch viel damit zu tun, Wahrnehmungen und Regulierungen an diesen Bruchlinien zu untersuchen. Hierin und nicht in der nur scheinbar aufregenden Geschichte von Sex und Tod liegt ihre kulturhistorische Relevanz.
Veränderungen und große Zusammenhänge
Zwischen 1750 und 1914 wuchs die Weltbevölkerung von 720 auf 1825 Millionen Menschen. Die Weltbevölkerung wurde aber nicht nur zahlreicher, sondern auch europäischer und amerikanischer, während die Anteile des großen Asien und Afrikas zurückgingen. In derselben Zeit kam es in den westlichen Ländern zu zwei fundamentalen demographischen Vorgängen: zum Entkommen aus der „malthusianischen Falle“ und zum demographischen Übergang. Beide haben mit diesem zunehmenden Gewicht des Westens zu tun und blieben nicht auf die westlich-nordatlantische Welt beschränkt.
Ausbruch aus der „malthusianischen Falle“
Mit dem Begriff der „malthusianischen Falle“ wird ein Grundproblem praktisch aller Gesellschaften der Vormoderne bezeichnet: Tendenziell blieb wirtschaftlicher Fortschritt, auch wenn er möglich war, nutzlos, denn dort, wo mehr Produkte – vor allem Lebensmittel – hergestellt wurden, konnten auch mehr Menschen überleben. In der Vormoderne führte Bevölkerungswachstum stets zu einem Verfall der Löhne und Anstieg der Lebensmittelpreise, und hohe Preise hatten Hungerkrisen und erhöhte Sterblichkeit zur Folge. Im linken Teil von Grafik 1 kann man diesen Zusammenhang für England klar sehen: Auf der horizontalen Achse ist der Reallohn seit dem 14. Jahrhundert eingetragen, auf der linken vertikalen die Bevölkerungsgröße. Die einzelnen mit einer durchgezogenen Linie verbundenen Punkte bestehen jeweils aus den für bestimmte Zeitpunkte oder Zeiträume ermittelten gleichzeitigen Werten von Reallohn und Bevölkerungsgröße. In England galt bis ins 17. Jahrhundert: Je größer die Bevölkerung, desto geringer der Reallohn. Danach (rechter Teil der Grafik) begann der Reallohn trotz etwa gleichbleibender Bevölkerung anzusteigen, und ab etwa 1800 kletterten sogar beide – Bevölkerung und Reallöhne – gleichzeitig. Ein ähnliches Umkippen des Fundamentalzusammenhanges von Bevölkerung und Reallohn ist auch in anderen Ländern, etwa in Deutschland, beobachtet worden, nur dass dieser Prozess dort später einsetzt.
Verteilung der Weltbevölkerung um 1750
(nach: Dupâquier/Bardet 1998, Nordamerika korrigiert nach Ubelaker 1988).
Verteilung der Weltbevölkerung um 1914
(nach: Dupâquier/Bardet 1998 und nach Maddison 2001).
Grafik 1: Reallohn und Bevölkerung in England (Reallöhne von Londoner Bauarbeitern nach Allen 2001 [Gramm Silber pro Tag, dividiert durch in Gramm Silber bemessene Kosten eines Warenkorbs lebensnotwendiger Güter in Straßburg um 1745–1754]; Bevölkerung nach Clark 2007a).
Den als malthusianische positive checks fungierenden Hungerkrisen konnten Bevölkerungen durch den preventive check entgehen, wenn sie gar nicht erst so stark anwuchsen und stattdessen weniger Kinder zur Welt kamen. Das konnte dann zu einem dauerhaft höheren Pro-Kopf-Einkommen führen – jedoch nur in begrenztem Maße, denn bis zum Aussterben konnte man diese Strategie nicht gut treiben. Anders als ein verändertes Heirats- und Geburtenverhalten konnte technologischer Fortschritt das Einkommensniveau jedoch nicht dauerhaft anheben; er führte unweigerlich zu mehr Überlebenden und damit wieder zu demselben Pro-Kopf-Einkommen für eine gewachsene Bevölkerung. Dieser theoretisch und empirisch bis in die Frühe Neuzeit gut belegbare Zusammenhang brach zwischen 1700 und 1800 zunächst in England auf. Männer und Frauen heirateten jünger und blieben seltener ledig, die Bevölkerungszahl nahm zu, aber die Preise stiegen nicht mit an, und die Durchschnittseinkommen wuchsen mit einiger Verzögerung, anstatt zusammenzubrechen. Hierin besteht die demographische Seite dessen, was auch in der neuesten Forschung zur globalen Wirtschaftsgeschichte (etwa bei Robert Allen und Jan Luiten van Zanden) als Industrielle Revolution bezeichnet wird. Sie bedeutete einen fundamentalen Bruch in der Wirtschaftsgeschichte: Aller ökonomischer Fortschritt in den Jahrhunderten zuvor war immer wieder von zusätzlichen Menschen mehr oder weniger aufgezehrt worden, nur die Handelsgewinne und Innovationen seit dem 17. und 18. Jahrhundert nicht. Dafür, von einer bloßen „Industrialisierung“ zu sprechen, gibt es gewiss gute Argumente – die Weltgeschichte kennt viele regionale Industrialisierungen und „Proto-Industrialisierungen“ von epochal eingeschränkter Bedeutung (s. dazu auch das folgende Kapitel). Der grundlegende Bruch im Systemzusammenhang von Wirtschaft und Bevölkerung, der zwischen dem 17. und dem...
| Erscheint lt. Verlag | 1.1.2016 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Allgemeines / Lexika |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte | |
| Schlagworte | "Antike • Antike • Geschichte • Menschheitsgeschichte • "Mittelalter • Mittelalter • Nachschlagewerk • Neuzeit • Weltgeschichte |
| ISBN-10 | 3-534-74043-2 / 3534740432 |
| ISBN-13 | 978-3-534-74043-7 / 9783534740437 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich