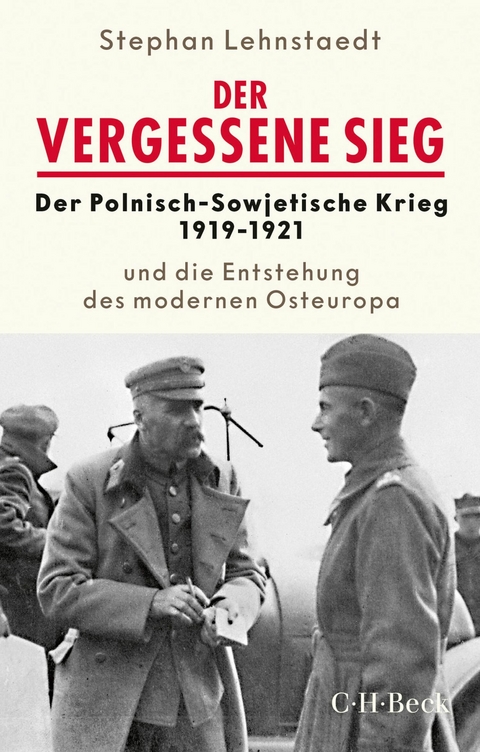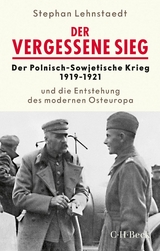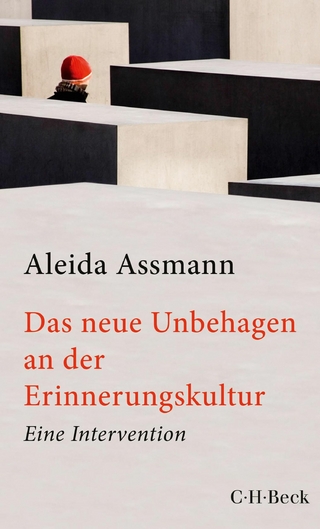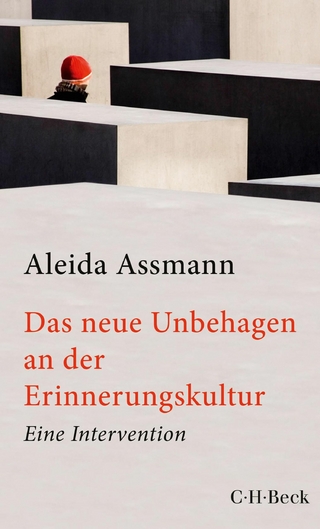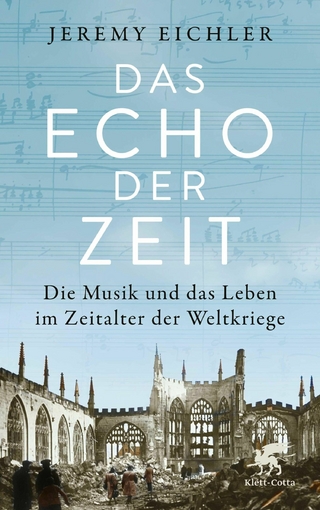Der vergessene Sieg (eBook)
221 Seiten
C.H.Beck (Verlag)
978-3-406-74023-7 (ISBN)
Stephan Lehnstadt ist Professor für Holocaust-Studien und Jüdische Studien am Touro College Berlin.
Cover 1
Titel 3
Impressum 4
Inhalt 5
Prolog 7
1. Osteuropa am Ende des Ersten Weltkriegs 13
2. Das lange Jahr 1919 22
3. «Miedzymorze» – Zukunftsvorstellungen für ein Polen «zwischen den Meeren» 36
4. Die Ukraine: Aufgerieben zwischen Polen und Russland 54
5. Expedition nach Kiew 72
6. Die Rote Armee marschiert nach Warschau 81
7. Zwischen allen Fronten: Juden und andere Zivilisten 95
8. Die Schlacht um Warschau 115
9. Helden und Versager: Der Pilsudski-Mythos und die Schuldzuweisungen in der Sowjetunion 127
10. Die Flucht der Roten Armee und die letzten Kämpfe um ein polnisches Imperium 137
11. Der Friedensvertrag von Riga 150
12. Bewunderer und Revisionisten – Das Erbe des Krieges 162
13. Der Polnisch-Sowjetische Krieg heute 180
Dank 185
Anmerkungen 187
Archivalien 205
Literaturverzeichnis 206
Bildnachweis 214
Karten 219
Prolog
Am Anfang steht ein weltgeschichtlicher Zusammenbruch. Am Ende zwei Wiedergeburten. Aber der Reihe nach, von einem Ende zum anderen.
Die Februarrevolution 1917 setzte einen Schlusspunkt unter die jahrhundertelange Herrschaft der russischen Zaren. Nikolaus II. dankte am 2. März ab, danach amtierte eine provisorische Regierung. Sie konnte sich nur kurz halten, denn schon ein halbes Jahr später nahm die Oktoberrevolution ihren Lauf und brachte die Bolschewiki an die Macht – weil Deutschland im April den Berufsrevolutionär Wladimir Iljitsch Lenin aus seinem Schweizer Exil nach St. Petersburg geschickt hatte, um den Ersten Weltkrieg im Osten zu entscheiden.[1] Einen anderen Berufsrevolutionär aus Russland, den Polen Józef Piłsudski, steckten die Mittelmächte im Juli 1917 in Magdeburg in Festungshaft: Weil Russland implodiert war, hatte die Zusammenarbeit mit Polen deutlich an Bedeutung verloren.
In jenem Sommer 1917 lagen ihre größten Tage noch vor Lenin und Piłsudski. Für Lenin kamen sie bereits im Oktober, Piłsudski musste ein Jahr länger warten, denn erst das Kriegsende und die Niederlage der Mittelmächte brachten im November 1918 die Wiedergeburt Polens und ihm eine triumphale Rückkehr nach Warschau. Völlig unklar war zu diesem Zeitpunkt allerdings, wie der Staat aussehen sollte, dessen Oberhaupt er nun war, denn mit allen Nachbarn gab es Konflikte um die Grenzen. In Moskau stellte sich die Situation für die «Roten» nicht viel anders dar: Konterrevolutionäre «weiße» Einheiten bedrängten sie aus allen Himmelsrichtungen. Und selbst wenn es gelingen sollte, diese Angriffe zu überleben, stellte sich immer noch die Frage nach dem Verhältnis zu denjenigen neuen Ländern, die auf bisher zarischem Gebiet wie Pilze aus dem Boden schossen – alleine sieben davon im Westen: Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Belarus, die Ukraine und Polen.
Unter ihnen erwies sich Polen sehr schnell als der dominante Akteur. Eine von erfahrenen Offizieren organisierte Armee und ein Staatswesen, das unmittelbar aus den von den Mittelmächten vor 1918 errichteten Strukturen hervorging, erlaubten eine außenpolitische Handlungsfähigkeit, die weit über bloße Diplomatie hinausging. In der politischen Debatte setzte sich Józef Piłsudski gegen seine Rivalen durch: Polen sollte als Land zwischen Ostsee und Schwarzem Meer wiederentstehen und an die glorreiche Geschichte dieser Rzeczpospolita des 17. Jahrhunderts anknüpfen. In der Frühen Neuzeit war sie der größte Staat Europas gewesen, bis sie Preußen, Russland und Österreich in drei Etappen 1772, 1793 und 1795 unter sich aufteilten. Von dieser alten Herrlichkeit längst vergangener Zeiten schwärmte Piłsudski, er träumte von Wilna und Lemberg, ja sogar von Minsk und Kiew – und würde diese Städte binnen weniger Monate tatsächlich erobern.
Noch 1918 traten Polen, die Bolschewiki, Litauen und die Ukraine gegeneinander an. Hier kämpften keine Besiegten,[2] sondern Gewinner gegeneinander. Der Untergang der Monarchien der Habsburger, Romanows und Hohenzollern ermöglichte erst ihre Nationen und ihre politischen Projekte. Aber deshalb fand der Erste Weltkrieg im Osten sein Ende nicht im November 1918, sondern setzte sich bis 1921 fort.
Die Banner, unter denen gekämpft wurde, waren neu. Die Soldaten blieben die alten. Abgesehen von einigen enthusiastischen Freiwilligen waren es ausgezehrte Männer, völlig unzureichend ausgerüstet und müde von vier Jahren Krieg, erschöpft wie die Länder und ihre Menschen. Aber endlich ging es um die eigene Sache, nicht mehr um den Konflikt überlebter Imperien, die die Region viel zu lange beherrscht hatten. In dieser Hinsicht war 1918 eine Zäsur – und stellte abermals einen Unterschied zum Westen dar, wo die Waffen schwiegen und die Staaten weiter existierten.
Das Jahr 1919 sah das Ende der ukrainischen Staatlichkeit, sah polnische Truppen in Minsk, Wilna und Lemberg, aber zunächst nur Geplänkel mit sowjetischen Einheiten. 1920 brachte einen Bewegungskrieg an einer über tausend Kilometer langen Front. Die Polen nahmen Kiew – und trugen so dazu bei, dass viele «Weiße» nun die Reihen mit den Bolschewiki schlossen, um das Vaterland zu verteidigen. Daraufhin ging die Rote Armee zum Gegenangriff über, trieb die Polen in nur acht Wochen 500 Kilometer nach Westen. Es waren die letzten glorreichen Tage der Kavallerie und zugleich die ersten Vorboten des modernen Bewegungskriegs mit Panzern und Flugzeugen. Der Fall Warschaus schien sicher, ein Weitertragen des Bolschewismus bis nach Deutschland auf einmal gar nicht mehr unvorstellbar. Aber der entscheidende Schlag misslang, Piłsudski glückte mit knapper Not ein Sieg, der als «Wunder an der Weichsel» in die Geschichte eingehen sollte. Der sowjetische Traum von der Weltrevolution war ausgeträumt, Lenin musste die Doktrin vom «Kommunismus im eigenen Land» entwickeln.
Und dann ein Friedensschluss im neutralen Riga. Kein Sieg für Polen, viel weniger Landgewinn als erhofft, aber auch keine Niederlage. Die neue Republik war nicht kommunistisch geworden. Doch sie stand alleine gegen die 1922 gegründete Sowjetunion: Eine Ukraine gab es nicht mehr, Belarus war sowjetisch, Litauen verfeindet. Der ukrainische Fall war besonders tragisch, denn unter Symon Petljura existierte dort eine große antibolschewistische Bewegung. Polen hatte mit ihr paktiert, aber aus letztlich ganz eigennützigen Gründen. Als der Friede kam, ließ Piłsudski seinen Verbündeten fallen. Die Ukraine war zwischen West und Ost zerrieben worden. Selbst Litauen, traditionell einer von zwei Teilen der Rzeczpospolita, war Polen entfremdet, denn der Nachbar hatte seine Hauptstadt Wilna erobert. Der siegreiche Hegemon fand sich außenpolitisch isoliert.
In Moskau saßen die Bolschewiki nach dem Rigaer Vertrag fest im Sattel eines neuen russischen Reiches und sannen auf Rache, insbesondere jener Heerführer, der für den Fehlschlag vor Warschau verantwortlich gemacht wurde: Josef Stalin. Der eigentliche Oberbefehlshaber, Michail Tuchatschewski, konnte deshalb trotz seines Misserfolgs als strahlender Held nach Moskau zurückkehren. Im «Großen Terror» ließ Stalin ihn 1937 als einen der Ersten beseitigen.
Die Friedensordnung stellte in jeder Hinsicht eine gigantische Hypothek dar. Halb Osteuropa war zum Schlachtfeld eines Krieges geworden, der ebenso sehr ins 18. wie ins 20. Jahrhundert gehörte. Hunderttausende toter Soldaten und Zivilisten waren zu beklagen, riesige Landstriche verwüstet, und wieder einmal sah man in den Juden – wie schon seit Ewigkeiten – die Ursache allen Übels. Der Antisemitismus war allerdings um eine weitere, entscheidende Komponente bereichert worden: Juden galten nun außerdem noch als Volksverräter und Anhänger des Kommunismus. Das erleichterte den Deutschen später nicht unwesentlich den Holocaust, weil auch andere Nationen ihre Nachbarn als Feinde betrachteten.
Der brüchige Friede in Osteuropa sollte gerade 18 Jahre halten. Und es war Deutschland, das ihn beendete. Zwar bewunderten die Nationalsozialisten Piłsudski für seinen Sieg über den Bolschewismus und für seine innenpolitische Durchsetzungskraft. Doch als Polen nicht als Juniorpartner gegen die Sowjetunion zur Verfügung stehen wollte, trat der Hass wieder offen zutage. Deutschland griff am 1. September 1939 an, und am 17. September drang auch die Rote Armee nach Polen vor. Der Zweite Weltkrieg übertraf die Schrecken des Polnisch-Sowjetischen Krieges um ein Vielfaches. Dessen Nachwirkung blieb indes unübersehbar. Im Pakt mit Hitler sicherte Stalin sich den Teil Polens, den die Sowjets in Riga 1921 hatten abtreten müssen. Und 1945 in Jalta wich er nicht von dieser sogenannten Curzon-Linie ab. Er argumentierte gegenüber Churchill, dass sie auf einem alliierten Vorschlag von 1920 beruhe und Sowjetrussland damals in seiner schwächsten Stunde nur notgedrungen auf Gebiete verzichtet habe. Die Kresy, jene ethnisch so heterogenen und stets umkämpften Regionen zwischen Polen und Russland, wechselten damit einmal mehr die Herrschaft.
Bis heute wirft der Polnisch-Sowjetische Krieg seine Schatten. Moskau und Warschau streiten über die Behandlung der damals gefangen genommenen Soldaten; Polen diskutiert mit Litauen, Belarus und der Ukraine über nationale Minderheiten und historische Denkmäler; Polen sind uneins darüber, ob Piłsudskis Vorgehen gegen Sowjetrussland nicht den eigentlichen Feind – Deutschland – gestärkt und somit indirekt zur Niederlage 1939 beigetragen habe. Zugleich feiert man ihn als Vater des modernen Polens und als Retter ganz Europas vor dem Bolschewismus, sieht das «Wunder an der Weichsel» als Verteidigung der christlich-abendländischen Zivilisation und als einen weiteren...
| Erscheint lt. Verlag | 28.8.2019 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Beck Paperback |
| Zusatzinfo | mit 11 Abbildungen und 2 Karten |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► 20. Jahrhundert bis 1945 |
| Reisen ► Reiseführer ► Europa | |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte ► Regional- / Ländergeschichte | |
| Schlagworte | 20. Jahrhundert • Antisemitismus • Baltikum • Bolschewismus • Geschichte • Kommunismus • Krieg • Militärgeschichte • Osteuropa • Polen • Politik • Rote Armee • Russland • Sowjetunion • UdSSR • Ukraine • Urkatastrophe • Wunder an der Weichsel |
| ISBN-10 | 3-406-74023-5 / 3406740235 |
| ISBN-13 | 978-3-406-74023-7 / 9783406740237 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 9,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
Größe: 6,1 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich