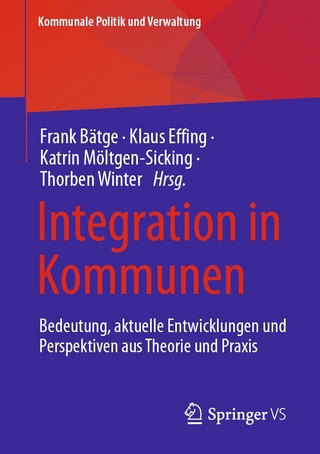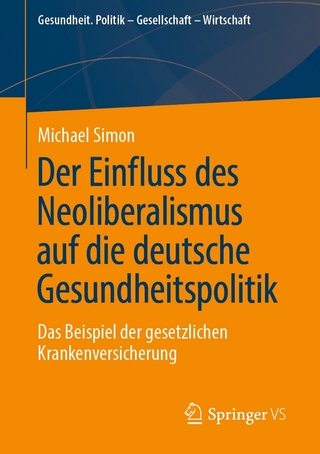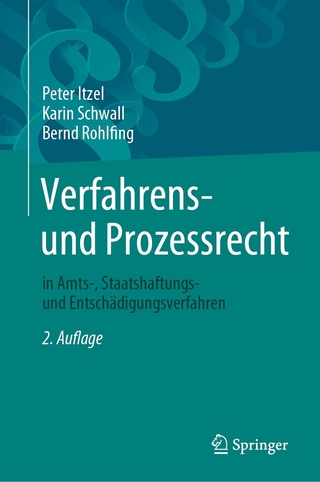Grundlagen des Kommunalverfassungsrechts in Schleswig-Holstein (eBook)
125 Seiten
Deutscher Gemeindeverlag
978-3-555-02198-0 (ISBN)
Björn Petersen ist Büroleiter in einer Kommunalverwaltung in Schleswig-Holstein, Berater und Dozent für Kommunalrecht und Organisationswesen.
Björn Petersen ist Büroleiter in einer Kommunalverwaltung in Schleswig-Holstein, Berater und Dozent für Kommunalrecht und Organisationswesen.
9.3.2Zusammensetzung und Wahl
Die Gemeindevertretung besteht aus gewählten Vertret. (§ 31 GO). Damit wird dem sich aus Art. 28 Abs. 1 GG ergebenden allgemeinen Demokratiegrundsatz Rechnung getragen, nach dem es in den Gemeinden und Kreisen gewählte Volksvertretungen geben muss. Die Vertret. führen in Städten die Bezeichnung Stadtvertreterin bzw. Stadtvertreter oder – sofern die Hauptsatzung dies vorsieht – eine andere Bezeichnung. Die Einzelheiten zur Zusammensetzung und zur Wahl ergeben sich aus dem Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG). Die Wahlzeit beträgt fünf Jahre und beginnt gemäß § 1 GKWG jeweils am 1. Juni. Die Neuwahl findet an einem von der Landesregierung zu bestimmenden Sonntag statt.
9.3.3Wahlberechtigung und Wählbarkeit
Wahlberechtigt ist nach § 3 GKWG jede Person, die die deutsche oder die Staatsangehörigkeit eines Staates der Europäischen Union besitzt, das 16. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens sechs Wochen in der Gemeinde einen Wohnsitz hat (aktives Wahlrecht). Wer in mehreren Gemeinden eine Wohnung hat, ist an seinem Hauptwohnsitz wahlberechtigt (§ 21 Bundesmeldegesetz).
Gewählt werden kann nach § 6 GKWG jede/r Wahlberechtigte, d. das Volljährigkeitsalter (18. Lebensjahr) erreicht hat und seit mindestens drei Monaten in Schleswig-Holstein wohnt (passives Wahlrecht). Die Wählbarkeit von Beschäftigten der Kommunalverwaltungen ist durch § 31a GO und § 37a GKWG beschränkt (Unvereinbarkeit von Amt und Mandat, Inkompatibilität). So darf z. B. ein Mitglied der Gemeindevertretung nicht gleichzeitig Beschäftigter in der Funktionsgruppe der Laufbahngruppe 2 (beginnt mit der Bes.Gr. A 9 bzw. der Entg.Gr. 9b) der Gemeinde sein. Dadurch soll eine Trennung von Willensbildung und Willensausführung erreicht werden.
9.3.4Wahlverfahren
Nach Art. 28 Abs. 1 GG und Art. 4 Abs. 1 LVerf gelten für die Wahlen folgende Wahlrechtsgrundsätze:
• allgemein: es dürfen keine Voraussetzungen von Wähl. gefordert werden, die über das aktive Wahlrecht hinausgehen,
• unmittelbar: die Wahlberechtigten müssen direkt die Volksvertretung ohne Einschaltung von Wahlmännern wählen,
• frei: jeglicher Zwang von außen auf die Wahlentscheidung ist unzulässig. Es besteht keine Wahlpflicht. Die Bildung von Alternativen, z. B. die Bildung von Wählergruppen, ist möglich,
• gleich: jede abgegebene Stimme hat den gleichen Zählwert,
• geheim: die Stimmabgabe darf für andere nicht nachvollziehbar sein.
Das GKWG sieht ein gemischtes Wahlverfahren vor, nämlich die Mehrheitswahl mit Verhältnisausgleich, die teilweise auch als personifizierte Verhältniswahl bezeichnet wird. Dieses Verfahren versucht, die Vorteile der reinen Mehrheitswahl und der reinen Verhältniswahl miteinander zu verbinden. Bei der Mehrheitswahl ist gewählt, wer die meisten Stimmen erhält. Es handelt sich um eine Persönlichkeitswahl, die aber den Nachteil hat, dass die auf die nicht gewählten Bewerb. abgegebenen Stimmen unberücksichtigt bleiben. Dieser Nachteil wird dann besonders deutlich, wenn mehrere Bewerb. ähnlich hohe Stimmenzahlen auf sich vereinigen. Die Verhältniswahl zeichnet sich dadurch aus, dass jede Partei oder Wählergruppe so viele Sitze in der Gemeindevertretung erhält, wie ihre unmittelbaren Bewerb. zusammen im Verhältnis zu den unmittelbaren Bewerb. der anderen Parteien und Wählergruppen Stimmen erhalten haben. Das Wahlergebnis wird „spiegelbildlich verkleinert“ auf die Größe der Gemeindevertretung. Bei der Verhältniswahl werden damit alle Wählerstimmen berücksichtigt. Ihr Nachteil besteht darin, dass die Wähl. nicht bestimmen, welche Person sie wählen. Sie können keinen direkten Einfluss auf die von den Parteien und Wählergruppen aufgestellten Listen nehmen.
Nach dem Mehrheitswahlverfahren mit Verhältnisausgleich wird ein Teil der Gemeindevertr. nach den Grundsätzen der reinen Mehrheitswahl und ein weiterer Teil nach den Grundsätzen der Verhältniswahl ermittelt.
Die Anzahl der Gemeindevertr. richtet sich nach § 8 GKWG nach der Einwohnerzahl der Gemeinde. Die kleinste Gemeindevertretung (71 bis 200 Einw.) besteht aus 7 Mitgliedern, die größte (in kreisfreien Städten mit mehr als 150.000 Einwohnern) aus 49 Mitgliedern. Das GKWG bestimmt, wie viele Gemeindevertr. durch Mehrheitswahl und wie viele durch Verhältniswahl zu wählen sind. Dabei ist die Anzahl der durch Mehrheitswahl zu wählenden Vertr. immer größer als die der Listenvertret.
Im Einzelnen bestimmt das GKWG zur Größe der Gemeindevertretungen und Kreistage:
| Einwohnerzahl | insges. | unmittelbare Vertr. | Listenvertr. |
| kreisangehörige Gemeinden | 7 | 4 | 3 |
| mehr als 200 bis zu 750 | 9 | 5 | 4 |
| mehr als 750 bis zu 1 250 | 11 | 6 | 5 |
| mehr als 1 250 bis zu 2 500 | 13 | 7 | 6 |
| mehr als 2 500 bis zu 5 000 | 17 | 9 | 8 |
| mehr als 5 000 bis zu 10 000 | 19 | 10 | 9 |
| mehr als 10 000 bis zu 15 000 | 23 | 12 | 11 |
| mehr als 15 000 bis zu 25 000 | 27 | 14 | 13 |
| mehr als 25 000 bis zu 35 000 | 31 | 16 | 15 |
| mehr als 35 000 bis zu 45 000 | 35 | 18 | 17 |
| mehr als 45 000 | 39 | 20 | 19 |
| kreisfreie Städte | 43 | 22 | 21 |
| mehr als 150 000 | 49 | 25 | 24 |
| Kreise | 45 | 23 | 22 |
| mehr als 200 000 | 49 | 25 | 24 |
Wahlvorschläge können von politischen Parteien und Wählergruppen gemacht werden. Vorgeschlagen werden können auch Personen, die der Partei oder Wählervereinigung nicht angehören. Für die unmittelbaren Vertret. können Wahlvorschläge auch von einzelnen Wahlberechtigten eingereicht werden (§ 18 GKWG).
Das Wahlgebiet wird vom Wahlausschuss, soweit erforderlich, in Wahlkreise eingeteilt (§ 15 GKWG). Dabei wird grundsätzlich in jedem Wahlkreis eine bzw. ein unmittelbare/r Vertret. gewählt, sodass im Prinzip so viele Wahlkreise gebildet werden, wie Direktkandidaten zu wählen sind. Aus praktischen Erwägungen werden aber in Gemeinden mit weniger als 10.000 Einw. weniger Wahlkreise gebildet (§ 9 Abs. 1 und 2 GKWG), nämlich:
• in Gemeinden mit mehr als 70 bis 2.500 Einw. ein Wahlkreis, wobei jede/r Wähl. so viele Stimmen hat, wie es Direktmandate gibt,
• in Gemeinden mit mehr als 2.500 bis 5.000 Einw. drei Wahlkreise, in denen je drei Direktmandate vergeben werden und
• in Gemeinden mit mehr als 5.000 bis 10.000 Einw. fünf Wahlkreise, in denen je zwei Direktkandidaten vergeben werden.
Für eine bzw. einen Bewerb. kann nur eine Stimme abgegeben werden (Verbot der Kumulation). Soweit Wähl. mehrere Stimmen haben, können sie diese auf Kandid. verschiedener Parteien und Wählergruppen vergeben (panaschieren). Gewählt ist d. Kandid., d. die meisten Stimmen erhält. Für den Verhältnisausgleich werden die Stimmen zusammengezählt, die die unmittelbaren Bewerb. derselben politischen Partei oder Wählergruppe zusammen erhalten haben. Sodann werden zunächst alle Sitze nach dem Höchstzahlenverfahren nach Sainte-Laguë/Schepers vergeben. Bei diesem Verfahren werden die Gesamtstimmenzahlen, die die unmittelbaren Bewerb. derselben politischen Partei oder Wählervereinigung zusammen erhalten haben, durch 0,5 – 1,5 – 2,5 usw. geteilt. Auf die sich so ergebenden Höchstzahlen werden alle Sitze vergeben. Ziel dieses Verfahrens ist es, den politischen Parteien und Wählergruppen in der Gemeindevertretung einen Sitzanteil zuzuordnen, der dem Anteil der Wählerstimmen ihrer unmittelbaren Bewerb. entspricht. Von der Gesamtzahl der sich nach dem Verhältniswahlverfahren ergebenden Sitze werden die unmittelbar gewählten Vertret. abgezogen. Der dann verbleibende Sitzanteil stellt den Verhältnisausgleich dar. Von den Listen der politischen Parteien und Wählergruppen sind so viele Kandid. gewählt, wie sich nach dem Verhältnisausgleich zusätzliche Sitze ergeben haben.
Bis zum Jahre 2008 sah das GKWG vor, dass nur politische Parteien oder Wählergruppen am Verhältnisausgleich teilnehmen konnten, die entweder mindestens 5 % der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hatten oder...
| Erscheint lt. Verlag | 18.11.2020 |
|---|---|
| Zusatzinfo | 24 Abb., 16 Tab. |
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Recht / Steuern ► Öffentliches Recht ► Verwaltungsverfahrensrecht |
| Schlagworte | Bürgermeister • Fraktionen • Gemeinden • Kommunale Mandatsträger • Kommunalverfassung • Kommunalverwaltung • Kommunalwahl • Kommunen • Mandatsträger |
| ISBN-10 | 3-555-02198-2 / 3555021982 |
| ISBN-13 | 978-3-555-02198-0 / 9783555021980 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 4,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich