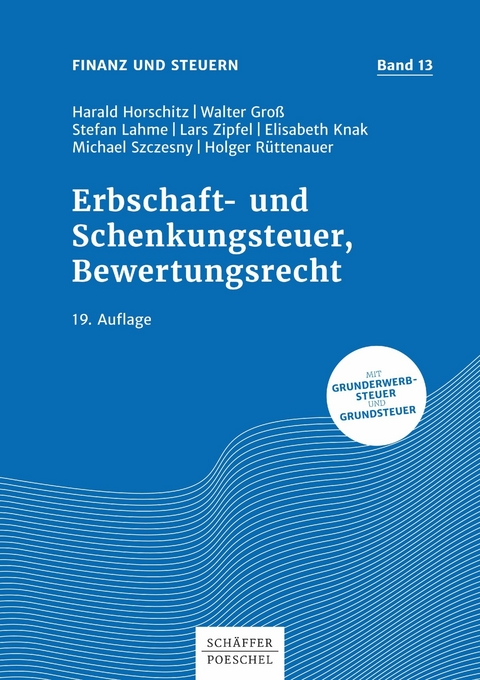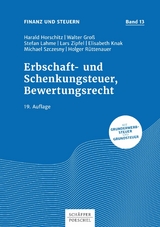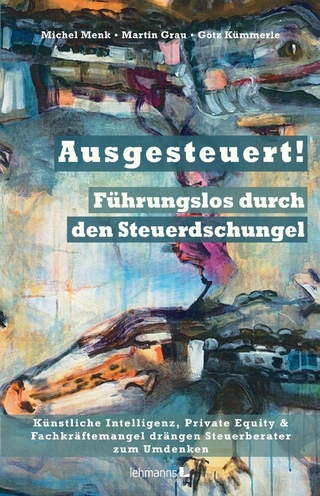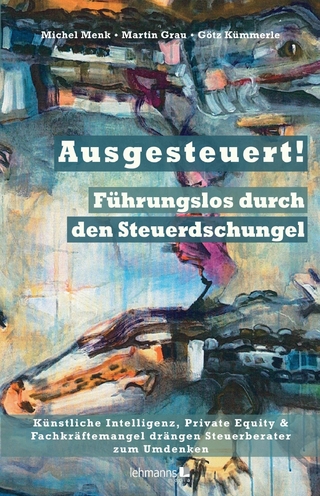Erbschaft- und Schenkungsteuer, Bewertungsrecht (eBook)
522 Seiten
Schäffer-Poeschel (Verlag)
978-3-7910-3702-8 (ISBN)
- Darstellung der zivilrechtlichen Grundlagen des Erbrechts und der Vorschriften des Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts
- Ausführliche Erläuterungen zur Bedarfsbewertung des Grund und Bodens, des Betriebsvermögens und der übrigen Wirtschaftsgüter
- Kurzer Überblick über die Grunderwerbsteuer inkl. Bewertung sowie über die Grundsteuer inkl. Bewertung
- Alle gesetzlichen Regelungen und den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Verfügungen, u.a. dem koordinierten Ländererlass zur Begünstigung von Betriebsvermögen
Harald Horschitz Prof. Dr. Harald Horschitz, Professor a. D., Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen, Ludwigsburg. Walter Groß Prof. Walter Groß, Professor a.D., Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen, Ludwigsburg. Stefan Lahme Prof. Dr. jur. Stefan Lahme, Professor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen, Ludwigsburg. Lars Zipfel Prof. Dr. Lars Zipfel, Professor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen, Ludwigsburg Elisabeth Knak Elisabeth Knak, Oberregierungsrätin an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen, Ludwigsburg Michael Szczesny Prof. Dr. Michael Szczesny, Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg; Autor von Fachbüchern und Fachbeiträgen; Dozent im Rahmen der Aus- und Fortbildung für Steuerberater. Holger Rüttenauer Holger Rüttenauer ist Dipl. Finanzwirt (FH) und bei der OFD Baden-Württemberg zuständig für erbschaftsteuerliche und bewertungsrechtliche Fragen, insbesondere zur Unternehmensbewertung. Er ist Lehrbeauftragter an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen, Ludwigsburg und als Referent tätig in der Steuerberateraus- und -fortbildung.
| Erscheint lt. Verlag | 13.11.2018 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Finanz und Steuern | Finanz und Steuern |
| Verlagsort | Freiburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Recht / Steuern ► Steuern / Steuerrecht |
| Schlagworte | Bedarfsbewertung • Bewertung • Bewertungsgesetz • Bewertungsrecht • Blaue Reihe • Bodenwert • Einheitsbewertung • Erbschaftsteuer • Erbschaftsteuerrecht • Erbschaft- und Schenkungsteuer • Groß • Grundsteuer • Horschitz • Lahme • Schenkungsteuer • Schenkungsteuerrecht • Schnur • Verkehrswert • Wertermittlung • WertV • Zipfel |
| ISBN-10 | 3-7910-3702-1 / 3791037021 |
| ISBN-13 | 978-3-7910-3702-8 / 9783791037028 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich