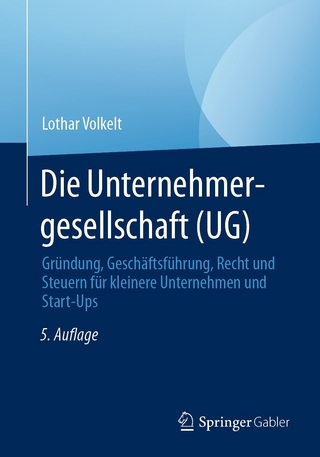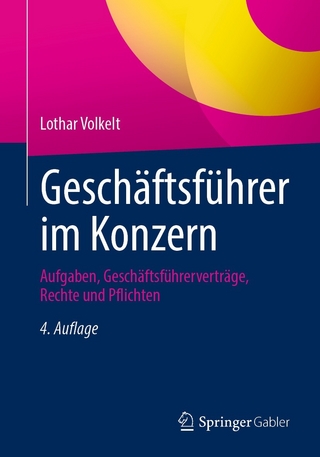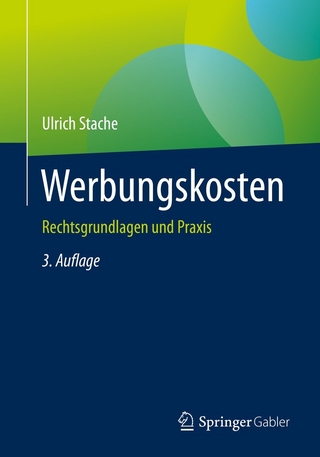Existenzsicherung in Ehe und Familie im Einkommensteuerrecht (eBook)
372 Seiten
Nomos Verlag
978-3-8452-9111-6 (ISBN)
Cover 1
Einleitung 25
1. Kapitel: Grundlagen der Existenzsicherung im Steuer- und Sozialrecht 29
A. Die Existenzsicherung als staatliche Aufgabe 29
I. Die staatliche Pflicht zur Sicherung der Existenz des Einzelnen 29
II. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Existenzminimum 32
1. Beschlüsse zum Familienexistenzminimum (1990) 32
2. Grundfreibetragsbeschluss (1992) 33
3. Beschlüsse zum Kinderlastenausgleich (1998) 34
4. Kranken- und Pflegeversicherung (2008) 35
5. Sozialrechtliches Existenzminimum (2010/2014) 35
III. Fazit und Fortgang der Bearbeitung 36
B. Existenzsicherung im Sozialrecht 37
I. Zielsetzung des Sozialrechts 37
II. Die Bereiche des Sozialrechts 37
III. Existenzsicherung im Sozialrecht 39
IV. Strukturprinzipien des Rechts der Existenzsicherung 41
1. Bedarfsdeckungsgrundsatz 42
a) Konkretisierung des Bedarfsdeckungsgrundsatzes 42
b) Das Verhältnis von Bedarf und Bedürftigkeit 43
2. Nachranggrundsatz 46
a) Der Nachrang gegenüber dem Einsatz von Einkommen 46
b) Der Nachrang gegenüber dem Einsatz von Vermögen 48
c) Der Nachrang gegenüber Unterhaltsansprüchen 51
C. Existenzsicherung im Steuerrecht 51
I. Das steuerrechtliche Leistungsfähigkeitsprinzip 51
1. Das objektive Nettoprinzip 52
2. Das subjektive Nettoprinzip 53
a) Kritik am subjektiven Nettoprinzip 54
b) Art der Berücksichtigung existenzsichernden Aufwands: Der Abzug von der Bemessungsgrundlage 55
aa) Die Menschenwürdegarantie und das Sozialstaatsprinzip 55
bb) Die Eigentumsfreiheit und das Sozialstaatsprinzip 57
cc) Die Gleichheitssätze 59
c) Berücksichtigung der Höhe nach: Die Bedeutung der Indisponibilität des Aufwands 62
aa) Keine überzeugende Lastenverteilung durch die Lehre vom indisponiblen Einkommen 62
bb) Keine überzeugende Umsetzung in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 64
d) Fazit 66
II. Fazit: Neuausrichtung des subjektiven Nettoprinzips 66
D. Das Verhältnis von Steuerrecht und Sozialrecht 67
I. Die Maßgeblichkeit des Sozialrechts für die Existenzsicherung im Steuerrecht 68
1. Die Wesensverwandtschaft von Steuerrecht und Sozialrecht 68
a) Sozialrecht als sachnahes Recht der Existenzsicherung 68
b) Kein Abstandsgebot zwischen Steuer- und Sozialrecht 71
aa) Keine Pflicht zur Prämierung der Erwerbstätigkeit durch ein erhöhtes Existenzminimum 73
bb) Zwischenfazit: Abstandsgebot nicht leistungsfähigkeitsgerecht 74
cc) Keine zielgenaue Verbesserung der Anreizeffekte 75
dd) Fazit 77
c) Bedarf oder Bedürftigkeit als maßgebliche Bezugsgröße des Steuerrechts 78
aa) Existenzsicherung des Steuerpflichtigen selbst (Kongruenz) 78
bb) Existenzsicherung von Angehörigen (Inkongruenz) 79
d) Die Bedeutung von Vermögen und Einkommen 81
aa) Vermögen 82
(1) Vermögen des Steuerpflichtigen 82
(2) Vermögen der Angehörigen 84
(a) Volljährige Kinder 84
(b) Minderjährige Kinder 87
(c) Nichtberücksichtigung des Vermögens aus Vereinfachungsgesichtspunkten 88
(3) Fazit 90
bb) Einkommen 90
e) Fazit 92
2. Beschränkung auf existenzsichernde sozialrechtliche Ansprüche 93
a) Sozialrechtliche Fürsorge ist unzureichend 93
b) Sozialrechtliche Leistungen gehen über das Existenzminimum hinaus 94
aa) Absetzbetrag nach § 11b Abs. 3 SGB II 95
bb) Wohngeld und Kinderzuschlag 96
(1) Wohngeld 96
(2) Kinderzuschlag 99
3. Die Bedeutung von Typisierungen bei der Abstimmung von Steuer- und Sozialrecht 101
a) Grundlagen und Voraussetzungen von Typisierungen 102
aa) Begriff der Typisierung 102
bb) Anforderungen an die Rechtfertigung typisierender Normen 105
cc) Anforderungen an die Ermittlung des typischen Falles 107
b) Typisierung im Steuer- und Sozialrecht 108
aa) Gröbere Typisierung im Steuerrecht 108
bb) Berücksichtigung regional unterschiedlicher Existenzminima 110
c) Fazit 113
II. Fazit 114
E. Die steuerrechtliche Rechtfertigung von Sozialzwecknormen 115
I. Die Unterscheidung zwischen Lenkungsnormen und Umverteilungsnormen 116
II. Die Rechtfertigung von Sozialzwecknormen 117
1. Das Gemeinwohlprinzip als übergeordnetes Prinzip zur Rechtfertigung 117
2. Die Rechtfertigung von Lenkungsnormen anhand des Verdienstprinzips 118
3. Die Rechtfertigung von Umverteilungsnormen anhand des Bedürfnisprinzips 121
III. Fazit 121
2. Kapitel: Die Familienbesteuerung als Untersuchungsgegenstand 122
A. Das duale System 123
I. Untersuchungsgegenstand 123
1. Historie unter Berücksichtigung der wegweisenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 123
2. Derzeitige Regelung in Grundzügen 125
II. Verfassungsmäßigkeit des dualen Systems 127
1. Berücksichtigung des sächlichen Existenzminimums 128
a) Die Berücksichtigung im Sozialrecht 128
aa) Regelbedarf 128
bb) Unterkunft und Heizung 129
cc) Bildung und Teilhabe 131
b) Die Berücksichtigung im Steuerrecht 131
aa) Regelbedarf 132
bb) Unterkunft und Heizung 132
cc) Bildung und Teilhabe 134
c) Folgerungen für die Berücksichtigung 134
aa) Regelbedarf 134
bb) Unterkunft und Heizung 136
cc) Bildung und Teilhabe 139
dd) Fazit 139
2. Berücksichtigung der Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungskomponente 140
a) Die Berücksichtigung im Sozialrecht 140
b) Die Berücksichtigung im Steuerrecht 141
aa) Rechtfertigung mit tatsächlichem Aufwand bei Eigenbetreuung 141
bb) Rechtfertigung mit Einkommensverzicht bei Eigenbetreuung 142
cc) Rechtfertigung mit Bindung der elterlichen Arbeitskraft aufgrund der Gemeinwohlverantwortung der Eltern bei Eigenbetreuung 142
c) Folgerungen für die Berücksichtigung 144
aa) Fehlender typisierend abzudeckender Aufwand bei Eigenbetreuung 144
bb) Keine steuerrechtliche Beachtlichkeit eines Einkommensverzichts bei Eigenbetreuung 146
cc) Keine Rechtfertigung aufgrund der Gemeinwohlverantwortung der Eltern bei Eigenbetreuung 147
dd) Fazit 148
3. Einwände gegen das duale System und rechtspolitische Hindernisse einer Reform 148
a) Die Degressionswirkung des Kinderfreibetrags 148
b) Kritik am Alternativverhältnis von Freibeträgen und Kindergeld 149
aa) Verfassungsrechtliche Kritik 149
bb) Rechtspolitische Kritik 151
cc) Exkurs: Die Bedeutung der Kapitaleinkünfte bei Ausgliederung des Kindergeldes aus dem EStG 153
c) Zweifelhafte systematische Einordnung der steuerlichen Entlastung 154
d) Hindernisse einer Streichung des Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsfreibetrags 156
III. Exkurs: Reform der steuerlichen Berücksichtigung von Kindern 158
1. Das Familienrealsplitting 158
a) Eignung zur Freistellung des Existenzminimums 159
b) Bedenken und rechtspolitische Bewertung 160
2. Das Familiendivisorensplitting 163
a) Eignung zur Freistellung des Existenzminimums 164
b) Bedenken und rechtspolitische Bewertung 167
IV. Exkurs: Das Elterngeld 168
1. Rechtfertigung der Thematisierung 168
2. Ausgestaltung und Ziele des Elterngeldes 169
3. Würdigung des Elterngeldes im Hinblick auf die zur Rechtfertigung des Betreuungsfreibetrags genannten Aspekte 171
a) Einkommensverzicht und Elterngeld 171
b) Gemeinwohlverantwortung und Elterngeld 173
4. Fazit 174
B. Kinderbetreuungskosten 175
I. Untersuchungsgegenstand 175
1. Historie unter Berücksichtigung der wegweisenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 175
a) Abzugsmöglichkeit für Hausgehilfinnen als Vorgängernorm 175
b) Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 11.?Oktober 1977 176
c) Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 3.?November 1982 und die Folgejahre 177
d) Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 10.?November 1998 178
e) Erneute Einführung des § 33c EStG und der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 16.?März 2005 179
f) Neuregelung durch das Gesetz zur steuerlichen Förderung von Wachstum und Beschäftigung vom 26.?April 2006 180
g) § 9c EStG und die gegenwärtige Regelung in § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG 180
h) Fazit 181
2. Regelung des § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG 181
II. Verfassungsmäßigkeit der Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten 182
1. Zu untersuchende Konstellationen 182
2. Die Fremdbetreuung im Sozialrecht 184
a) Grundkonzeption der § 22 ff. SGB VIII 184
b) Kostenbeteiligung 187
3. Berücksichtigung dem Grunde nach 188
a) Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten im Zusammenhang mit (beidseitiger) Erwerbstätigkeit 188
aa) Die Berücksichtigung im Sozialrecht 188
(1) Besonderheiten bei Erwerbstätigkeit 189
(2) Kostenbeteiligung 190
(3) Fazit 190
bb) Diskussion im Steuerrecht 191
(1) Einordnung als gemischt veranlasster Aufwand 191
(2) Position des Bundesverfassungsgerichts 192
(3) Uneinigkeit in der Literatur über die Zuordnung zum objektiven oder subjektiven Nettoprinzip 193
(a) Bedeutung der Zuordnung 193
(b) Methode der Zuordnung (Wesentlichkeit/Schwerpunkt) 195
(c) Zuordnung zum objektiven Nettoprinzip 196
(d) Zuordnung zum subjektiven Nettoprinzip 197
(4) Fazit 198
cc) Folgerungen 199
(1) Keine Berücksichtigung erwerbsbedingter Kinderbetreuungskosten im subjektiven Nettoprinzip 199
(2) Berücksichtigung als Erwerbsaufwand parallel zum Sozialrecht 200
(3) Fazit 201
b) Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten im Zusammenhang mit (beidseitiger) Krankheit 201
aa) Die Berücksichtigung im Sozialrecht 201
(1) Kinderbetreuungskosten in besonderen Situationen 202
(a) Eltern in unentgeltlicher Ausbildung 202
(b) Chronisch kranke oder behinderte Eltern 202
(c) Kinderreichtum 203
(2) Kostenbeteiligung 204
(3) Fazit 204
bb) Diskussion im Steuerrecht 204
(1) Kinderbetreuungskosten bei Ausbildung, Krankheit oder Behinderung 204
(2) Kinderbetreuungskosten bei Kinderreichtum 205
cc) Folgerungen 205
(1) Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten aufgrund von Krankheit und Behinderung im subjektiven Nettoprinzip 205
(2) Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten aufgrund von Ausbildung im subjektiven Nettoprinzip ist möglich 206
(3) Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten bei Kinderreichtum 208
(4) Fazit 208
c) Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten im Zusammenhang mit Erwerbstätigkeit und Krankheit 209
aa) Die Berücksichtigung im Sozialrecht 209
bb) Diskussion im Steuerrecht 210
cc) Folgerungen 210
(1) Berücksichtigung anteilig im subjektiven Nettoprinzip und als Erwerbsaufwand 211
(2) Berücksichtigung im subjektiven Nettoprinzip 211
(3) Berücksichtigung als Erwerbsaufwand 212
(4) Fazit 213
d) Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten im Zusammenhang mit (beidseitiger) Freizeitgestaltung 214
aa) Die Berücksichtigung im Sozialrecht 214
bb) Diskussion im Steuerrecht 215
cc) Folgerungen 215
(1) Keine Berücksichtigung im subjektiven Nettoprinzip 215
(2) Keine Förderung durch Abzug der Kinderbetreuungskosten von der Bemessungsgrundlage 216
(3) Fazit 217
e) Zwischenergebnis 217
4. Berücksichtigung der Höhe nach 218
a) Gebührenstruktur der Kindertagesstätten als Ausgangspunkt 219
b) Bedeutung des Betreuungsfreibetrags für die Ausgestaltung der Kinderbetreuungskosten 222
aa) Bedeutung im geltenden Recht 222
bb) Keine Berücksichtigung des Betreuungsfreibetrags bei dessen Fortbestand 223
c) Exkurs: Berücksichtigung als Erwerbsaufwand 224
aa) Typisierende Obergrenze ist möglich 225
bb) Fazit 227
d) Bemessung einer möglichen Förderung durch das Steuerrecht 228
e) Ergebnis 228
5. Ausblick 229
C. Besondere Berücksichtigung von Bildungskosten 230
I. Schulgeld 230
1. Untersuchungsgegenstand 230
a) Historie 230
b) Regelung des § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG 231
2. Verfassungsmäßigkeit der Berücksichtigung von Schulgeld 233
a) Berücksichtigung im Sozialrecht 233
b) Diskussion im Steuerrecht 235
aa) Einordnung des § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG als Sozialzwecknorm 235
bb) Einordnung des § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG als leistungsfähigkeitsgerechte Vorschrift 236
c) Folgerungen 237
aa) Keine Berücksichtigung von Schulgeldzahlungen im subjektiven Nettoprinzip 237
bb) Exkurs: Keine Modifikation des Leistungsfähigkeitsprinzips aufgrund der grundrechtlichen Vorgaben 237
d) Fazit 239
II. Ausbildungskostenfreibetrag auswärtig untergebrachter Kinder 240
1. Untersuchungsgegenstand 240
a) Historie unter Berücksichtigung der wegweisenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 240
aa) Die Berücksichtigung von Ausbildungskosten in § 33a EStG 240
bb) Kürzung der Ausbildungsfreibeträge durch das Haushaltsbegleitgesetz 1983 240
cc) Abschaffung des Ausbildungsfreibetrags 241
b) Regelung des § 33a Abs. 2 EStG 242
2. Verfassungsmäßigkeit der Berücksichtigung von Kosten auswärtig untergebrachter Kinder 242
a) Berücksichtigung im Sozialrecht 242
aa) Die Vorgaben des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) 243
bb) Existenzsichernder Charakter der Leistungen nach dem BAföG 244
(1) Strukturell existenzsichernder Charakter der Leistungen 244
(2) Fördernder Charakter einzelner Regelungen des BAföG 245
(3) Fazit 246
b) Diskussion im Steuerrecht 247
aa) § 33a Abs. 2 EStG als unselbständig zu bewertende Vorschrift 248
bb) § 33a Abs. 2 EStG als isoliert zu bewertende Vorschrift 248
c) Folgerungen 249
aa) Volle Berücksichtigung der im BAföG angesetzten Kosten für auswärtige Unterbringung 249
bb) Keine anderweitige Bewertung aufgrund des Freibetrags für Betreuung und Erziehung oder Ausbildung 249
d) Fazit 250
D. Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 251
I. Untersuchungsgegenstand 251
1. Historie unter Berücksichtigung der wegweisenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 251
2. Regelung des § 24b EStG 252
II. Verfassungsmäßigkeit der Berücksichtigung von Alleinerziehenden 252
1. Berücksichtigung im Sozialrecht 252
a) Die Regelung des § 21 Abs. 3 SGB II 252
b) Existenzsichernder Charakter des § 21 Abs. 3 SGB II 254
aa) Die Erwägungen des Gesetzgebers 255
bb) Die Diskussion in Rechtsprechung und Literatur 256
2. Diskussion im Steuerrecht 257
a) Position des Bundesverfassungsgerichts 258
b) Qualifikation als Sozialzwecknorm 259
c) Forderung nach einer Splittingregelung für Alleinerziehende 260
3. Folgerungen 261
a) Keine Berücksichtigung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende im subjektiven Nettoprinzip 262
aa) Mehrbedarf nach § 21 Abs. 3 SGB II hat keinen existenzsichernden Charakter 262
bb) § 24b EStG ist eine Sozialzwecknorm mit Degressionswirkung 263
b) Steuerliche Förderung von Alleinerziehenden über einen einheitlichen Abzug von der Steuerschuld möglich 263
4. Fazit 264
3. Kapitel: Das Ehegattensplitting 265
A. Untersuchungsgegenstand 266
I. Historie unter Berücksichtigung der wegweisenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 266
1. Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 17.?Januar 1957 zur Verfassungswidrigkeit der Zusammenveranlagung 266
2. Reaktion des Gesetzgebers 267
3. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 3.?November 1982 zur Einbeziehung Alleinerziehender in das Splittingverfahren 267
4. Der Beschluss vom 10.?November 1998 zum Betreuungsbedarf 269
5. Der Beschluss vom 7.?Mai 2013 zur steuerlichen Behandlung von eingetragenen Lebenspartnerschaften 269
II. Regelung 271
B. Verfassungsmäßigkeit des Ehegattensplittings 272
I. Standpunkte in den Steuerwissenschaften 272
1. Verfassungswidrigkeit des Ehegattensplittings 272
2. Ehegattensplitting als einzig mögliche Form der Besteuerung 273
3. Ehegattensplitting als mögliche Form der Besteuerung 275
II. Bewertung 276
1. Ehegattensplitting nicht verfassungswidrig 276
a) Die Rechtsfigur der mittelbaren Diskriminierung 276
b) Bedeutung für das Ehegattensplitting 279
aa) Ausgangspunkt: (Theoretische) Bedeutung für die Erwerbstätigkeit des Zweitverdieners 279
bb) Die Ehefrau als typischer Zweitverdiener 284
cc) Benachteiligung des Zweitverdieners durch das Ehegattensplitting 286
(1) Anforderungen an den Begriff des Nachteils bei mittelbarer Diskriminierung 286
(a) Rechtpolitische Erwägungen 286
(b) Rechtsdogmatische Erwägungen 288
(2) Keine erhebliche Benachteiligung des Zweitverdieners durch das Ehegattensplitting 290
(a) Nachteilige Wirkung des Ehegattensplittings für den Zweitverdiener 290
(b) Ausgestaltung des Ehegattensplittings 292
(c) Relevanz der Unterschiede im Vergleich zu Besteuerungsalternativen 294
(d) Zusammenhang zwischen Ehegattensplitting und Nachteilen für Zweitverdiener 297
(e) Kausalität des Ehegattensplittings für mögliche Nachteile von Zweitverdienern 298
c) Fazit 299
2. Ehegattensplitting nicht verfassungsrechtlich zwingend 299
3. Ehegattensplitting ist mögliche Form der Besteuerung 301
a) Zivilrecht als Indiz für tatsächlich gelebte Wirtschaftsgemeinschaft 302
aa) Gesetzlicher Güterstand und Wirtschaftsgemeinschaft 302
(1) Die Einführung der Zugewinngemeinschaft als gesetzlicher Güterstand 303
(2) Die Bedeutung der Zugewinngemeinschaft für die wirtschaftliche Realität der Ehegatten 306
bb) Versorgungsausgleich und Wirtschaftsgemeinschaft 309
cc) Unterhaltsrecht und Wirtschaftsgemeinschaft 311
(1) Unterhaltsrecht und Halbteilung 311
(2) Die Gegenseitigkeit des Familienunterhalts 314
(3) Unterhaltspflichten rechtfertigen keine Sonderbehandlung der Ehegatten 317
b) Vertretbare Typisierung der wirtschaftlichen Realität durch das Ehegattensplitting 318
III. Fazit 320
C. Ehegattenbesteuerung unter Rückgriff auf das Sozialrecht 321
I. Die Behandlung der Ehegatten im Sozialrecht 321
1. Erfassung der Ehegatten als Bedarfsgemeinschaft im SGB II 321
2. Erfassung nicht verheirateter Partner als Bedarfsgemeinschaft 323
3. Typisierende Anknüpfung an partnerschaftliches Zusammenleben 324
4. Begriffsklärung 325
II. Implikationen für das Steuerrecht 325
1. Die Haushaltsersparnis in der steuerrechtlichen Diskussion 326
2. Verfassungsrechtliche Vorgaben an eine steuerliche Berücksichtigung der Haushaltsersparnis 327
a) Keine Erfassung sämtlicher Gemeinschaften 328
b) (Typisierende) Differenzierung je nach Art der Gemeinschaft 328
aa) Keine Differenzierung zwischen rechtlich verfestigten und anderen Partnerschaften 328
bb) Differenzierung zwischen Haushaltsgemeinschaft und Wohngemeinschaft 329
(1) Haushaltsgemeinschaft im Sinne des § 24b Abs. 3 EStG 330
(2) Paargemeinschaft als möglicher Anknüpfungspunkt einer Typisierung 331
(3) Drohende faktische Vollzugsdefizite 332
c) Generelle Nichtberücksichtigung der Haushaltsersparnis 335
aa) Exkurs: Die steuerliche Behandlung des Trinkgeldes von Arbeitnehmern 337
bb) Verhältnismäßigkeitsprüfung als Maßstab für Vereinfachungsnormen 338
3. Fazit 341
D. Ergebnis 342
Thesenförmige Zusammenfassung der Arbeit 343
Existenzsicherung im Einkommensteuerrecht 343
Die Bedeutung von Vermögen und Einkommen 344
Beschränkung auf existenzsichernde sozialrechtliche Ansprüche 345
Typisierungen im Steuer- und Sozialrecht 346
Rechtfertigung von Sozialzwecknormen im Steuerrecht 346
Der Familienleistungsausgleich 346
Kinderbetreuungskosten 347
Berücksichtigung von Bildungskosten 348
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 349
Ehegattensplitting 349
Literaturverzeichnis 353
| Erscheint lt. Verlag | 2.5.2018 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Steuerwissenschaftliche Schriften |
| Verlagsort | Baden-Baden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Recht / Steuern ► Steuern / Steuerrecht |
| Schlagworte | Ehe • Ehegattensplitting • Einkommensteuerrecht • Existenzsicherung • Familie • Kindesunterhalt • Leistungsfähigkeitsprinzip • Steuerrecht • Subjektives Nettoprinzip |
| ISBN-10 | 3-8452-9111-7 / 3845291117 |
| ISBN-13 | 978-3-8452-9111-6 / 9783845291116 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,0 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich