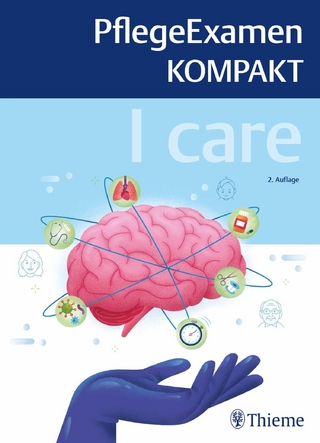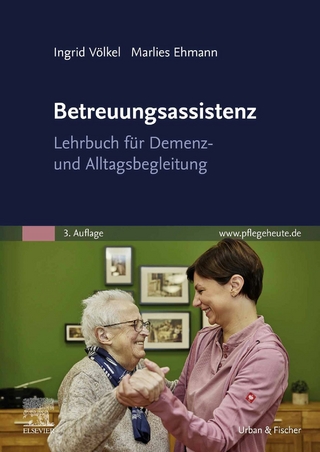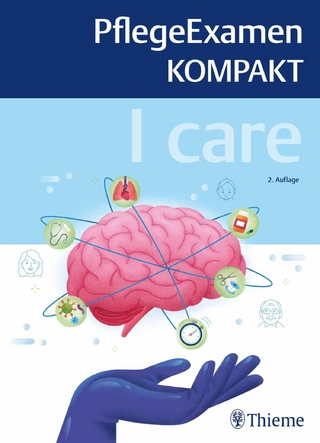Aggression, Gewalt und Aggressionsmanagement (eBook)
632 Seiten
Hogrefe AG (Verlag)
978-3-456-95845-3 (ISBN)
Inhalt und Geleitworte 7
Einführung 31
1 Aggression und Gewalt – ein Problem 37
1.1 Einleitung 39
1.2 Definitionen und Erläuterungen 40
1.2.1 Betrachtungen zum Begriff „Aggression“ 41
1.2.2 Betrachtungen zum Begriff „Gewalt“ 45
1.2.3 Betrachtungen zum Begriff „sexuelle Belästigung“ 46
1.2.4 Betrachtungen zum Begriff „Zwang“ 48
1.3 Zur Problemlage 50
1.3.1 Formen der Aggression 50
1.3.2 Vorkommen von Aggression 53
1.3.3 Auswirkungen 56
1.4 Zusammenfassung 59
2 Theorie und Modelle: Stand der Wissenschaft 61
2.1 Einige Anmerkungen zu Theorien 63
2.2 Theorien und Modelle für Aggression und Gewalt im Gesundheitswesen 65
2.2.1 Wissenschaftliche Grundlagentheorien von Aggression und Gewalt 65
2.2.2 Erklärungsmodelle für Gewalt im Gesundheitswesen 78
2.2.3 Ausblick: Prävention statt Eskalation 88
2.3 Das NOW-Modell 89
2.3.1 Entwicklung 89
2.3.2 Komponenten 90
3 Präventiver Umgang mit Aggression und Gewalt im Gesundheitswesen 95
3.1 Einleitung 97
3.2 Prävention 98
3.2.1 Der Präventionsbegriff 98
3.3 Gewaltprävention als Gesamtstrategie 113
3.3.1 Klare Datengrundlage 114
3.3.2 Gesetzliche Auflagen und unterschiedliche Interessen 114
3.3.3 Mut zur Neubewertung 115
3.3.4 Politischer Wille – Wille der Bevölkerung 116
3.3.5 Potenziale entwickeln 116
3.3.6 Berücksichtigung aller ursächlicher Faktoren 117
3.4 Zusammenfassung 118
4 Risikoeinschätzung und Erfassung von Aggression und Gewalt 119
4.1 Einleitung 121
4.2 Risikofaktoren 122
4.2.1 Risikoeinschätzung 124
4.2.2 Risikoeinschätzungsskalen 127
4.3 Erfassung aggressiven Verhaltens 130
4.3.1 Erfassung und Auswertung von Aggressionsereignissen 131
4.3.2 Erfassungsinstrumente 131
4.4 Umsetzung und Anwendung von Instrumenten 133
4.5 Erfahrungen aus der Praxis 134
4.6 Zusammenfassung 135
5 Interventionen 137
5.1 Einleitung 139
5.1.1 Zur Struktur des Kapitels 139
5.1.2 Interventionsziele 140
5.1.3 Nachweise der Wirksamkeit von Interventionen 141
5.1.4 Zuordnung und Auswahl von Interventionen 142
5.1.5 Benötigte Kompetenzen 143
5.2 Grundprinzipien der Kommunikation und Deeskalation 143
5.2.1 Einleitung 143
5.2.2 Deeskalation 144
5.2.3 Grundkompetenzen und Prinzipien der Deeskalation 154
5.2.4 Zusammenfassung und Ausblick 155
5.3 Psychosoziale Interventionen 156
5.3.1 Einleitung 156
5.3.2 Grundregeln psychosozialer Interventionen zur Deeskalation 156
5.3.3 Phasenbezogene Übersicht 157
5.3.4 Beschreibung einzelner Interventionen 172
5.4 Körperinterventionen 185
5.4.1 Einleitung 185
5.4.2 Ziele von Körperinterventionen 190
5.4.3 Prinzipien von Körperinterventionen 190
5.4.4 Formen von Körperinterventionen 192
5.4.5 Körperinterventionen und freiheitsbeschränkende Maßnahmen 199
5.4.6 Risiken bei Körperinterventionen und freiheitsbeschränkenden Maßnahmen 202
5.4.7 Zusammenfassung 204
5.5 Pharmakotherapie bei aggressivem Verhalten 205
5.5.1 Einleitung 205
5.5.2 Zuständigkeit und Diagnostik 205
5.5.3 Ethische Grundsatzfragen 206
5.5.4 Rechtliche Voraussetzungen 208
5.5.5 Pharmakotherapie akuter aggressiver Erregungszustände 209
5.5.6 Pharmakotherapie wiederkehrenden aggressiven Verhaltens 211
5.5.7 Zusammenfassung 214
5.6 Psychologische Interventionen bei Aggression im Gesundheitswesen 215
5.6.1 Einleitung 215
5.6.2 Psychologische Ansätze in der Gewaltprävention 215
5.6.3 Wirksamkeit psychologischer Interventionen 216
5.6.4 Periventionen in der Bewältigung von Gewaltsituationen 220
5.6.5 Zusammenfassung 221
5.7 Die ERM-Früherkennungsmethode 221
5.7.1 Einleitung 222
5.7.2 Faktoren mit Einfluss auf Aggression 223
5.7.3 Distanzierte Anteilnahme 224
5.7.4 Erkenntnisse durch Rekonstruktion von Ereignissen 226
5.7.5 Die Früherkennungsmethode 226
5.7.6 Die Entwicklung des FESAI 228
5.7.7 Zusammenfassung und Ausblick 229
5.8 Interventionen zur Gestaltung der Umgebung 232
5.8.1 Allgemeine bauliche Milieugestaltung 233
5.8.2 Spezielle Sicherheitsmaßnahmen 243
5.8.3 Zusammenfassung 254
6 Aggressionsereignisse aus der Perspektive verschiedener Settings 255
6.1 Einleitung 257
6.2 Aggression und Gewalt in der forensischen Psychiatrie 258
6.2.1 Einleitung 258
6.2.2 Vorkommen 259
6.2.3 Besondere Rahmenbedingungen 260
6.2.4 Lösungswege 262
6.2.5 Zusammenfassung 265
6.3 Aggression und Gewalt in der Notaufnahme 266
6.3.1 Zu den Besonderheiten von Notaufnahmen 266
6.3.2 Inanspruchnahme von Notaufnahmen 267
6.3.3 Prävalenz von Gewalt in der Notaufnahme 268
6.3.4 Besondere Rahmenbedingungen des Settings 270
6.3.5 Gewalt und Aggression als Hintergrund einer Interaktionsdynamik 272
6.3.6 Lösungswege 273
6.3.7 Zusammenfassung 274
6.4 Aggression im Akutspital 276
6.4.1 Einleitung 276
6.4.2 Vorkommen und Ereignis 278
6.4.3 Einflussfaktor „Organisation und Stationstyp“ 278
6.4.4 Besondere Rahmenbedingungen des Settings 280
6.4.5 Lösungswege 281
6.4.6 Zusammenfassung 284
6.5 Aggression in klinischen Psychiatrien 286
6.5.1 Einleitung 286
6.5.2 Vorkommen und Ereignis 286
6.5.3 Besondere Rahmenbedingungen des Settings 288
6.5.4 Lösungswege 291
6.5.5 Zusammenfassung 299
6.6 Aggression in der ambulanten Pflege 300
6.6.1 Einleitung 300
6.6.2 Vorkommen und Ereignis 302
6.6.3 Besondere Rahmenbedingungen des Settings 304
6.6.4 Lösungswege 307
6.6.5 Zusammenfassung 311
6.7 Aggression und Gewalt im Rettungsdienst und Krankentransport 314
6.7.1 Einleitung 314
6.7.2 Vorkommen und Ereignisse 315
6.7.3 Besondere Rahmenbedingungen 317
6.7.4 Lösungswege 318
6.7.5 Zusammenfassung 321
6.8 Sucht und aggressives Verhalten 323
6.8.1 Einleitung 323
6.8.2 Vorkommen 324
6.8.3 Besondere Rahmenbedingungen 324
6.8.4 Lösungswege 325
6.8.5 Zusammenfassung 328
6.9 Aggression in heilpädagogischen Einrichtungen der Behindertenhilfe 330
6.9.1 Einleitung 330
6.9.2 Vorkommen und Ereignis 330
6.9.3 Lösungswege 332
6.9.4 Zusammenfassung 334
6.10 Krankheitsbedingte Aggression in der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie 337
6.10.1 Einleitung 337
6.10.2 Formen und Vorkommen 338
6.10.3 Entstehungsbedingungen für Aggression und Gewalt 339
6.10.4 Lösungswege 342
6.10.5 Zusammenfassung 345
6.11 Aggression bei Personen mit einer Demenz 347
6.11.1 Einleitung 347
6.11.2 Definition und Begriffe 348
6.11.3 Ursachen und Beeinträchtigungen 348
6.11.4 Vorkommen und Ereignis 349
6.11.5 Besondere Rahmenbedingungen des Settings 349
6.11.6 Lösungswege 353
6.11.7 Zusammenfassung 358
6.12 Aggression gegen Berufsnachwuchs 360
6.12.1 Einleitung 360
6.12.2 Vorkommen und Ereignis 362
6.12.3 Besondere Rahmenbedingung des Settings 363
6.12.4 Lösungswege 363
6.12.5 Zusammenfassung 366
6.13 Aggressionsereignisse in Pflegeheimen 368
6.13.1 Einleitung 368
6.13.2 Vorkommen/Ereignis 368
6.13.3 Auswirkungen von Aggressionen auf Bewohner*innen und Pflegende 370
6.13.4 Lösungswege 371
6.13.5 Zusammenfassung 372
6.14 Aggressionsereignisse in der Pädiatrie 374
6.14.1 Einleitung 374
6.14.2 Vorkommen und Ereignis 375
6.14.3 Besondere Rahmenbedingungen 376
6.14.4 Lösungswege 377
6.14.5 Zusammenfassung 377
6.15 Aggression und Gewalt im Gewaltschutzzentrum 379
6.15.1 Einleitung 379
6.15.2 Vorkommen und Ereignis 380
6.15.3 Besondere Rahmenbedingungen des Settings 382
6.15.4 Lösungswege 382
6.15.5 Zusammenfassung 384
6.16 Gewalt im sozialen Nahraum 387
6.16.1 Einleitung 387
6.16.2 Vorkommen und Ereignis 388
6.16.3 Besondere Rahmenbedingungen 390
6.16.4 Lösungswege 392
6.16.5 Zusammenfassung 395
7 Prävention psychischer Folgen und Nachsorge nach Gewaltereignissen im Gesundheitswesen 399
7.1 Einleitung 401
7.2 Schwere und Häufigkeit psychischer Belastungen nach einem Patient*innenübergriff 402
7.3 Ist eine Primärprävention möglich? 405
7.4 Unterstützung und Nachsorge nach Patient*innenübergriffen: Grundsätze der Sekundärprävention 406
7.5 Psychologische Erste Hilfe 410
7.5.1 Der Erstkontakt 410
7.5.2 Richtlinien für Ersthelfer und Nachsorgeteams 413
7.5.3 Selbsthilfetipps für Betroffene eines Übergriffs 414
7.6 Wann sollte Hilfe in Anspruch genommen werden? 415
7.7 Ausbildung von Ersthelfer*innen und Nachsorgeteams 416
7.8 Zusammenfassung und Ausblick 417
8 Arbeitsschutz, Recht, Ethik 419
8.1 Einleitung 421
8.2 Arbeitsschutz 422
8.2.1 Arbeitsschutz in Deutschland 422
8.2.2 Arbeitsschutz in der Schweiz 428
8.2.3 Arbeitsschutz in Österreich 435
8.3 Rechtliche Rahmenbedingungen 439
8.3.1 Rechtliche Rahmenbedingungen in Deutschland 439
8.3.2 Rechtliche Rahmenbedingungen in der Schweiz 448
8.3.3 Rechtliche Rahmenbedingungen in Österreich 457
8.4 Grundwissen Ethik im Gesundheitswesen 463
8.4.1 Einleitung 463
8.4.2 Ethische Theorien und Prinzipien 464
8.4.3 Strukturen im Gesundheitswesen 466
8.4.4 Ethische Positionen der Fachgesellschaften 468
8.4.5 Anwendung ethischer Prinzipien im Alltag 469
8.4.6 Zusammenfassung 471
9 Organisationsbezogene Interventionen 473
9.1 Einleitung 475
9.2 Exkurs über Verantwortung für Arbeitssicherheit 476
9.3 Entwicklung des betrieblichen Umgangs mit Gewalt am Arbeitsplatz 478
9.4 Ein zu verändernder Zustand? 479
9.5 Wo fängt man an? 480
9.6 Ganzheitlicher Ansatz 480
9.7 Instrumente zur Intervention 486
9.7.1 Die 5-Schritte-Methode 486
9.7.2 Die Balanced Scorecard 486
9.7.3 Die Colton-Checkliste 489
9.8 Organisations-, Team- und Stationskultur 492
9.9 Interventionsebenen und Handlungsmöglichkeiten 498
9.10 Kontinuierliches betriebliches Sicherheitsmanagement 498
9.11 Zusammenfassung 499
10 Ausbildung von Multiplikator*innen und Training von Mitarbeiter*innen 501
10.1 Einleitung 503
10.2 Die Bedeutung lebenslangen Lernens 503
10.3 Thesen zur Erwachsenenbildung 504
10.4 Planungsentscheidungen für Bildungsangebote im Umgang mit Aggression 505
10.4.1 Didaktische Analyse und Reduktion komplexer Stoffgebiete 505
10.4.2 Lernziele und Kompetenzentwicklung 506
10.4.3 Die Rolle der Lehrkraft 508
10.4.4 Adaption der Veranstaltung, Methoden und Medien an die Teilnehmer*innen 508
10.4.5 Zeit, Raum und weitere Rahmenbedingungen 509
10.4.6 Der Kern eines Curriculums 509
10.4.7 Voraussetzungen für den Kursleiter 510
10.5 Langfristige Organisation des Aggressionsmanagements 510
10.5.1 Grundmatrix organisationaler Lernprozesse 510
10.5.2 Institutionsinterne Trainer*innen als Idealfall für nachhaltige Lernprozesse 511
10.5.3 Validierung von Erfahrung und individuellem Wissen 512
10.5.4 Auswahlkriterien für den passenden Schulungsanbieter 512
10.6 Zusammenfassung 513
11 Leitlinien für den Umgang mit Aggression und Gewalt 515
11.1 Einleitung 517
11.2 Definition und Hintergrund 518
11.3 Chancen und Grenzen von Leitlinien 519
11.4 Vorhandene Leitlinien 520
11.4.1 Internationale Leitlinien 520
11.4.2 Deutschsprachige Leitlinien 523
11.5 Praktische Nutzung von Leitlinien 529
11.6 Zusammenfassung 530
12 Zusammenfassung und Ausblick 535
Anhänge 541
Verzeichnis der Autor*innen und Herausgeber 563
Literatur 573
Sachwortregister 624
4.2 Risikofaktoren
In der Forschung zu Aggression und Gewalt im Gesundheitswesen besteht bezüglich der Risikofaktoren ein deutliches Übergewicht an Studien aus den psychiatrischen Bereichen. Besonders in der Forensik gibt es zahlreiche Literatur über Risikobewertung. Viele Aspekte lassen sich aber auf andere Bereiche des Gesundheitswesens übertragen.
Studien zu Risikofaktoren bzw. Prädiktoren aggressiven Verhaltens berücksichtigen vor allem patient*innenbezogene, soziodemografische Faktoren und Krankheitsfaktoren und seltener interaktionelle Faktoren und Mitarbeiter* innen- und Umgebungsfaktoren. Untersuchungen patient*innenbezogener Faktoren sind weniger komplex und lassen sich einfacher operationalisieren. Gewalt in der Vorgeschichte des Patienten ist der robusteste Risikofaktor. Widersprüchliche Ergebnisse finden sich in Untersuchungen bei den Faktoren „Diagnose“, „Geschlecht“, „Psychopathologie“, „Krankheitseinsicht“, „Substanzabusus“, „neurologische Auffälligkeiten“, „autoaggressives Verhalten in der Vorgeschichte“ und „soziale Lebenssituation“. Als weitere patient*innenbezogene Risikofaktoren wurden identifiziert: „häufigere frühere Behandlungen“ sowie „unfreiwillige Aufnahme“, „Rezidive in den vergangenen 12 Monaten“, „Vorgeschichte mit selbstzerstörerischem Verhalten“, „Vorgeschichte mit sexuellem Missbrauch“, „Alkoholintoxikation (insbesondere nach Rauschtrinken bei jungen Erwachsenen)“, „Drogenintoxikation“, „Drogeneinnahme im vorangegangenen Monat“, „jüngeres Alter bei psychiatrischer Ersterkrankung“, „familiäre Faktoren/nicht verheiratet“, „fehlende Beschäftigung“, „kognitive Beeinträchtigung“ und „Insomnie“ (Bobes, Fillat & Arango, 2009; Chang & Lee, 2004; Dack, Ross, Papadopoulos, Stewart & Bowers, 2013; Fazel, Langstrom, Hjern, Grann & Lichtenstein, 2009; Foley, Kelly, Clarke, McTigue, Gervin et al., 2005; Ketelsen, Zechert, Driessen & Schulz, 2007c; Palmstierna & Olsson, 2007; Proescholdt, Walter & Wiesbeck, 2012; Rüesch, Miserez & Hell, 2003; Steinert, 2002; Voyer, Verreault, Azizah, Desrosiers, Champoux et al., 2005b).
Darüber hinaus trugen bei schizophrenen Patient*innen widrige und traumatische Lebensereignisse, sexueller Missbrauch, impulsive und antisoziale Tendenzen, aktuelle Psychopathologie und Nikotinkonsum zu aggressivem Verhalten bei (Lejoyeux, Nivoli, Basquin, Petit, Chalvin et al., 2013; Zhu, Li & Wang, 2016). Bei psychotischen Patient*innen wurden in einer Übersichtsarbeit unter anderem „feindseliges Verhalten“, „kürzlicher Drogen- und Alkoholkonsum“, „keine Adhärenz bei Therapien und Medikamenteneinnahme“ und „geringere Impulskontrolle“ als dynamische Risikofaktoren identifiziert und als statische Faktoren „kriminelle Vorgeschichte“ und „Viktimisierung“ (Witt, van Dorn & Fazel, 2013). Gewalttätige Patient* innen waren auch insgesamt eher Opfer von Missbrauch in der Vorgeschichte und Viktimisierung und verletzten sich vermehrt selbst (Monahan, Vesselinov, Robbins & Appelbaum, 2017) bzw. Patient*innen mit häufigeren Episoden von Fixierungen und Isolierungen hatten eher eine Vorgeschichte von Missbrauch in der Kindheit (Hammer, Springer, Beck, Menditto & Coleman, 2011).
Eine Untersuchung in der Somatik ergab unter anderem Delir, Demenz und ein Alter > 65 Jahre als Risikofaktoren für aggressives Verhalten, Männer waren hier häufiger aggressiv als Frauen (Williamson, Lauricella, Browning, Tierney, Chen et al., 2014). An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass körperliche Erkrankungen als Grund für aggressives Verhalten diagnostisch berücksichtigt und abgeklärt werden müssen (Steinert & Kohler, 2005).
| Erscheint lt. Verlag | 23.9.2019 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Medizin / Pharmazie ► Pflege |
| Schlagworte | Aggression • Eskalation • Gesundheit • Gesundheitsberufe • Gesundheitswesen • Gewalt • Interventionen • Lehrbuch • Pflege • Prävention • Praxisbuch • Reizabschirmung • Reizamschirmung • verbale Deeskalation |
| ISBN-10 | 3-456-95845-5 / 3456958455 |
| ISBN-13 | 978-3-456-95845-3 / 9783456958453 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 8,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich