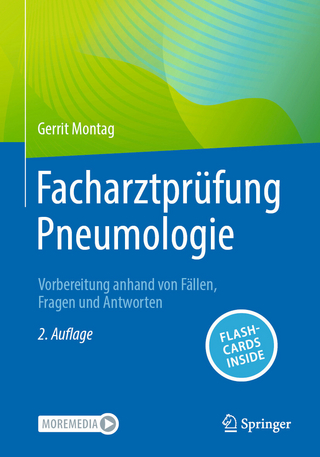Leitlinien der Stimmtherapie (eBook)
Thieme (Verlag)
978-3-13-177432-3 (ISBN)
Marianne Spiecker-Henke: Leitlinien der Stimmtherapie 1
Innentitel 4
Anschriften 5
Impressum 5
Vorwort 6
Danksagung 7
Inhaltsverzeichnis 8
Einleitung 16
1 Der Klang der Welt – Natur und Magie 18
2 Die Phylogenese der Stimme 21
3 Die Ontogenese der Stimme 27
4 Stimme und Person 32
5 Die Stimme in der Kommunikation 36
5.1 Einleitung 36
5.2 Sprechen, Hören, Verstehen 36
5.3 Der falsche Klang 38
6 Der Mensch und seine kranke Stimme 41
7 Zum Krankheitsverständnis 45
7.1 Einleitung 45
7.2 Das biopsychosoziale Krankheitsmodell: Leitlinie in Diagnostik und Therapie von Stimmerkrankungen 45
7.2.1 Die biologische Ebene 45
7.2.2 Die psychische Ebene 46
7.2.3 Die soziale Ebene 46
7.2.4 Die kulturelle Ebene 47
7.3 Das psychoneuro-immunologische Modell 48
8 Der Patient und sein Therapeut 49
8.1 Einleitung 49
8.2 Der Erstkontakt 49
8.2.1 Der Patient eines Kollegen 50
8.2.2 Soziale Vorurteile 51
8.3 Das Erstgespräch 51
8.3.1 Intuitives Erfassen des Patienten 51
8.3.2 Gemeinsame Wirklichkeit 51
8.3.3 Entwicklung von Vertrauen 51
8.3.4 Nähe und Distanz 52
8.3.5 Intimdistanz 52
8.4 Die gemeinsame Sprachebene 52
8.4.1 Erzeugen sprachlicher Kongruenz 53
8.4.2 Sprach- und Ausdrucksregeln 53
8.4.3 Kommunikative Rückkopplung 54
8.4.4 Kooperativer Patient und kooperativer Therapeut 54
8.4.5 Vereinbarungen für die Zusammenarbeit 55
8.5 Fortschritte und Rückschläge – die Interaktionzwischen Therapeut und Patient 55
8.5.1 Therapeutisches Ideal versus Patientenideal 56
8.5.2 Therapeutische Grundhaltungen 57
8.5.3 Grundhaltungen sind keine Methoden 57
8.6 Krisenreaktion: Lebenssituation und Stimmerkrankung 58
8.6.1 Krankheit als Rückzugsraum 58
8.6.2 Psychotherapeutische Unterstützung 58
8.7 Übertragung und Abwehr: Autorität und Sympathie 61
8.7.1 Das unausweichliche Symptom der Übertragung 61
8.7.2 Mündigwerden des Patienten 61
8.7.3 Erwartungshaltung 62
8.7.4 Übertragung und Gegenübertragung 62
8.7.5 Übertragungssituationen 63
8.7.6 Positive und negative Übertragung 63
8.7.7 Patientenseitige Übertragungsphänomene 63
8.8 Die Gegenübertragung des Therapeuten 63
8.8.1 Der nicht neutrale Therapeut 63
8.8.2 Gibt es berechtigte Gegenübertragung? 64
8.8.3 Die Problematik hoher Anforderungen 64
8.8.4 Abgabe eines Behandlungsauftrags 64
8.8.5 Gefahren positiver Gegenübertragung 65
8.9 Die Persönlichkeit des Therapeuten 66
8.9.1 Falscher therapeutischer Ehrgeiz 66
8.9.2 Metakommunikation 67
8.10 Berührungsängste in der Therapie – ein unterschätztesProblem 67
8.10.1 Die Wünsche des Patienten erspüren 68
8.10.2 Der Patiententypus 68
8.10.3 Körperkontakt und Machtfaktoren 68
8.11 Anforderungen und Voraussetzungen in der Stimmtherapie 69
8.11.1 Persönlichkeit als Heilmittel 69
8.11.2 Potenziale entdecken und entwickeln 69
8.11.3 Die innere Instanz 69
8.11.4 Der übermächtige Therapeut 70
8.11.5 Der schöpferische Therapeut 70
8.11.6 Selbstanalyse 70
8.11.7 Selbsterfahrungsgruppen für Therapeuten 70
9 KIIST – das Konzept einer Interaktionalen und Integrativen Stimmtherapie 72
9.1 Einleitung 72
9.2 Der Begriff „interaktional“ 72
9.3 Der Begriff „integrativ“ 72
9.4 Therapieziele des KIIST 73
9.5 Therapeutische Grenzen 73
9.6 Der Therapeut im KIIST 74
9.7 Die therapeutische Praxis im KIIST – Leitlinien 74
9.8 Die zentralen Bereiche der Therapie 76
9.8.1 Basis-Therapie 76
9.8.2 Störungsspezifische Therapie 76
9.8.3 Interaktionale Therapie 77
9.9 Die Teilbereiche der Therapie im Therapiekreis Stimme 77
9.9.1 Basis-Therapie 77
9.9.2 Störungsspezifische Therapie 78
9.9.3 Interaktionale Therapie 78
10 Einstieg in die Therapie 79
10.1 Einleitung 79
10.2 Zu Beginn der Therapie 79
10.2.1 Annäherung in der Erstbegegnung 79
10.2.2 Erwartungen des Patienten 79
10.2.3 Therapeutische Möglichkeiten und Grenzen 79
10.2.4 Erfolge und Rückschläge 80
10.2.5 Prognostische Einschätzungen und Zielvereinbarungen 80
10.2.6 Organisation der Behandlung 80
10.2.7 Einzel-, Gruppen- oder Intervallbehandlung? 81
10.2.8 Häufigkeit der Behandlung 81
10.3 Am Ende der Therapie 81
10.3.1 Beendigung der Stimmtherapie 81
10.3.2 Nachsorgende Maßnahmen 81
10.4 Formalien einer Therapie 82
10.4.1 Die Krankschreibung 82
10.4.2 Der Alltag als Übungsfeld 82
10.4.3 Die Rückkehr in den Beruf 82
11 Erkrankungen der Stimme 83
11.1 Begriffsklärung 83
11.2 Hauptsymptome von Stimmerkrankungen 84
11.2.1 Pathologische Klangveränderungen 84
11.2.2 Eingeschränkte Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit der Stimme 85
11.2.3 Wund- und/oder Fremdkörpergefühl 85
11.3 Funktionelle Stimmerkrankungen 85
11.3.1 Ursachen 86
11.3.2 Funktionelle Stimmerkrankung mit hyperfunktioneller Symptomatik 89
11.3.3 Besondere Formen der Stimmerkrankung mit hyperfunktioneller Symptomatik 90
11.3.4 Funktionelle Stimmerkrankung mit hypofunktioneller Symptomatik 92
11.3.5 Stimmerkrankungen mit gemischter Symptomatik 92
11.3.6 Stimmerkrankungen der Sing- und Sängerstimme 92
11.4 Sekundär-organische Stimmerkrankungen 94
11.4.1 Überlastungshyperämie 94
11.4.2 Organische Stimmerkrankungen 96
11.4.3 Akute Kehlkopfentzündung 99
11.4.4 Chronische Kehlkopfentzündung 99
11.4.5 Gutartige Kehlkopftumoren – Kehlkopfpapillome 100
11.4.6 Bösartige Kehlkopftumoren 100
11.5 Mutationsbedingte Störungen der Stimme 100
11.5.1 Mutation der Knabenstimme 100
11.5.2 Störungen der Stimme während der Mutation 102
11.6 Hormonell bedingte Stimmerkrankungen 103
11.6.1 Die Stimme im weiblichen Zyklus 104
11.6.2 Die Stimme in der Schwangerschaft 104
11.6.3 Die Stimme im Klimakterium 104
11.6.4 Die Stimme und Transsexualität 104
11.7 Die Stimme im Alter 105
11.8 Stimmlippenlähmungen 107
11.8.1 Einseitige Stimmlippenlähmungen 107
11.8.2 Beidseitige Stimmlippenlähmungen 108
11.8.3 Postoperatives Vorgehen 109
11.8.4 Störungsspezifische Maßnahmen in der Glottisebene 109
11.8.5 Prognostische Einschätzung 110
12 Praxis der Stimmdiagnostik 111
12.1 Einleitung 111
12.2 Probleme bei der Anamnese und Diagnostik 111
12.3 Das anamnestische Gespräch 112
12.4 Anamnestische Erfassung auf biopsychosozialer Grundlage 113
12.4.1 Anamnese biologisch-somatisch 114
12.4.2 Anamnese psychisch 114
12.4.3 Anamnese soziokulturell 115
12.5 Funktionsdiagnostik der Stimme 117
12.5.1 Subjektive Befunderhebung: Hören, Sehen, Fühlen 117
12.5.2 Subjektive und objektive Befunderhebung in Kombination 118
12.5.3 Hinweise zu einzelnen Bereichen der Funktionsprüfung 118
12.5.4 Hinweise zu standardisierten Untersuchungsbedingungen 121
13 Methodenvielfalt 123
13.1 Die „richtige“ Methode 123
13.2 Methodenkombination 123
13.3 Skepsis gegenüber der Methodenvielfalt 123
13.4 Die historische Konstanz der Verfahren 124
13.5 Pragmatische Orientierung an Nutzen und Wirksamkeit 124
14 Stimmtherapie: Ansätze und Methoden 125
14.1 Die kommunikative Stimmtherapie nach Horst Gundermann 125
14.1.1 Das Konzept 125
14.1.2 Die Rolle der Gruppe 125
14.1.3 Die Ziele 126
14.1.4 Ute Oberländer-Gentsch 126
14.2 Die integrative Stimmtherapie nach Eva Maria Haupt 126
14.2.1 Das Konzept 126
14.2.2 Die 3 Therapiephasen 126
14.2.3 Die Therapie „im Kreis“ 127
14.2.4 Die Ziele 127
14.3 Die Kaumethode nach Emil Fröschels 127
14.3.1 Das Konzept 127
14.3.2 Vom Kauen zur Stimme 127
14.3.3 Die Ziele 127
14.4 Die Stimmtherapie nach Helene Fernau-Horn 128
14.4.1 Das Konzept 128
14.4.2 Die Ziele 128
14.4.3 Ruth Dinkelacker 129
14.5 Die Klangraum-Therapie nach Almuth Eberle 129
14.5.1 Das Konzept 129
14.5.2 Die Ziele 129
14.6 Die tonale Stimmtherapie nach Marion Hermann-Röttgen 130
14.6.1 Das Konzept 130
14.6.2 Die Ziele 130
14.7 Die Akuem-These von Felix Trojan 130
14.7.1 Das Konzept 130
14.7.2 Schonstimme –Kraftstimme 131
14.7.3 Die Ziele 131
14.8 Das Funktionale Stimmtraining nach Gisela Rohmert 131
14.8.1 Das Konzept 132
14.8.2 Die Ziele 132
14.9 Die Stimm- und Sprecherziehung nach Horst Coblenzer und Franz Muhar 132
14.9.1 Das Konzept 132
14.9.2 Die Ziele 133
14.10 Die Nasalierungsmethode nach Johannes Pahn 133
14.10.1 Das Konzept 134
14.10.2 Übungen für die Sprechstimme 134
14.10.3 Resonanzformung und Ausdrucksgestaltung in Texten 134
14.10.4 Die Ziele 134
14.11 Die personale Stimmtherapie nach Ingeburg Stengel und Theo Strauch 135
14.11.1 Das Konzept 135
14.11.2 Die Ziele 135
15 Funktionskreis Wahrnehmung 136
15.1 Körperwahrnehmung 136
15.1.1 Die verfälschte Wahrnehmung 136
15.1.2 Wahrnehmen als Prozess 138
15.1.3 Lernen wahrzunehmen 141
15.1.4 Die Schulung der Wahrnehmung 144
15.1.5 Sechs Schritte zur Selbstwahrnehmung 146
15.2 Hören 154
15.2.1 Wahrnehmen der Stimme 154
15.2.2 Hören lernen 155
15.2.3 Der Klang verborgener Konflikte 157
15.2.4 Neue Klangmuster erfahren 157
15.2.5 Das Ohr als phonatorisches Kontrollsystem 158
16 Funktionskreis Körper 160
16.1 Körper und Stimme 160
16.1.1 Der Körper – die Gestaltdes Menschen 160
16.1.2 Der Stimmklang im Körper 160
16.1.3 Der Einfluss des Körpers auf den Stimmapparat 161
16.1.4 Körperabschnitte in ihrem Zusammenspiel 161
16.1.5 Die Architektur des Körpers 161
16.1.6 Der Körper in seiner Polarität 162
16.1.7 Der Körper im dynamischen Gleichgewicht 162
16.1.8 Der Körper im energetischen Schwerpunkt 163
16.2 Der Körper im Lot 163
16.2.1 Verlauf des Schwerelots beim Stehen 164
16.2.2 Die normale Körperhaltung im Schwerelot 164
16.2.3 Aus dem Lot geraten –Abweichungen von derVertikalachse 164
16.2.4 Schwerelot beim Sitzen 165
16.2.5 Dynamisches Muskelspiel 165
16.3 Grundformen der Muskeltätigkeit 166
16.3.1 Haltemuskeln (tonische Muskulatur) 166
16.3.2 Bewegungsmuskeln (phasische Muskulatur) 167
16.3.3 Gemischte Muskulatur 168
16.4 Faszien – verbindendesund stützendes Element 168
16.4.1 Was sind Faszien? 168
16.4.2 Grundstruktur 168
16.4.3 Faszien – unser größtesSinnesorgan 168
16.4.4 Muskeln und Faszien 168
16.4.5 Verkleben von Faszien 169
16.4.6 Übertragung von Faszienspannungen 169
16.4.7 Faszien in der Stimmtherapie 169
16.5 Ausgleich muskulärer Dysbalancen 169
16.5.1 Stimulierende Maßnahmen 169
16.5.2 Dehnende Maßnahmen 170
16.5.3 Kräftigende Maßnahmen 171
16.5.4 Mobilisierende Maßnahmen 171
16.5.5 Koordinierende Maßnahmen 171
16.6 Stufen des motorischen Lernens 171
16.6.1 Grobkoordination 172
16.6.2 Feinkoordination 172
16.6.3 Feinstkoordination 172
16.7 Abschnitte des Körpers 172
16.7.1 Die unteren Extremitäten 172
16.7.2 Das Becken – Mitte desKörpers 175
16.7.3 Die Wirbelsäule – Lastenträgerdes Körpers 179
16.7.4 Der Brustkorb –knöcherner Schutz für dieAtemorgane 184
16.7.5 Hals und Kopf 191
17 Körperarbeit: Ansätze, Methoden 195
17.1 Körperarbeit – das Tor zurStimmtherapie 195
17.2 Vox sana in corpore sano 195
17.2.1 Störungen im Körperinstrument 196
17.3 Körperarbeit ist immer „spannend“ 196
17.3.1 Spannung und Entspannung im dynamischen Wechsel 196
17.3.2 Spannung kennt keine Ideale 197
17.3.3 Das Nervensystem als Kontrollzentrum 197
17.3.4 Spannung und Entspannung im muskulären System 198
17.3.5 Grundspannung und Arbeitsspannung 198
17.4 Spannungen im vegetativen System 201
17.4.1 Steuerung, Kontrolle und Stress im autonomen Nervensystem 202
17.5 Spannungen im psychischen Bereich 203
17.5.1 Willkür der Körperreaktionen 204
17.5.2 Verspannung als Erscheinungsbild 204
17.6 Körperarbeit oder Körpertherapie? 206
17.6.1 Körpertherapie 206
17.6.2 Körperarbeit in der Stimmtherapie 206
17.6.3 Methodenvielfalt als Instrumentarium 207
17.7 Methoden der Körperarbeit 207
17.7.1 Die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson 207
17.7.2 Die Funktionelle Entspannung nach Fuchs 209
17.7.3 Die Alexander-Technik 212
17.7.4 Die Feldenkrais-Methode 215
17.7.5 Die Systemische Atlastherapie nach Bredenbeck 218
17.7.6 Die Eutonie nach Gerda Alexander 220
17.7.7 Die psychophysische Atemtherapie nach Middendorf 223
18 Rhythmus: Ansätze und Methoden 226
18.1 Rhythmus und Bewegung 226
18.1.1 Bewegung – kein Anfang,kein Ende 226
18.1.2 Individualität der Bewegung 226
18.2 Rhythmus und Gemeinschaft 226
18.2.1 Vom Rhythmus getragen 227
18.2.2 Rhythmus – der perfekteKoordinator 227
18.3 Rhythmus und Sprache 227
18.3.1 Das Phänomen der Ordnung 227
18.3.2 Die rhythmisierende Kraft der Sprache 227
18.4 Rhythmus und Gestik 228
18.5 Rhythmus in der Stimmtherapie 229
18.6 Bewegungs- und Tanzimprovisation 229
18.7 Rhythmuszentrierte Methoden 230
18.7.1 Schwingen nach Schlaffhorst-Andersen 230
18.7.2 Die Akzentmethode nach Svend Smith 233
18.7.3 Die Atemschriftzeichen nach Schümann 235
19 Funktionskreis Atmung 238
19.1 Einleitung 238
19.2 Physiologische Grundlagen der Atmung 238
19.2.1 Allgemein 238
19.2.2 Atemmuskulatur 240
19.2.3 Dreiphasiger Atemzyklus 240
19.2.4 Atmungstypen 243
19.3 Atmung: Sprechen und Singen 244
19.3.1 Phonationsatmung im Verbund mit Kehlkopf und Rachenraum 244
19.3.2 Stützfunktion für die Phonation – ein Balanceakt 244
19.3.3 Wahrnehmen des Stützvorgangs in Bauchraum, Brustkorb und Rachen 245
19.4 Welche Abweichungen können den Ablauf der Atmung stören? 246
19.4.1 Funktionelle Störungen der Atmung 246
19.4.2 Glottogene Störungen der Atmung 247
19.4.3 Weitere Störfaktoren 247
19.5 Leitlinien der Therapie 247
19.6 Therapeutische Anwendung im Beispiel 248
19.6.1 Wahrnehmen und Entspannen 248
19.6.2 Dehnen und Mobilisieren 249
19.6.3 Kräftigen 251
19.6.4 Steuern des Atems in den oberen Atemwegen 251
19.6.5 Komprimieren der Luft für die Phonation 252
20 Funktionskreis Stimmgebung 255
20.1 Der Kehlkopf 255
20.1.1 Mehrfachfunktionen des Kehlkopfs 255
20.1.2 Kehlkopfgerüst 255
20.1.3 Gelenkige Verbindungen 256
20.1.4 Etagen des Kehlkopfs 256
20.1.5 Aufhängung des Kehlkopfs 257
20.1.6 Äußere und innere Kehlkopfmuskulatur 258
20.1.7 Stimmlippen 261
20.2 Therapeutische Anwendung im Beispiel 269
20.2.1 Die eigene Stimme entdecken 270
20.2.2 Leitlinien für die Therapie in der Glottisebene 271
20.2.3 Therapeutische Hinweise 272
21 Funktionskreis Lautbildung 275
21.1 Der Rachen 275
21.1.1 Rachen – Raum für primäreFunktionen 275
21.1.2 Rachen – Raum fürResonanz und Artikulation 275
21.1.3 Brustresonator 275
21.1.4 Kopfresonator 275
21.1.5 Physiologische Grundlagen 275
21.1.6 Hohlräume und Muskeln im Rachen 276
21.2 Therapeutische Anwendung im Beispiel 282
21.2.1 Therapeutische Hinweise für den Kiefer 283
21.2.2 Therapeutische Hinweise für Mund und Rachen 285
21.2.3 Therapeutische Hinweise für die Zunge 285
21.2.4 Therapeutische Hinweise für die Lippen 285
21.2.5 Therapeutische Hinweise für die Nase und Lautbildung 286
22 Prosodie – die emotionale Sprache 287
22.1 Einleitung 287
22.2 Steuerung prosodischer Elemente 287
23 Einfluss der Kiefergelenke und der oberen Halswirbelsäule auf die Stimmfunktion 290
23.1 Einleitung 290
23.2 Der Kiefer – eineunterschätzte Komponente inder Stimmtherapie 290
23.2.1 Das Kiefergelenk 290
23.2.2 Funktionen des Kiefergelenks 290
23.2.3 Die Kaumuskulatur 291
23.2.4 Normale Bewegungen des Kiefergelenks 291
23.2.5 Bewegung des Kiefergelenks beim Singen 291
23.2.6 Der Kiefer in seiner funktionellen Vernetzung 293
23.2.7 Dysfunktion des Kiefergelenks/kraniomandibuläre Dysfunktion 295
23.2.8 Diagnostik der kraniomandibulären Dysfunktion 296
23.3 Wirbelsäulenstörungen 298
23.3.1 Einfluss funktioneller Wirbelsäulenstörungen auf die Phonation 298
23.4 Gezielte Diagnostik bei Verdacht auf eine kraniomandibuläre Dysfunktion 301
23.4.1 Test der Kaumuskulatur 301
23.4.2 Bewegungsprüfung des Kiefergelenks 302
23.4.3 Ergänzende Tests 302
23.4.4 Zusammenfassung 303
Anhang 304
Literatur 316
Sachverzeichnis 321
A 321
B 321
C 322
D 322
E 322
F 322
G 322
H 322
I 322
K 322
L 324
M 324
N 324
O 324
P 324
R 325
S 325
T 327
U 327
V 327
W 327
Y 327
Z 327
Ihr Plus im Web – das Online-Angebot zu Spiecker-Henke 328
1 Der Klang der Welt – Natur und Magie
Musik ist die Stimme des Universums, ist die Harmonisierung aller Schwingungen, aus der die Materie besteht, und sie heilt uns und unser Universum. (Yehudi Menuhin)
In vielen mythischen Erzählungen rund um den Globus sind die Geräusche der Natur – Tierlaute, Wind, Donner, Wasser – die Stimmen der Götter, der Geister und der verstorbenen Ahnen. Eine magische Korrespondenz prägt jene Riten, mit denen Verbindung zur Geisterwelt aufgenommen werden soll: Lang anhaltendes Tanzen, rhythmische Körperbewegungen, vor allem aber monotone Laute versetzen Sänger und Tänzer in Trance und Ekstase. Der Ritus öffnet eine magische Pforte, die Götter betreten die Welt, der Mensch findet für seine Anliegen offene Ohren. Innerhalb solcher Rituale ist die Stimme das wichtigste Medium, der Schlüssel zur Geisterwelt.
Nachahmung von Naturgeräuschen Um den Göttern nahe zu sein, werden Geräusche und Töne der Natur nachgeahmt: der Klang von Regen und Sturm, die Laute der Tiere und der Gesang der Vögel. Der Laut bezeichnet kein symbolisches Abstraktum. Gegenstand und Deutung sind noch nicht auseinandergefallen: Wer wie ein Löwe brüllt, ist ein Löwe. Da die lautlichen Phänomene imitatorischen Charakter haben und auf die Bezugsebene einer gemeinsamen Naturerfahrung verweisen, versteht sie jedermann.
Die Stimme als Mittler zum Jenseits Im Laufe der menschlichen Entwicklung übernimmt eine spezialisierte Kaste aus Fachkräften, eine Priesterschaft, die Aufgabe, den Kontakt zum Jenseits zu halten. Schamanistische Beschwörer artikulieren rituelle Formeln und Gesänge, die das Tor zu anderen Ebenen öffnen. Sie sind Boten zwischen den Welten – so wie in gewisser Weise später der Arzt oder der Therapeut zwischen Bewusstem und Unbewusstem vermittelt.
Rituale als soziale Handlung Die magischen Rituale und Gesänge finden im Auftrag von Gruppen statt, sie sind daher stets auch eine soziale Handlung. Die Großfamilie, der Stamm, die Sippe oder Horde findet sich zu gemeinschaftlichem Erleben zusammen: In der Rhythmik der Körperbewegungen verschmilzt der Stamm zur Einheit. Die musikalische Verbundenheit, der gemeinsam erzeugte Schall, erzeugt auch ein kooperatives Wollen, formt aus den Individuen einen Kollektivkörper.
Singend und tanzend nimmt der Mensch den Kampf gegen Naturgewalten, gegen feindliche Stämme und Mächte auf. Den Glauben an die geheimnisvolle Wirkungsmacht des Singens und Trommelns nennen wir Magie. Die magische Wirkung der Gesänge sichert die Existenz. Als akustischer Schutzzauber sorgt sie für Wachstum, reiche Ernten und erfolgreiche Jagd. Das Nachahmen tierischer Laute lockt Totemtiere an, sodass sie erbeutet werden können.
Singen und Trommeln haben aber auch für den Einzelnen eine zentrale Funktion. Das Spüren der Luftschwingungen und die Resonanzen der Klänge, die den Körper des Singenden durchströmen, vermehren seine Bereitschaft, übersinnliche Wirkungen und Kräfte zu erleben.
Die heilende Kraft der Gesänge Magischen Gesängen schreiben die Menschen zudem medizinische Heilkräfte zu. Rituelle Gesangsformeln können Krankheiten austreiben, sie erhalten die Gesundheit und steigern das Wohlbefinden. Kommen diese Beschwörungen in sozialen Zeremonien zum Einsatz, können sie selbst Dämonen verjagen, die bösen, krankheitserregenden Geister. Der Schamane verwandelt sich hierbei oft in ein Rollenwunder, das in vielen Zungen zu sprechen vermag. Jede Veränderung der Stimmmodulation ist Träger einer anderen Kraft, jeder Krankheitsgeist hat seine eigenen Melodien.
Das gemeinsame Singen und Tanzen am Lager eines Kranken kann die Genesung fördern. Ausgeglichene, tragende Rhythmen, die monotone Art des Singsangs können beruhigend auf das vegetative Nervensystem einwirken, Puls- und Herzfrequenz stabilisieren sich. Dies wiederum mildert Angst- und Schmerzzustände. Der Kranke fühlt sich nicht isoliert, er bleibt ein Teil der Gemeinschaft und spürt Ruhe und Geborgenheit. Das psychophysische Wohlgefühl mobilisiert die eigenen Heilkräfte.
Relikte urzeitlicher Rituale Riten und Bräuche sind auch bei uns lebendig: Wenn bspw. zu Fastnacht die Menschen mit Masken wie entfesselt durch die Straßen tanzen, wenn der heilige Christophorus hinter Windschutzscheiben baumelt, wenn Raketen und Böller zu Silvester die Dämonen der Kälte und Finsternis austreiben sollen, wenn die bäuerliche Blaskapelle um die Feldflur zieht, um Gedeihen und Wachstum auf den Äckern zu erbitten. Wir klopfen auf Holz, um unseren Wünschen die Erfüllung zu sichern, wir singen, wenn wir in den dunklen Keller gehen, wir drücken Freunden zur Prüfung die Daumen, wir suchen geheime Kräfte in der Naturmagie, indem wir Edelsteine als Schutzamulett oder Talisman tragen.
Natürlich ist es leicht, sich mit einem aufgeklärt-rationalen Weltwissen über diese „primitiven“ Restbestände magischen Denkens hinwegzusetzen. Trotzdem trägt jeder tief in sich den Restglauben an magische Zusammenhänge, die in schwierigen Situationen unterstützend wirken sollen.
Auf der Suche nach dem Ursprung Heute ruht unser Weltbild auf naturwissenschaftlichen Fundamenten: Die Technik, das Experiment, statistische Daten mit messbaren Ergebnissen haben die natürliche Intuition und Kreativität überdeckt. Die kognitive, faktengestützte Erkenntnis triumphiert über primitive Ansichten, die der Tradition und einem magischen Erfahrungswissen entstammen. Ein Bewusstsein für den archaischen und magischen Urgrund frühmenschlichen Lebensgefühls ist den meisten längst fremd geworden.
Das Gefühl des Ungenügens aber wächst. Immer mehr Menschen in westlichen Kulturen suchen den Weg zurück. Sie graben nach ihren Wurzeln und gewinnen dabei eine Ahnung vom Urklang am Anfang. Sie lassen sich ein auf Meditationen, sie erleben die Wirksamkeit rituell-monotoner Klänge, sie vertrauen auf endlose formelhafte Wiederholungen von Lautsilben (Mantras) oder auf das weltentrückte „Om“ tibetischer Tempelmönche. Ihr Körper reagiert mit einer größeren psychophysischen Balance: Das Gleichgewicht kehrt zurück.
Wirkung durch Schall Insbesondere Ostasiaten, die nicht gerade in einer technologisch rückständigen Weltregion leben, vertrauen noch heute auf die Wirkung der Schalltherapie: So wurden und werden mittels Tönen und Tonarten bestimmte Krankheiten geheilt. Die chinesische Medizin nutzt das Singen bestimmter Silben als Heilmittel, um auf bestimmte Organe einzuwirken. Auch die europäische Antike kannte den Zusammenhang von Stimme und Körper. Stimmübungen galten dort als eine Art Medikament, um Krankheiten zu heilen, die Gesundheit zu wahren, Selbstheilungskräfte zu aktivieren und das Gleichgewicht zwischen Körper und Seele zu erhalten.
Heute gibt es Versuche, das Wissen früherer Kulturen bei psychosomatischen Erkrankungen oder in der Musiktherapie zu reaktivieren, um ähnliche Effekte zu erzielen. Es zeigt sich aber, dass eine einfache Übertragung der stimmlichen Heilkraft in unsere Zeit nur dann gelingt, wenn sich die Menschen ihrer Verbundenheit mit dem Ursprünglichen bewusst werden. Die Wiedererschließung solch transkultureller und anthropologischer Felder bietet dann eine Chance, die Stimme wie auch die Musik als heilende Kraft zu verstehen. Die Stimme bleibt der elementare Ausdruck des Menschen. Sie birgt eine große emotionale Kraft, die es zu nutzen gilt.
Archaische Melodieformen Fast alle Kulturen kennen eine enge Verknüpfung von Singen und Tanz. Restbestände haben sich bei uns in Rockkonzerten oder in den Chorgesängen der Fußballstadien erhalten. Es sind gemeinschaftsstiftende, trancefördernde Rituale, die über Atmung und Stimme für einige Stunden ein Kollektiv erschaffen und beschwören. Auch für die Jüngsten sind Kinderlieder ohne In-die-Hände-Klatschen, Auf-den-Boden-Stampfen, ohne das Nachahmen von Tieren und ihren Lauten, von Geräuschen der Natur wie des Windes oder des Regens kaum denkbar. Man denke bspw. an die rhythmischen Lautmalereien in dem Lied „Hoppe, hoppe, Reiter …“
Ein unsichtbares Band verbindet uns über diese lautmalerischen Lieder mit frühen Gesellschaften. Auch das Ansingen von Tieren wie Schnecken oder Maikäfern beruht auf der alten Anschauung, dass Mensch und Tier wechselseitig ihre Sprache verstehen können, sofern man sich durch die richtigen, magisch wirksamen Melodien auszudrücken vermag: „Maikäfer flieg, dein Vater ist im Krieg …“
Fast all diese Lieder erklingen in einem 5-stufigen halbtonlosen Tonsystem (Pentatonik), das eine verblüffend enge Verwandtschaft zu den Kultgesängen naturnaher Völker zeigt: „Fallende Terz und die Verbindung von Ganzton und kleiner Terz sind die herausragenden archaischen...
| Erscheint lt. Verlag | 15.1.2014 |
|---|---|
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Medizin / Pharmazie ► Gesundheitsfachberufe ► Logopädie |
| Medizinische Fachgebiete ► Innere Medizin ► Pneumologie | |
| Schlagworte | Diagnostik von Stimmstörungen • ganzheitlicher Ansatz • Heiserkeit • KIIST • Leitlinien Stimmtherapie • Logopädie • Osteopathie • Stimmerkrankung • Stimmfunktion • Stimmtherapie |
| ISBN-10 | 3-13-177432-0 / 3131774320 |
| ISBN-13 | 978-3-13-177432-3 / 9783131774323 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich