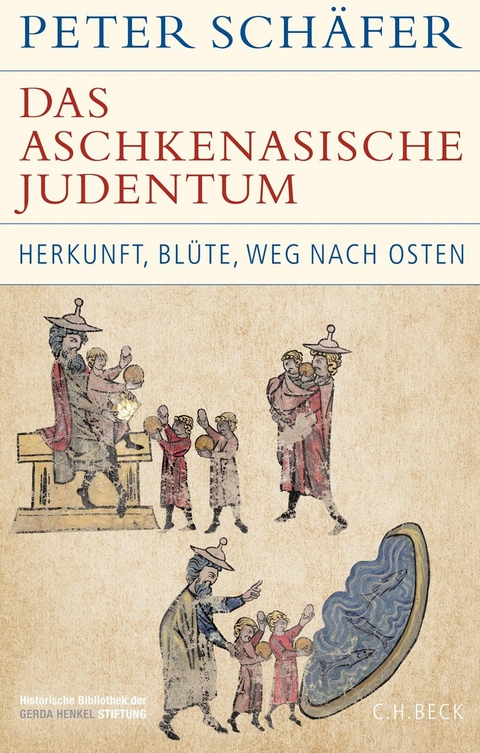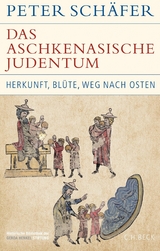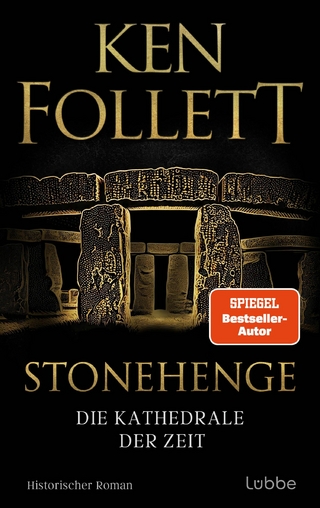Das aschkenasische Judentum (eBook)
560 Seiten
C.H.Beck (Verlag)
978-3-406-81248-4 (ISBN)
Ein Edikt des Kaisers Konstantin aus dem Jahr 321 betrifft die Juden in Köln, doch erst für die Zeit um das Jahr 1000 sind jüdische Gemeinden in Köln, Mainz, Speyer, Worms, Regensburg, Prag oder Frankfurt sicher belegt. Woher kamen diese Juden? Wie waren ihre Gemeinden organisiert? Wovon lebten sie, und welche Beziehungen pflegten sie zu ihrer christlichen Umgebung? Peter Schäfer kennt wie kaum ein anderer die Schriften des mittelalterlichen Judentums und beschreibt auf ihrer Grundlage – jenseits der bis heute verbreiteten Klischeevorstellungen – den Alltag und die mystisch geprägte Frömmigkeit der aschkenasischen Juden. Er erzählt von den Verfolgungen und Vertreibungen im Spätmittelalter, der erneuten Blüte jüdischen Lebens in Polen, Litauen und Russland und vom Weg der Juden in eine ambivalente Moderne, die Emanzipation versprach und Vernichtung brachte. Seither liegen die Zentren des aschkenasischen Judentums in den USA und Israel, doch seine Wurzeln reichen weit in das europäische Ostjudentum, in das mittelalterliche Deutschland und in die Antike zurück.
| Erscheint lt. Verlag | 15.2.2024 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung | Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung |
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte ► Regional- / Ländergeschichte | |
| Geisteswissenschaften ► Religion / Theologie ► Judentum | |
| Schlagworte | Antisemitismus • Archäologie • Aschkenas • Deutschland • Geschichte • Herkunft • Holocaust • Israel • Judaistik • Juden • Judentum • Köln • Mainz • Mittelalter • Mitteleuropa • Osteuropa • Ostjudentum • Speyer • USA • Worms |
| ISBN-10 | 3-406-81248-1 / 3406812481 |
| ISBN-13 | 978-3-406-81248-4 / 9783406812484 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich