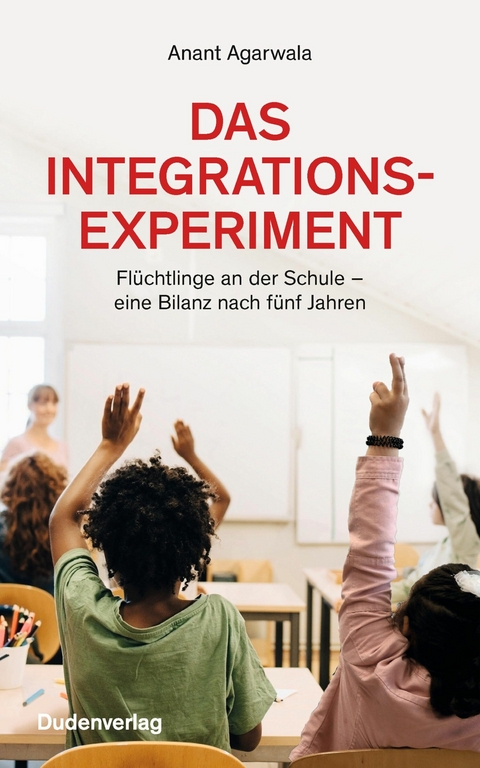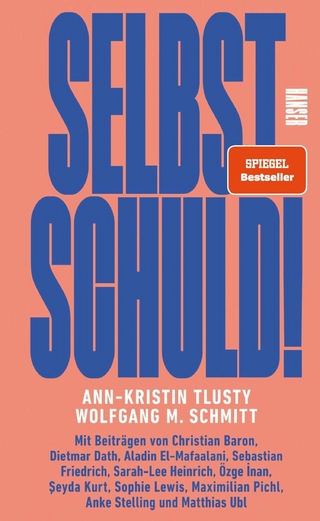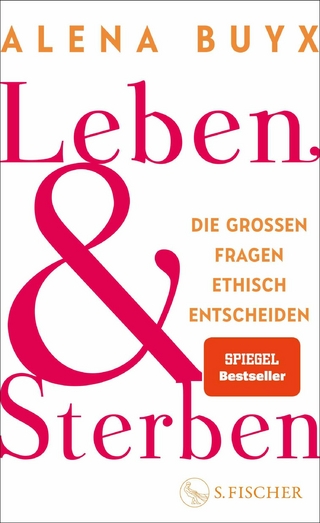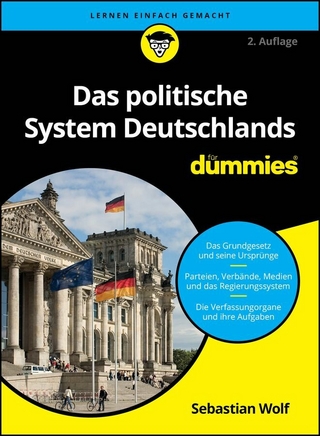Das Integrationsexperiment (eBook)
Anant Agarwala, 33, hat Kommunikationswissenschaft und Germanistik in Hamburg und Münster studiert und die Deutsche Journalistenschule in München besucht. Er ist Redakteur der ZEIT und wurde für seine Berichterstattung 2016 mit dem Goethe-Medienpreis für wissenschaftspolitischen Journalismus und 2017 mit dem Telekompreis für Bildungsjournalismus ausgezeichnet; 2019 war er für den Reporterpreis nominiert. Für die ZEIT schreibt er vor allem über Bildung und Gesellschaftspolitik.
Anant Agarwala, 33, hat Kommunikationswissenschaft und Germanistik in Hamburg und Münster studiert und die Deutsche Journalistenschule in München besucht. Er ist Redakteur der ZEIT und wurde für seine Berichterstattung 2016 mit dem Goethe-Medienpreis für wissenschaftspolitischen Journalismus und 2017 mit dem Telekompreis für Bildungsjournalismus ausgezeichnet; 2019 war er für den Reporterpreis nominiert. Für die ZEIT schreibt er vor allem über Bildung und Gesellschaftspolitik.
1 FÜNF JAHRE DANACH
Wieso eine Bilanz wichtig ist
Einige Monate bevor an einem Septemberwochenende im Jahr 2015 Tausende Flüchtlinge am Münchner Hauptbahnhof mit Applaus und Bonbons empfangen wurden, lief ich als Reporter über die Bahnsteige. Schon damals, im November 2014, saßen täglich Migranten in den Zügen aus Italien. Ich wollte schauen, wie das ist: ankommen in Deutschland. Manchmal wartete die Polizei auf sie, nahm Personalien auf und schickte sie mit ein paar Zetteln, die sie nicht lesen konnten, zu einem Shuttle-Bus, der nicht kam. Manchmal wartete niemand. Dann verschwanden sie auf einer der vielen Rolltreppen in der Ungewissheit. Die wenigsten waren älter als Anfang 20.
Ein paar Wochen später, es war der Montag nach dem 2. Advent, stand ich in einer Menschenmenge in der Dresdner Innenstadt. Von einem Bühnenwagen hallten Parolen gegen »angeblich traumatisierte Flüchtlinge«, »Asylmissbrauch« und »Islamisierung« in die Nacht. »Wir sind das Volk!«, skandierte die Menge. Es waren die ersten Wochen von Pegida.
Da braute sich etwas zusammen. Dabei hatte 2015, das Jahr, das viele als Zäsur begreifen, noch nicht einmal begonnen.
Im August 2015 nahmen mich Ärzte mit in ein Flüchtlingslager. Das Camp befand sich am Stadtrand von Dresden, erinnerte mich aber an Nachrichtenbilder aus dem Libanon, wo damals Hunderttausende syrischer Bürgerkriegsflüchtlinge ausharrten. In der Zeltstadt in Sachsen gab es zu wenig Toiletten und Desinfektionsmittel, auch fließend Wasser und Essen waren knapp; die Krätze hätte sich ausgebreitet, erzählten die Ärzte. Zwischen den Zelten jagten Kinder einen Fußball durch den Staub.
Immer wieder besuchte ich in den kommenden Monaten auch Schulen. Als Reporter, vor allem aber als Vormund für einen Afghanen, der als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Hamburg gekommen war. Das Engagement in den Schulen war groß, genauso aber der Frust. Bei den Lehrerinnen und Lehrern und bei denen, die in den Klassen saßen und nicht viel verstanden. Akkusativ? Bruchrechnung? Man experimentierte so vor sich hin, an jeder Schule ein bisschen anders. Wo es enden würde, wusste niemand.
Ich erlebte einen erstaunlich passiven Staat. Wenn man es wohlwollend sieht, könnte man sagen, er setzte viel Vertrauen in jeden Einzelnen. Sieht man es weniger wohlwollend, müsste man sagen: er ließ seine Einwohner1, die alten und die neuen, in einer Ausnahmesituation allein.
Es schien damals so, als würde ein einzelnes Wort genügen, um die deutsche Gegenwart zu beschreiben: Flüchtlingskrise. Der Begriff ist umstritten, weil er nahezulegen scheint, die Flüchtlinge wären für die Krise verantwortlich. Und nicht Bürgerkrieg oder Taliban, Bundesregierung oder Behörden. Ich verwende ihn, weil es keine präzisere Alternative gibt und er sich im allgemeinen Sprachgebrauch durchgesetzt hat. Es war ja auch eine Krise: zunächst einmal für die geflüchteten Menschen selbst, aber auch für viele aufnehmende Kommunen, für Behörden oder eben Schulen. Und über diese Krise zerstritten sich Familien, Volksparteien – und Lehrerzimmer.
Beschränkte sich der Kontakt zu Flüchtlingen für die meisten Deutschen, wenn überhaupt, zunächst auf Bahnhofshallen oder Discounterkassen, wurden die Schulen zu Orten echter Begegnung, man könnte auch sagen: Konfrontation. Über kaum etwas im Land brach die neue Wirklichkeit so unmittelbar herein wie über Grund-, Sekundar- und Berufsschulen. Während es zum Teil Jahre dauert, bis erwachsene Zuwanderer in Deutschland Arbeit finden, gilt die Schulpflicht relativ schnell, egal, wie es ums Asylverfahren steht. Hunderttausende Kinder und Jugendliche, die in Kabul, Homs oder Mossul aufgebrochen waren, mussten plötzlich unterrichtet werden. Für die jungen Flüchtlinge, von denen viele eines Tages mal Deutsche sein werden, hier leben und arbeiten wollen, wurden die Schulen zu Fenstern in ihre neue Heimat. In Sprache, Regeln, Eigenarten.
Jede Schule eröffnete ihr eigenes Integrationslabor
Nicht lange nach dem »Wir schaffen das!« von Kanzlerin Angela Merkel hatte auch der letzte entfernt involvierte Politiker die Phrase von »Bildung als Schlüssel zur Integration« zum Besten gegeben. Von konkreten Ideen, wie genau das gelingen solle, hörte man dann allerdings wenig. Nur so viel schien klar: Ob Deutschland und die Flüchtlinge »das« schafften, würde davon abhängen, ob die Schulen das schafften. Bloß waren diese auf die immense Aufgabe, die sie erwartete, überhaupt nicht vorbereitet. Verfügbare Lehrkräfte, die wussten, wie man Ausländern Deutsch beibringt, gab es schlicht nicht. Erprobte Konzepte, wie man so viele »sprachlose« Schüler möglichst schnell und reibungslos in bestehende Klassenverbände integrieren könnte, lagen weder in Lehrerzimmern noch Behörden bereit. Und weil in Bildungsfragen der Bund nichts zu sagen hat, machten die 16 Länder ihr eigenes Ding. Für wissenschaftliche Empirie blieb dabei keine Zeit, die neuen Schüler standen ja schon im Sekretariat. Also wurde improvisiert. Von Flensburg bis Freiburg entstanden: Integrationslabore. Über die Versuchsanordnung im Klassenzimmer entschieden die Schulleitungen vor Ort. Je nachdem, welche Lehrer sich bereit erklärten, welche Räume gerade frei waren – und wer ihre Probanden.
Die Neuankömmlinge sprachen alle kein Deutsch, aber damit endeten oft schon die Gemeinsamkeiten. Manche hatten nie eine Schule besucht und konnten selbst in ihrer Landessprache weder lesen noch schreiben. Die nächsten kamen mit guten Zeugnissen und träumten davon, bald Zahnmedizin oder Maschinenbau zu studieren. Einige von ihnen hatten Unvorstellbares erlebt, verkrochen sich unter ihrem Tisch, wenn es zur Pause läutete. Nun saßen sie nebeneinander in einer Klasse: 20 Schüler, zehn Nationalitäten, die eine noch ein Kind, der nächste schon fast erwachsen. Vor ihnen standen Lehrerinnen und Lehrer, die oft so motiviert wie überfordert waren. Sie hielten bunte Bilder hoch und schrieben Wörter an die Tafel: Haus, Küche, Abendbrot.
Und so wusste manch eine Pädagogin schon früher als Bundestagsabgeordnete oder Bildungsforscher, welche Potenziale und Probleme mit den vielen neuen Mitmenschen tatsächlich Deutschland erreicht hatten. Die entscheidenden Fragen konnten aber auch sie zunächst nicht beantworten: Auf welche Schulen gehören sie? Wie schnell lernen sie Deutsch? Werden sie jemals einen Abschluss schaffen?
Dass man über die neuen Schüler wenig wusste, änderte freilich nichts daran, dass man viel zu wissen meinte. Je nach politischer Couleur projizierte die deutsche Öffentlichkeit das Ende des Abendlandes oder das Ende des Fachkräftemangels in die Flüchtlinge. Ein Heer aus Analphabeten, das erst die Schulen und später die Sozialkassen kollabieren lässt, unkte es von rechts. Bildungshungrige, die das darbende Handwerk und die medizinische Versorgung in der Provinz wiederbeleben, frohlockte es von links. Auf belastbaren Tatsachen bauten diese Zuschreibungen nicht auf. Halbwissen und Ideologie vermischten sich zu einem thesenstarken und faktenarmen Bodensatz für Talkshowstreits und Leitartikel.
Fünf Jahre sind seit den Wirren des Flüchtlingssommers vergangen. Fünf Jahre, in denen viel über kriminelle Migranten und Anschläge auf Flüchtlingsheime, Abschiebezahlen und den Aufstieg der AfD diskutiert wurde. Und erstaunlich wenig über den Integrationsalltag in den Schulen. Auf ihn möchte ich mich konzentrieren.
Recht auf Bildung? Recht auf gute Bildung!
Die UN-Kinderrechtskonvention garantiert das Recht auf Bildung. Ich bin der Überzeugung, dass dies nur der Minimalkonsens sein darf in einer Demokratie wie Deutschland, deren Wohlstand und Liberalität von gut ausgebildeten und mündigen Bürgerinnen und Bürgern abhängt – und somit von seinen Schulen. Der Anspruch muss lauten: Alle Kinder haben ein Recht auf gute Bildung. Also nicht bloß darauf, verwahrt oder durchgeschleppt, sondern gefördert zu werden. Und zwar auch die, die neu dazukommen, aber nicht zulasten derjenigen, die schon da sind. Keine einfache Aufgabe. Wie die Schulen sie bewältigen, das ist die Leitfrage dieses Buches.
Haben sich die sogenannten Willkommensklassen bewährt oder wurden sie zu Aufbewahrungsstätten ohne Ausgang? Wie funktioniert der Übergang in die Regelklassen? Woran sind Schüler und Lehrer verzweifelt? Hat das Niveau unter den Neuen gelitten? Gibt es so etwas wie einen Goldstandard der (schulischen) Integration? Wie klappt der Übergang aus der Schule in die Ausbildung? Und was lernen wir daraus, für Deutschland als Bildungs- und Einwanderungsnation?
Nicht auf alle Fragen gibt es wissenschaftlich valide, quantifizierbare Antworten. Allerdings haben Bildungsforscher, Bundesämter und Ministerien in den vergangenen Jahren einige Studien, Befragungen und Statistiken veröffentlicht. Die gesammelten Erkenntnisse bilden das Fundament der einzelnen Kapitel. Doch so sehr Zahlen und Tabellen die Welt verständlicher machen: die Vielfalt der Erfahrungen, die in diesem gesellschaftlichen Großexperiment gemacht wurden und werden, bilden sie nicht ab. Also gucken wir in Integrationslabore, wo in fünf Jahren aus Chaos hier Routine wurde und dort Resignation. Ich habe während meiner Recherche Interviews mit über 70 aktuellen und ehemaligen Schulleiterinnen und Lehrern, Ministerialbeamten und Wissenschaftlerinnen und nicht zuletzt Schülerinnen und Schülern geführt. Nicht all ihre Geschichten und Erfahrungen haben Eingang in das Buch gefunden, aber einige von ihnen begleiten uns durch die Kapitel auf der Suche nach der guten Schule von morgen.
Denn der Blick zurück weist nach vorn. Während der Recherche für dieses Buch vertrieben Bomben...
| Erscheint lt. Verlag | 5.10.2020 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Duden - Sachbuch |
| Duden - Sachbuch | Duden-Sachbuch |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft | |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Arbeit • Arbeitslos • Arbeitsmarkt • Asylbewerber • Berufsschule • Bildung • Bildungsnotstand • Chancengleichheit • Flüchtlinge • Gymnasium • Integration • Integrationsklassen • internationale Klassen • Migration • Moria • Realschule • Schulabschluss • Schule • Willkommensklasse |
| ISBN-13 | 9783411913206 / 9783411913206 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich