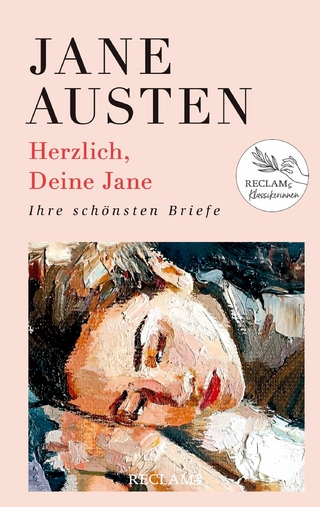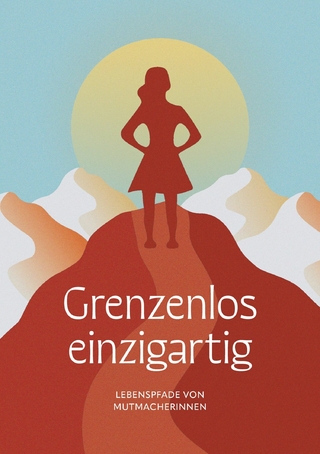Liebe, Arbeit, Gottvertrauen (eBook)
168 Seiten
Books on Demand (Verlag)
978-3-7526-4983-3 (ISBN)
Jürgen Scheibler ist ein Enkel von Liesbeth und Johann Jakob, der Sohn der Tochter Thea. Er wurde 1959 in Zittau geboren und verbrachte seine Kindheit in Hagenwerder, einem kleinen Ort zwischen Zittau und Görlitz. Nach der Schulzeit studierte er Elektronik und Feingerätetechnik an der Technischen Universität Dresden. Er arbeitet seit 1986 an der Hochschule Zittau, auf deren Bildungstradition nach der Wende die Fachhochschule Zittau/Görlitz gegründet wurde. Jürgen Scheibler lebt mit seiner Frau in Dittersbach, einem kleinen Dorf in der Oberlausitz nur wenige Kilometer von der Lausitzer Neiße entfernt.
Das Elternhaus von Liesbeth Jakob
Während Königshain und der größte Teil von Seitendorf seit dem Mittelalter im Besitz des Klosters St. Marienthal waren, gehörten die Nachbarorte Dornhennersdorf und Weigsdorf viele Jahrhunderte zur Standesherrschaft Reibersdorf, wo sich der Einfluss der lutherischen Reformation durchgesetzt hatte.
Die Mehrzahl der Einwohner lebten im evangelischen Glauben. Auch die Weikelts in Weigsdorf gehörten der evangelischen Kirche an.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts spielte die Kirche im Leben der Menschen eine große Rolle. Der sonntägliche Besuch der Gottesdienste gehörte ebenso selbstverständlich zum Alltag wie die kirchliche Erziehung der Kinder. Der Taufe in den ersten Lebensjahren folgten der Religionsunterricht beim Pfarrer und die Konfirmation. Dieses erste große Fest wurde von den Kindern sehnsüchtig erwartet und voller Stolz traten sie in die Welt der Erwachsenen ein. Dabei spielte es für die einfachen Menschen in den Dörfern kaum eine Rolle, ob der Freund oder Nachbar der gleichen Konfession angehörte oder nicht. Jede Familie lebte in der Tradition ihrer Vorfahren. Für die Jugend, die neben der harten Arbeit in der Landwirtschaft und in den Textilbetrieben auch Spaß und Freude am Leben haben wollte, stellten sich Fragen zu unterschiedlichen Religionen eher selten.
Natürlich gab es keine Vorschriften darüber, dass nur im eigenen Glauben geheiratet werden durfte. Dennoch sahen es die Geistlichen der katholischen Kirche nicht gern, wenn sich die katholisch erzogenen, jungen Burschen aus Königshain und Seitendorf für die Mädchen der evangelischen Nachbarorte interessierten.
Hulda Weikelt, die mittlere der drei Töchter von Tischlermeister Weikelt, ging nach der Schule nach Reichenau, um als ungelernte Hilfskraft an den zahlreichen Webstühlen der Weberei Preibisch zu arbeiten. In der Zeit um die Jahrhundertwende und in den ersten Jahrzehnten danach war es für junge Frauen nicht ungewöhnlich, die Jahre bis zur Hochzeit und Gründung einer Familie zu arbeiten. Der größte Teil fand eine Stellung in der Landwirtschaft, aber auch die vielen Oberlausitzer Textilbetriebe brauchten billige Arbeitskräfte für einfache Arbeiten.
Reichenau war der größte Ort der Umgebung östlich von Zittau. An den Wochenenden war immer für Unterhaltung und Vergnügen gesorgt. Auf dem wöchentlichen Markt wurde mit allen Dingen gehandelt, die die Bauern, Handwerker und Weber in häuslicher Arbeit herstellten. In den Wirtshäusern wurde getrunken, getanzt, gelacht und so manche Reichsmark verspielt.
So lernte Hulda Weikelt eines Tages den sechs Monate jüngeren Johann Ferdinand Kretschmer aus Seitendorf kennen. Am 28. August 1909 wurde die Tochter Liesbeth im Elternhaus der Weikelts in Dornhennersdorf geboren. Sie sollte das einzige Kind bleiben. Geheiratet wurde aber erst ein Jahr später. Möglicherweise musste im Haus der Kretschmers in Seitendorf einiges umgebaut werden, um die junge Familie aufzunehmen. Es ist auch nicht auszuschließen, dass es Schwierigkeiten mit dem katholischen Pfarrer gab, der seinen Segen für diese Hochzeit nicht erteilen wollte. Der Zuzug von Menschen mit evangelischem Glauben nach Seitendorf war von der dominierenden katholischen Kirche und vom Kloster St. Marienthal als Besitzer eines Teils von Seitendorf nicht erwünscht. Man fürchtete, dass sich das kirchliche Kräfteverhältnis immer mehr zu Gunsten der Protestanten veränderte.
Nach der Hochzeit am 27. November 1910 in der evangelischen Kirche in Seitendorf zog Hulda mit Töchterchen Liesbeth in das Haus der Kretschmers in Seitendorf ein, in dem die Schwiegereltern lebten.
Die glückliche Zeit, in der die kleine Liesbeth das Laufen lernte, die ersten Sätze sprechen konnte und die Welt mit ihren Kinderaugen erforschte, war mit Ausbruch des ersten Weltkrieges am ersten August 1914 plötzlich zu Ende. Die Kriegserklärung Deutschlands wurde in den ersten Wochen von der Bevölkerung mit Begeisterung aufgenommen. Die politischen Parteien waren sich einig, dass es sich um einen Verteidigungskrieg handelte und bewilligten Kriegskredite.
Liesbeths Vater Johann Franz Kretschmer wurde mit neunundzwanzig Jahren sofort zum Militär eingezogen und bekam den ersten Einsatzbefehl nach Frankreich. Den anfänglichen Erfolgen und dem problemlosen Durchmarsch durch Belgien folgte auf dem Weg nach Paris die erste große Schlacht gegen die Franzosen an der Marne. In den vom 5. bis 12. September andauernden Kämpfen wurde der Vormarsch der deutschen Truppen gestoppt. Aus einem Schützengraben an der Front, den Gegner direkt vor Augen, schrieb Johann eine Postkarte an seine Familie zu Hause in Deutschland. Er hatte nicht viel Zeit an diesem Tag, da ständig mit einem Angriff der Franzosen gerechnet werden musste. Er kündigte einen längeren Brief an, in dem er seine ersten Tage im Kriegseinsatz schildern wollte. Dieser Brief wurde nie geschrieben.
Der Vater der erst fünfjährigen Liesbeth starb im Jahr 1914 kurz nach Kriegsbeginn in einem Lazarett in Frankreich. Für Hulda war es ein furchtbarer Schock, hatte doch ihr friedliches und glückliches Leben gerade erst begonnen. Aber auch die Schwiegereltern im Haus konnten das harte Schicksal nicht begreifen. Sie hatten ihren Sohn verloren. Die starke Verbindung zur Kirche und ihr tiefer Glauben halfen ihnen in den folgenden Jahren weiterzuleben.
Die Lebensverhältnisse der Familie wurden nach Johanns Tod schwieriger. In den Kriegsjahren und den Jahren danach war es ohnehin schwierig, die notwendigen Lebensmittel zu beschaffen. Da weder die Familie ihres Mannes noch ihre eigene aus der Landwirtschaft kamen, brauchte Hulda Geld, um die täglichen Dinge für sich und Liesbeth kaufen zu können. Sie entschloss sich deshalb, wieder in die Weberei nach Reichenau arbeiten zu gehen. Der Besitzer Herr Preibisch kannte Hulda noch aus der Zeit, als sie nach der Schule bereits viele Jahre dort gearbeitet hatte. Und er schätzte sie. Hulda war arbeitsam und konnte mit ihrer Erfahrung fast alle notwendigen Arbeiten an den Webstühlen leisten. Herr Preibisch wusste, dass er sich auf die junge Frau aus Seitendorf immer verlassen konnte.
Jeden Tag kam sie die sechs Kilometer zu Fuß vom Nachbardorf nach Reichenau, um dann zwölf Stunden an den Webmaschinen zu stehen. Besonders im Winter bedurfte es großer Anstrengungen, den ungeschützten Feldweg über das Sandbüschel zu überwinden. Aber Hulda mochte die Arbeit. Sie blieb bis Anfang der dreißiger Jahre im Betrieb. In den vielen Jahren erarbeitete sie sich eine gute Stellung. Als Anerkennung für ihre Treue und ihre Aufopferung durfte Hulda für zwei Wochen zur Kur nach Bad Schandau ins Elbsandsteingebirge fahren. Für die damalige Zeit war dies eine besondere Geste der Werkleitung, die nur wenige Mitarbeiter erhielten.
Im Haus der Schwiegereltern lebte inzwischen noch ein kleiner Junge, Hans Gold, der von den Kretschmers als Pflegekind aufgenommen wurde. Hans wurde 1920 geboren und konnte von seiner leibliche Mutter nicht großgezogen werden. Sie gab ihren Sohn in das Asyl in Ostritz, das dem katholischen Pfarramt unterstand. Die Geistlichen hofften immer auf gläubige und barmherzige Katholiken, die eines der vielen Kinder als Pflegekind in ihr eigenes Haus aufnahmen. Anna und Johann Kretschmer wollten als gläubige
Christen auch im Alter von sechzig Jahren noch etwas Gutes tun in dieser schwierigen Zeit nach dem verlorenen Krieg. Eine sehr großherzige und selbstlose Tat war die Aufnahme des kleinen Hans, der dadurch wieder ein Elternhaus bekam. Vielleicht sahen die Großeltern von Liesbeth in Hans einen Ersatz für den schmerzlichen Verlust ihres Sohnes.
Seitendorf hatte in dieser Zeit eine ganz besondere Verbindung zum Kloster St. Marienthal, nicht nur weil große Teile des Dorfes in dessen Besitz waren. Die 1895 in Seitendorf geborene Mechthild Gutte legte 1914 das Gelübde ab und nahm den Namen Schwester Celsa an. Sie sah es als ihre Berufung an, im Kloster Gott zu dienen und den Menschen zu helfen. Vier Jahre später begann sie eine Ausbildung als Lehrerin und gab den Waisenkindern Unterricht im Lesen und Schreiben. Im Waisenhaus im Kloster wurden ausschließlich Mädchen untergebracht.
Die Verbindung zu Schwester Celsa hatte sicher eine Rolle gespielt, aber die Aufnahme von Hans Gold war nicht allein die Entscheidung der Schwiegereltern. Hulda wusste, dass bei der Erziehung eines Kleinkindes auch auf ihr viel Arbeit lasten würde. Sie dachte an Liesbeth, die als Einzelkind aufwachsen und ohne den Vater auf vieles verzichten musste.
So war der Einzug des kleinen Hans in das Haus ein großes Glück für alle. Von Anfang an gehörte er zur Familie. Er wuchs zu einem intelligenten und lebhaften Jungen heran. Liesbeth und Hans lebten als Geschwister, wenn auch der Altersunterschied mit elf Jahren recht groß war. Wenn Liesbeth aus der Schule kam, war ihr erster Blick in den Kinderwagen. Nach den Hausaufgaben machte sie so manche Spazierfahrt mit Hans, schaute bei den Freundinnen vorbei oder kaufte eine Semmel beim Bäcker im Oberdorf. Als sie die Schulzeit beendete, war Hans vier Jahre alt. Er spielte am liebsten im Garten. Kein Baum war vor ihm sicher und wenn es regnete, mussten alle Pfützen auf dem Weg auf deren Tiefe...
| Erscheint lt. Verlag | 28.8.2020 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Briefe / Tagebücher |
| Schlagworte | Lausitzer Neiße • Neuanfang • Teilung Deutschland • Vertreibung • Zweiter Weltkrieg |
| ISBN-10 | 3-7526-4983-6 / 3752649836 |
| ISBN-13 | 978-3-7526-4983-3 / 9783752649833 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich