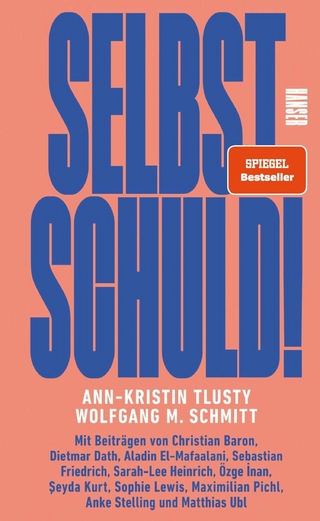Ohnekind (eBook)
»Ein beeindruckend mutiges und aufschlussreiches Dokument, das persönlich Anteil nehmen lässt und thematisch aufklärt. Benedikt Schwan schreibt gegen ein Stigma an und findet Worte, wo die meisten schweigen.« Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl
Benedikt Schwan, Jahrgang 1975, schreibt als Journalist seit über 20 Jahren über Technologie, Wissenschaft, Forschung und Medien. Seine Texte sind u.a. in »Zeit Online«, »Focus«, »Die Welt«, »Spiegel Online«, »heise online«, »Technology Review«, »c’t« und der »Süddeutschen Zeitung« erschienen, seine Radiobeiträge im Hörfunk der ARD, bei Deutschlandradio Kultur und anderen Sendern. »Ohnekind« ist sein erstes Buch.
1Kinderwunschzentrum
Beim Arzt.
»Wo bin ich hier nur hingeraten!«, rufe ich leise in den Raum, aber niemand antwortet. In mir macht sich ein Gefühl der Ohnmacht breit. Obwohl die Wichskabinen im Kinderwunschzentrum eigentlich ganz gemütlich aussehen.
Es liegen vor mir, gleich hinter der Tür: ein Halbsofa aus schwarzem Kunstleder, auf dem mit nicht zu unterschätzendem Geschick eine kratzige Papierfolie drapiert ist, an der ich mir später die Finger abwischen werde; eine mit einer Kunststoffwand abgetrennte Wasch- und Toilettennische mit Pissoir einer renommierten deutschen Sanitärmarke, denn dieser Raum ist nur für Männer gedacht; ein mit rustikalem Holz umbauter Heizkörper, der leicht muffige Luft ausdampft. Hinter der Sitzgelegenheit befindet sich schließlich noch ein starr gekipptes Fenster, das ich mit viel Mühe geschlossen bekomme, denn Straßengeräusche kann ich jetzt wirklich nicht gebrauchen.
Der DVD-Spieler will nicht so recht. Die erste Bildplatte, die anläuft, ist ein Porno mit einer unansehnlichen blonden Frau. Mein Penis kann damit wenig bis nichts anfangen, weshalb ich die DVD wechsle. Die Auswahl ist beschränkt. Ich finde nur noch einen offenbar aus Brasilien stammenden Streifen vor, mit mehreren Frauen mit Ballon-Popos auf dem Cover, die sich einträchtig vor einem Mann in schwarzem Muskelshirt niedergekniet haben. Okay, damit kann ich arbeiten. Eine Cybersex-Sitzung via FaceTime hatte zuvor meine Frau dankend abgelehnt, was ich ihr wegen der aktuellen Uhrzeit nicht verdenke – es ist kurz nach acht. »Da musst du leider alleine durch«, hatte sie lachend gesagt.
Es will mir einfach nicht gelingen, die DVD einzuschieben. Die alte kommt zwar heraus, doch die neue will nicht hinein. Das Slot-In-Laufwerk spuckt sie immer wieder aus. Mit freiem Unterleib, minimal erigiertem Penis und einer Hose unter den Kniekehlen versuche ich, die Scheibe zu reinigen, sie wurde vermutlich von Hunderten meiner Leidensgenossen malträtiert. Schließlich und endlich läuft der Film an, und ich spule mich bis zu dem, was ich für die besten Szenen halte, vor. Nach einer guten Viertelstunde habe ich schließlich den Becher mit einigen Millilitern Sperma gefüllt.
»Normalerweise kommt bei mir mehr raus«, versuche ich die freundliche Schwester um die dreißig zum Lachen zu bringen, als ich den Raum verlasse und die Probe abgebe. Sie lächelt kurz und meint, das reiche doch für den Test dicke. »Na dann, allet schicki«, sage ich zum Abschied in einem Berlinerisch, das meine Frau für imitiert hält.
Der Warteraum des Kinderwunschzentrums, in dem ich einige Stunden später sitze, wirkt auf mich wie der traurigste umbaute Ort Berlins, Deutschlands, vielleicht Westeuropas. Zwei Stuhlreihen sitzen sich gegenüber, zum Fenster hin ist eine Ablage mit Broschüren und Zeitschriften, schlechtem Kaffee aus einem großen Thermobehälter und einigen Keksen angebracht.
Auf einem Bildschirm läuft Werbung für die Wundermethoden, die die Herren und Damen Doktoren hier offerieren. Ich lese etwas von sich nicht schnell genug bewegenden Spermien, denen man mit einer Art Erfolgsgarantie Beine machen zu können scheint. Es werden Details des menschlichen Fortpflanzungsapparats erklärt, die ich bisher weder kannte noch kennenlernen wollte. Probleme des Gebärmutterschleims haben mich zum Beispiel wirklich noch nie interessiert, doch das scheint sehr wichtig zu sein. Aber, so signalisieren die Fotos des lächelnden Ärzteteams und der Frauen und Männer mit glücklichen Kindern auf dem Schoß, die immer wieder eingeblendet werden: »Na dann, allet schicki.«
Während meiner rund einstündigen Wartezeit betreten immer wieder Paare den Raum, deren Gesichter eine merkwürdige Mischung aus Hoffnungsfreude und tiefer Müdigkeit kennzeichnet. Jeder einzelne dieser Menschen grüßt mich freundlich, als gehörten wir zu einer traurigen Schicksalsgemeinschaft. Ich sehe dich, sagen mir diese Blicke, und du siehst mich. Ich weiß, wie es mir geht, du weißt, wie es mir geht.
Manchmal komme ich mir etwas hochmütig vor, weil ich irgendwie das Gefühl habe, überhaupt nicht hierherzugehören. Ich brauche das nicht, ich will nicht einer von denen sein, die es nötig haben, am letzten Rockzipfel der Hoffnung zu hängen. Wenn es nicht geht, geht es halt nicht.
Zuletzt betritt noch eine Frau mit drei Kindern den Raum. Beinahe hätte ich laut gesagt, dass manche Menschen wohl nicht genug kriegen können. Ich habe es nur gedacht. Wer weiß, welche Umstände dafür gesorgt haben, dass sie heute auch hier im Kinderwunschzentrum ist.
Als ich schließlich dem Arzt gegenübersitze, merke ich, wie mich eine Schwere überkommt. Der Mann ist ein netter Kerl, etwas älter als ich.
Wir reden, was mir gefällt, über ein paar Filme aus seinem Fachgebiet, darunter das Genomik-Märchen Gattaca aus den Neunzigern, ein durchaus sehenswerter Science-Fiction-Film, der sich um eine gentechnisch kontrollierte, albtraumhafte Gesellschaft dreht.
»Wenn wir nicht aufpassen, kommen wir da hin«, bemerkt er. Dann zaubert er mein Spermiogramm auf seinen Flachbildschirm. Federnd bewegt der Arzt seinen Zeigefinger über das Trackpad.
»Ja, hmm«, sagt er dann und reibt sich nachdenklich das gut und glatt rasierte Kinn. »Es sieht so aus, als sei da nichts drin.«
Ich merke, wie das Blut in mein Gesicht schießt und sich mein Herzschlag beschleunigt. Ich berappele mich kurz und sage im besten mir möglichen Journalistenton, der normalerweise darauf ausgelegt ist, investigativ auf den Putz zu hauen: »Was meinen Sie damit?«
Der Arzt erklärt mir etwas von der Spermienentstehung in den Hoden, den dafür zuständigen Hormonen. »Laut unserer Ergebnisse aus den Bluttests versucht Ihr Körper Spermien zu produzieren, das ist so auch hormonell angezeigt. Das funktioniert aber nicht. Im Ejakulat sind keine Samenzellen nachzuweisen.«
Es folgt eine mir im Nachhinein nur noch schwer erinnerliche halbe Stunde, in der mir der Arzt die möglichen Gründe für meine Sterilität, also meine Unfruchtbarkeit beziehungsweise meine Zeugungsunfähigkeit, zu kommunizieren versucht. »Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit genetisch bedingt.« Ich frage, ob es sein kann, dass ich schon seit meiner Geburt steril bin. Das sei durchaus möglich, erwidert er.
Zu diesem Zeitpunkt bin ich einundvierzig Jahre alt. Ich erinnere mich an die vielen Versuche des letzten halben Jahrs, meine Frau endlich schwanger zu bekommen – und die Jahre davor, in der mir auch noch nie ein Treffer gelungen war, wenn auch zu jener Zeit dankenswerterweise.
Als Nächstes kommt eine Erläuterung der möglichen Prozeduren, mit denen man meiner Unzulänglichkeit abhelfen könnte. Mir werden Begrifflichkeiten an den Kopf geworfen, die ich noch nie gehört habe. »Wir haben da einen sehr guten Urologen«, sagt der Arzt. »Es wäre natürlich alles unter Vollnarkose.«
Wie er mir, der übrigens ausgebildeter Frauenarzt ist, weiter erläutert, ist es möglich, aus den Hoden operativ Spermien zu entnehmen, sollten diese denn überhaupt vorhanden sein. Die Chancen dafür stünden gar nicht so schlecht. Anschließend würden diese Spermien auf ihre Lebensfähigkeit geprüft, und es folge dann nach Eientnahme bei der Frau eine Befruchtung im Reagenzglas. Wir verabschieden uns, und er wünscht mir alles Gute, zum nächsten Besuch solle ich doch meine Frau mitbringen. Als ich in der Kühle dieses Wintertags auf der Straße stehe, fühlt sich alles taub an.
Wasserschaden.
Mir hat ein äußerst kluger und wirklich gut aussehender Sanierungshandwerker aus Berlin-Pankow – fein gezwirbelter Schnurrbart, Blaumann, selbst nach zwanzig Minuten intensiver chemischer Schimmelreinigung noch knitterfreier als viele meiner eigenen Polohemden – einmal erklärt, dass es für ein Gebäude nichts Schlimmeres gibt als Wasser. »Es greift die Substanz an. Übler ist nur noch, wenn Ihnen die Hütte abbrennt.«
Einige Monate nach meinem Besuch im Kinderwunschzentrum – ich habe das Problem, wie es meine mental-gesundheitlich unsinnvolle Art ist, zunächst in den hintersten Winkel meines Kopfs geschoben – zeigt mein iPhone beim Klingeln eine mir äußerst unangenehme Nummer. Es ist der Hausmeister unserer Wohnanlage in Berlin-Mitte, wo sich auch mein Büro befindet. Wenn der anruft, ist irgendetwas Schlimmes passiert. Er käme niemals auf die Idee, nur einmal kurz zu plauschen oder eine positive Nachricht per Sprachtelefonie zu übermitteln, obwohl ich ihm doch erst kürzlich ein hübsches Trinkgeld gegeben hatte. Freundliche Konversation macht er nach alter Berliner Tradition nur persönlich, wenn überhaupt.
Ohne auch nur ein halbwegs dahingemurmeltes »Hallo, wie geht’s Ihnen denn so?« fällt er mit der Tür ins Haus, beziehungsweise mit dem Spülmaschinenschlauch meines Nachbarn ein Stockwerk über mir in die Küche meines Büros. »Sie haben einen Wasserschaden an der Decke.« Und in der Kammer tropfe es wohl auch.
Man kann das Gefühl, das einen überfällt, wenn man das eigene Hab und Gut bedroht sieht, kaum beschreiben. Als ich Bilder vom letzten Hurrikan in New Orleans gesehen habe, mit all den Leuten, die ihre Habseligkeiten vor dem Wasser zu retten versuchten, kamen mir die Tränen. Nun glaube ich, mich bereits in einer ähnlichen Problemlage zu befinden. Der Hausmeister macht am Telefon keine Anstalten, mich in meiner Panik zu beruhigen. Wasser ist da, kann nirgendwohin und will durch das durch, was mir gehört.
Als ich im Büro eintreffe, zeigt sich, dass die Situation nicht ganz so dunkel ist, wie es...
| Erscheint lt. Verlag | 24.8.2020 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft | |
| Sachbuch/Ratgeber ► Gesundheit / Leben / Psychologie | |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Beziehung • Beziehungsratgeber • eBooks • Erfahrungsbericht • Familienplanung • Fruchtbarkeit • Fruchtbarkeitsstörung • Gesundheit • Hormonbehandlung • Kinderlosigkeit • Kinderwunsch • Kinderwunschbehandlung • Künstliche Befruchtung • Männer • Männergesundheit • Männerratgeber • Medizin • ohne Kind • schwanger werden • spermienqualität • Spermiogramm • Unerfüllter Kinderwunsch • Unfruchtbar • Unfruchtbarkeit • Wunschkind • Zeugungsunfähig |
| ISBN-10 | 3-641-24617-2 / 3641246172 |
| ISBN-13 | 978-3-641-24617-4 / 9783641246174 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich