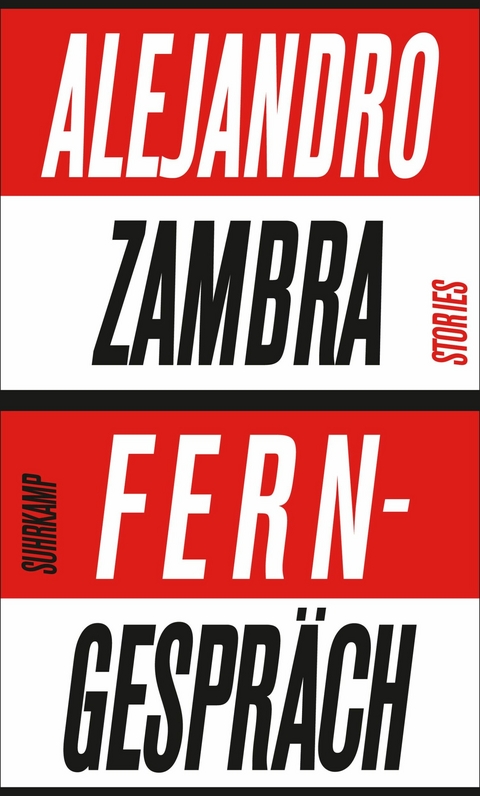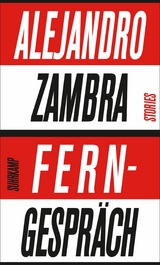Ferngespräch (eBook)
237 Seiten
Suhrkamp Verlag
978-3-518-75100-8 (ISBN)
In diesem Buch wird zurückgeschaut: auf die allerletzte Zigarette, den ersten eigenen Computer, auf Rückeroberungsversuche, hirnverbrannte Jobs, die Schule. Von liebenden, lügenden, kriminellen Männern, die die Paraderollen versäumt haben, die niemand Papa nennt, Chef oder Schatz. In einem Chile, für dessen Heldengeschichten sie zu allem Überfluss auch noch zu spät kamen. Ihre elf Stories finden sich in diesem Buch, jede ein Ferngespräch mit der eigenen Vergangenheit und eine Suche nach der Zeit, als Ängste wie Träume maßlos und unbegründet waren.
Alejandro Zambra schreibt die neueste Weltliteratur, und Ferngespräch ist ein schillerndes Meisterwerk. Mit einer Art des Erzählens, die kein Vorbild kennt, führt er uns an den Abgrundkanten von Alltag und Geschichte entlang - lässig, witzig und wehmütig.
<p>Alejandro Zambra, geboren 1975 in Santiago de Chile, gilt als einer der wichtigsten lateinamerikanischen Autoren seiner Generation. Der promovierte Hispanist leitet den Studiengang Editionswissenschaft an der Universität Diego Portales in Santiago und arbeitet als Kritiker für namhafte Tageszeitungen, darunter das chilenische El Mercurio und das spanische El País.</p> <p>Seine Romane, Erzählungen und Gedichte erscheinen in über zwanzig Ländern und erhielten zahlreiche nationale und internationale Preise. Sein Romandebüt <em>Bonsai</em> verhalf Zambra zum Durchbruch. Unter der Regie von Christián Jiménez wurde es für die Leinwand adaptiert und 2011 in Cannes uraufgeführt.</p>
Alejandro Zambra, geboren 1975 in Santiago de Chile, gilt als einer der wichtigsten lateinamerikanischen Autoren seiner Generation. Der promovierte Hispanist leitet den Studiengang Editionswissenschaft an der Universität Diego Portales in Santiago und arbeitet als Kritiker für namhafte Tageszeitungen, darunter das chilenische El Mercurio und das spanische El País. Seine Romane, Erzählungen und Gedichte erscheinen in über zwanzig Ländern und erhielten zahlreiche nationale und internationale Preise. Sein Romandebüt Bonsai verhalf Zambra zum Durchbruch. Unter der Regie von Christián Jiménez wurde es für die Leinwand adaptiert und 2011 in Cannes uraufgeführt. Susanne Lange, geboren 1964 in Berlin, studierte Komparatistik, Germanistik und Theaterwissenschaft. Seit 1992 ist sie als freiberufliche Übersetzerin spanischsprachiger Literatur tätig. Susanne Lange lebt in München und bei Barcelona.
EIGENE DOKUMENTE
für Natalia García
1
Einen Computer habe ich zum ersten Mal um 1980 gesehen, mit vier oder fünf Jahren, aber es ist eine verschwommene Erinnerung, womöglich vermische ich sie mit späteren Besuchen im Büro meines Vaters in der Calle Agustinas. Ich erinnere mich an meinen Vater, die unvermeidliche Zigarette in der Rechten, die schwarzen Augen auf meine gerichtet, wie er mir die Funktionsweise dieser riesigen Maschinen erklärt. Er erwartete Verblüffung, und ich täuschte Interesse vor, ging aber bei der nächstbesten Gelegenheit zum Spielen zu Loreto, einer Sekretärin mit langem Haar und schmalen Lippen, die sich meinen Namen nicht merken konnte.
Loretos elektrische Schreibmaschine war für mich dagegen ein Wunderwerk mit ihrem winzigen Bildschirm, auf dem sich die Wörter stauten, bis eine blitzschnelle Garbe sie aufs Papier nagelte. Der Mechanismus mochte dem eines Computers ähneln, aber dieser Gedanke kam mir nicht. Jedenfalls gefiel mir die Maschine besser, eine herkömmliche Olivetti in Schwarz, die ich gut kannte, weil zu Hause genau so eine stand. Meine Mutter hatte Programmieren studiert, war aber bald von den Computern abgekommen und bei dieser bescheideneren Technologie geblieben, die immer noch aktuell war, der Computer würde erst viel später zur Massenware werden.
Meine Mutter benützte die Schreibmaschine nicht für bezahlte Arbeiten, sie tippte die Lieder, Erzählungen und Gedichte meiner Großmutter ab, die ständig an Wettbewerben teilnahm oder an einem Projekt feilte, das sie endlich aus der Anonymität reißen sollte. Ich erinnere mich, wie meine Mutter am Esstisch saß, behutsam das Durchschlagpapier einspannte und Fehler sorgfältig mit Tipp-Ex korrigierte. Sie schrieb sehr schnell, mit allen Fingern, ohne auf die Tasten zu sehen.
Vielleicht kann ich es so ausdrücken: Mein Vater war ein Computer, meine Mutter eine Schreibmaschine.
2
Schnell lernte ich, meinen Namen zu tippen, ahmte auf der Tastatur aber lieber die Trommelwirbel der Märsche nach. Zur Militärkapelle zu gehören war für uns die höchste aller Auszeichnungen. Jeder wollte hinein, ich auch. Vormittags hörten wir in der Schule das ferne Dröhnen der Trommeln und Pfeifen, das Schnauben von Trompete und Posaune, die wundersam klaren Noten von Triangel und Glockenspiel. Die Kapelle probte zwei, drei Mal die Woche. Beeindruckt sah ich ihnen nach, wie sie in Richtung einer Koppel verschwanden, die an die Schule grenzte. Imponierend war vor allem der Tambourmajor, der nur bei wichtigen Anlässen zum Einsatz kam, weil er ein Ehemaliger der Schule war. Er führte den Tambourstab mit bewundernswertem Geschick, obwohl er einäugig war – er besaß ein Glasauge, und die Legende besagte, er habe es bei einem bösen Schlenker mit dem Stab verloren.
Im Dezember pilgerten wir immer zur Votivkirche. Von der Schule aus war es ein endloser Fußmarsch, zwei Stunden lang, allen voran die Kapelle, dann wir in absteigender Ordnung, vom Zusatzjahr der Oberstufe (wir waren ein technisches Gymnasium) bis zur ersten Klasse. Die Leute winkten aus den Fenstern, Frauen schenkten uns Orangen, damit wir nicht schlappmachten. Meine Mutter tauchte in Abständen am Wegrand auf. Sie parkte, suchte mich am Ende des Zugs, kehrte zum Auto zurück, hörte Musik, rauchte eine Zigarette, fuhr wieder ein Stück, um uns weiter vorne abzupassen und mich von neuem zu grüßen mit ihrem langen, glänzenden hellbraunen Haar, die schönste Mutter der Klasse, kein Zweifel, was mich eher in Bedrängnis brachte, denn einige Mitschüler stichelten, sie sei eine viel zu hübsche Mutter für einen so hässlichen Kerl wie mich.
Auch Dante kam, um mir zu winken, grölte dabei meinen Namen und blamierte mich vor den Klassenkameraden, die sich über ihn lustig machten und über mich auch. Dante war ein autistischer Junge, viel älter als ich, fünfzehn oder sechzehn vielleicht. Er war sehr groß, ein Meter neunzig, und wog über hundert Kilo, was er eine Zeitlang überall an den Mann bringen musste, und zwar immer exakt: »Hallo, ich wiege 103 Kilo.«
Dante streifte den ganzen Tag im Ort umher und versuchte, jedem einzelnen der Kinder die richtigen Eltern, Geschwister und Freunde zuzuordnen, was in einer Welt, in der Schweigen und Misstrauen vorherrschten, bestimmt nicht einfach war. Er verfolgte seine Gesprächspartner, die dann schneller ausschritten, aber er beschleunigte auch, bis er sie überholt hatte, ging rückwärts weiter und wiegte streng den Kopf, wenn er etwas begriff. Er lebte allein bei einer Tante, die Eltern hatten ihn anscheinend im Stich gelassen, aber davon sprach er nie; wenn man ihn nach seinen Eltern fragte, machte er ein verblüfftes Gesicht.
3
Abgesehen von den Märschen in der Schule hörte ich auch nachmittags zu Hause kriegerische Klänge, denn wir wohnten hinter dem Santiago-Bueras-Stadion, wo die Kinder anderer Schulen probten und ständig, vielleicht monatlich, die Militärkapellen gegeneinander antraten. So hörte ich tagaus, tagein Märsche, gewissermaßen die Musik meiner Kindheit. Aber nur zum Teil, denn die Musik hatte in meiner Familie schon immer eine wichtige Rolle gespielt.
Meine Großmutter war in ihrer Jugend Opernsängerin gewesen und sah es als ihre größte Enttäuschung an, dass sie nicht hatte weitersingen können, da beim Erdbeben von 1939, sie war damals einundzwanzig gewesen, ein Riss durch ihr Leben gegangen war. Ich weiß nicht, wie oft sie uns erzählte, wie sie Erde geschluckt und, wieder bei Bewusstsein, ihre Stadt Chillán Viejo zerstört vorgefunden hatte. Die Liste der Toten schloss ihren Vater, ihre Mutter und zwei ihrer drei Geschwister mit ein. Das dritte hatte sie aus den Trümmern befreit.
Meine Eltern erzählten uns niemals Geschichten, sie jedoch schon. Ihre fröhlichen Geschichten gingen böse aus, denn die Figuren starben unweigerlich beim Erdbeben. Aber sie erzählte uns auch tieftraurige Geschichten, die gut ausgingen und für sie Literatur waren. Manchmal weinte meine Großmutter am Ende, und meine Schwester und ich schliefen über ihren Schluchzern ein oder schliefen eben nicht, und manchmal amüsierte sie selbst in den dramatischsten Momenten der Geschichte irgendein Detail, und sie brach in ein ansteckendes Lachen aus, und auch dann schliefen wir nicht.
Die Sätze meiner Großmutter hatten von jeher einen doppelten Boden oder eine schlagfertige Pointe, die sie selbst vorzeitig feierte. Sie sagte »Herr Hintern« statt »hinterher«, und wenn jemand fand, es sei kalt, entgegnete sie »vor allem ist es nicht warm«. Sie sagte auch »man muss die Kämpfe kämpfen, wie sie fallen«, und sie gab oft zurück »weder noch, wie der Fisch sagte« oder »wie der Fisch sagte« oder bloß »Fisch«, die Kurzversion des folgenden Satzes: »Weder noch, wie der Fisch sagte, als man ihn fragte, ob er lieber in den Ofen oder in die Pfanne wolle.«
4
Die Messe wurde in der Turnhalle einer Nonnenschule abgehalten, der Mater Purissima, aber immer war von der Pfarrkirche, die gerade errichtet wurde, die Rede wie von einem Traum. So lange ließen sie sich Zeit damit, dass ich bei ihrer Fertigstellung nicht mehr an Gott glaubte.
Zunächst ging ich mit meinen Eltern hin, später dann allein, weil sie zur Messe einer anderen Nonnenschule, der Ursulinerinnen, wechselten, die näher war und nur vierzig Minuten dauerte, denn der Pfarrer dort – ein winziger, kahl geschorener Mann mit einem Motorroller – spulte die Predigt mit sympathischer Geringschätzung ab, ja machte oft die Geste des Und-so-fort. Ich mochte ihn, zog aber den Pfarrer der Mater Purissima vor, einen Mann mit verwickeltem, unbezähmbarem Bart von makellosem Weiß, der sprach, als wollte er uns herausfordern, aufstacheln, mit dieser energischen und trügerischen Liebenswürdigkeit der Pfarrer und mit zahlreichen dramatischen Pausen. Ich kannte natürlich auch die Pfarrer meiner Schule wie Pater Limonta, den Direktor, einen äußerst athletischen Italiener – er war in seiner Jugend angeblich Turner gewesen –, der mit seinem Schlüsselbund Kopfnüsse verteilte, damit wir stramm in einer Reihe standen, ansonsten aber umgänglich, fast väterlich war. Seine Predigten fand ich jedoch ärgerlich und unangemessen, vielleicht war er zu pädagogisch, zu wenig ernst.
Mir gefiel die Sprache der Messe, aber ich verstand sie nicht richtig. Wenn der Pfarrer sagte »gehe hin und sieh, ob’s wohl stehe«, hörte ich »Gehen Unsinn obwohl Stehen« und zerbrach mir den Kopf über diesen paradoxen Stillstand. Den Satz »ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehest« sagte ich einmal zu meiner Großmutter, als ich ihr die Tür öffnete, und später zu meinem Vater, der mir sogleich mit einem sanften, strengen Lächeln entgegnete: »Danke, aber dieses Dach ist meines.«
In der Mater Purissima gab es einen Kirchenchor für sechs Stimmen und zwei Gitarren, der eine führende Rolle spielte, weil sogar die »danket dem Herrn« und die »großer Gott, wir loben dich«, selbst die »Herr, wir bitten dich, erhöre uns« gesungen wurden. Mein Ehrgeiz war es, in diesen Chor aufgenommen zu werden. Ich war noch nicht einmal acht, spielte aber schon relativ gut eine kleine Gitarre bei uns im Haus, schlug die Saiten mit Rhythmusgefühl, beherrschte Arpeggios, und obwohl mich beim Barré-Griff ein nervöses Zittern überkam, erreichte ich doch einen fast runden Ton, nur eine Spur unsauber. Sagen wir, ich hielt mich für gut oder für gut genug, eines Morgens nach der Messe, die Gitarre in der Hand, den Chor anzusprechen. Sie musterten mich abschätzig, wahrscheinlich war ich ihnen zu klein, oder sie waren eine...
| Erscheint lt. Verlag | 10.5.2017 |
|---|---|
| Übersetzer | Susanne Lange |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Mis Documentos |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | 20. Jahrhundert • Bonsai • Chile • Coming-of-age • Die Erfindung der Kindheit • Identität • Lateinamerika • Mejores Obras Literarias 2012 • Militärdiktatur • Mis Documentos deutsch • Pinochet • Prosa • Südamerika • Süd- und Zentralamerika (inklusive Mexiko) Lateinamerika • ÜERSETZERPREISE DER BOTSCHAFT VON SPANIEN 2005 |
| ISBN-10 | 3-518-75100-X / 351875100X |
| ISBN-13 | 978-3-518-75100-8 / 9783518751008 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich