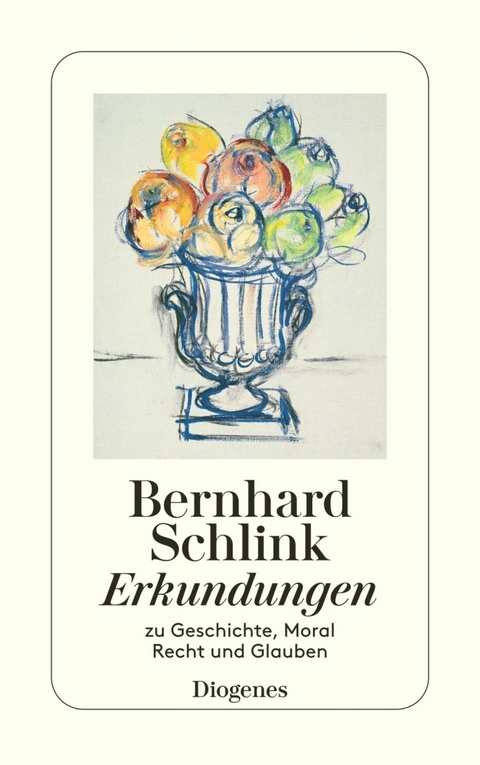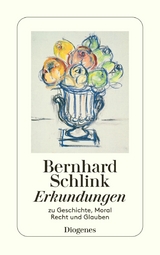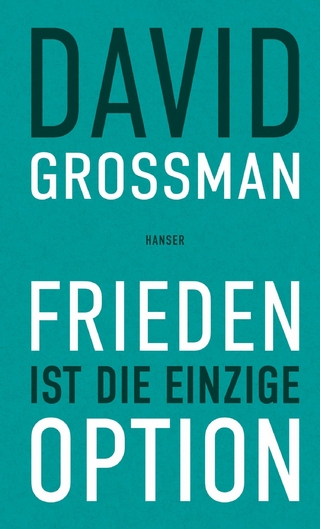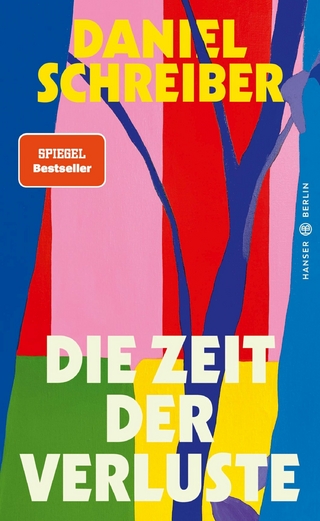Erkundungen (eBook)
288 Seiten
Diogenes (Verlag)
978-3-257-60699-7 (ISBN)
Bernhard Schlink, 1944, Jurist, lebt in Berlin und New York. Sein erster Roman ?Selbs Justiz? erschien 1987; sein 1995 veröffentlichter Roman ?Der Vorleser?, in über 50 Sprachen übersetzt, mit nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet und 2009 von Stephen Daldry mit Kate Winslet unter dem Titel ?The Reader? verfilmt, machte ihn weltweit bekannt. Zuletzt erschien von ihm der Roman ?Das späte Leben? (2023).
Bernhard Schlink, 1944, Jurist, lebt in Berlin und New York. Sein erster Roman ›Selbs Justiz‹ erschien 1987; sein 1995 veröffentlichter Roman ›Der Vorleser‹, in über 50 Sprachen übersetzt, mit nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet und 2009 von Stephen Daldry mit Kate Winslet unter dem Titel ›The Reader‹ verfilmt, machte ihn weltweit bekannt. Zuletzt erschien von ihm der Roman ›Die Enkelin‹ (2021).
[11] Erinnern und Vergessen
Wie viel Freiheit haben wir im Umgang mit der Vergangenheit?
1
Als ich ein Kind war, führte mich mein Weg durch die Stadt oft an der Ecke des Rathauses vorbei, an der in einem Erker eine Gestalt aus braunem Ton stand. Sie erinnerte an die deutschen Soldaten, die noch in Russland gefangen oder vermisst waren. Sie trug keine Uniform, sondern ein weites Gewand, sie trug auch keine Fesseln, kein Werkzeug, keinen Essnapf, sondern zeigte nur die leeren Hände. Sie hätte statt eines Gefangenen oder Vermissten auch einen Einsiedler oder einen Wanderer aus einer fernen Welt und fernen Zeit darstellen können. Aber für mich war klar, was sie darstellte. Die Kriegsgefangenen, die Vermissten, die Gefallenen, die Vertriebenen und das Land östlich der Oder und Neiße, aus dem sie vertrieben und geflohen waren – das war, woran sich in den fünfziger Jahren unsere Eltern erinnerten und wir Kinder uns mit ihnen. Wir sammelten für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, wir nahmen mit Aufsätzen über Breslau oder Königsberg an Wettbewerben teil, und manchmal erzählten unsere Lehrer über ihre Gefangenschaft in Russland oder Afrika. Nach 1953 wurde der Aufstand des 17. Juni Teil der [12] Erinnerungskultur; wir Kinder gedachten seiner bei Aufzügen und Versammlungen, stellten Kerzen ins Fenster, zogen mit Fackeln in den Schlosshof und hörten Reden über den Totalitarismus Stalins, der nach dem Totalitarismus Hitlers als nächstes Verhängnis den Osten Deutschlands und Europas heimgesucht hatte.
1963, mit den Frankfurter Auschwitz-Prozessen, wurden wir des Holocaust als zu erinnernder Vergangenheit gewahr. Nicht dass er davor verleugnet oder verschwiegen worden wäre. Aber erst mit den Prozessen wurde seine ganze Furchtbarkeit anschaulich. Er wurde zum wichtigen Moment in der Auseinandersetzung der 68er Generation mit der Elterngeneration, und mit der gleichnamigen Fernsehserie, die 1979 von einem größeren Publikum gesehen und in Familien, Schulen und Medien diskutiert wurde als jede Serie davor oder danach, rückte er in das Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. In den achtziger Jahren wurde der Holocaust die Vergangenheit, die vor allen anderen Vergangenheiten erinnert wurde.
Die anderen Vergangenheiten wurden vom Holocaust nicht einfach verdrängt. Die Erinnerung an den verlorenen Krieg, das verlorene Land, die Vertreibung der Deutschen und den Aufstand des 17. Juni passte auch nicht mehr in das neue politische Klima von Willy Brandts Ostpolitik, die Verlust und Vertreibung und die staatliche Existenz der DDR akzeptierte und statt auf Konfrontation auf Wandel durch Annäherung setzte. Zugleich wurde die Erinnerung an Deutsche als Opfer und Helden, Opfer des Kriegs und der Vertreibung und Helden des Aufstands mehr und mehr Deutschen, die sich von ihrer deutschen [13] Vergangenheit distanzieren und eine neue, europäische oder atlantische Identität finden wollten, peinlich.
Bis heute, durch die Wiedervereinigung und durch den Wandel der Bonner zur Berliner Republik hindurch, blieb der Holocaust die Vergangenheit, die vor allen anderen Vergangenheiten erinnert wird: als Kultur- oder Zivilisationsbruch, als Inbegriff des Furchtbaren, das Menschen einander antun können und nie wieder antun dürfen. Er blieb Grund deutscher Schuld und Verantwortung und das Ereignis, in dessen Anerkennung und Aufarbeitung Deutschland eine neue, sich selbst und die Welt überzeugende Identität finden musste. Der Umstand, dass das wiedervereinigte, größere und stärkere Deutschland die Angst seiner Nachbarn vor einem neuen deutschen Nationalismus spürte, trug dazu bei, den Holocaust, diese Vergangenheit der Schuld oder auch der Schande, zu erinnern.
Aber jetzt jährt sich der Ausbruch des Ersten Weltkriegs zum hundertsten Mal, und die öffentliche Aufmerksamkeit wendet sich vom Holocaust, Dritten Reich und Zweiten Weltkrieg ab und dem Ersten Weltkrieg zu als dem Beginn der großen europäischen Tragödie, dem Beginn nicht nur des Ersten, sondern auch des Zweiten Weltkriegs oder, richtiger, eines großen Kriegs, der von 1914 bis 1945 dauerte und der Entwicklung des Westens zum Verhängnis wurde. Es gibt ein neues Interesse an den Fragen, wer für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs verantwortlich war und dafür, dass er nicht früher und besser endete, wie er nicht nur die Landkarte Europas veränderte, sondern auch das Ende des Kolonialismus in Afrika und Asien einleitete und wie die Soldaten den Krieg in den Gräben und bei den Angriffen [14] erlebten, die mehr Opfer forderten, als Schlachten sie jemals gefordert hatten, wie sie davon geprägt und traumatisiert und ruiniert wurden. Es ist ein neues Interesse nicht nur bei Historikern, sondern bei Schriftstellern, Produzenten und Regisseuren und beim Publikum.
Gewiss, der Erste Weltkrieg und seine Ursachen und Folgen interessieren nicht jeden. Aber Geschichte interessiert ohnehin nicht jeden, und sie interessiert weniger und weniger junge Menschen. Das gilt auch für die Geschichte des Holocaust. Meine Generation hatte Eltern, Lehrer, Pfarrer und Professoren, die an den Furchtbarkeiten des Dritten Reichs beteiligt oder in sie verstrickt waren, und stand über sie in lebendiger Verbindung zur Vergangenheit, und auch die nächste Generation erlebte die Verbindung noch, wenn auch schon schwächer, über ihre Großeltern. Für die nachfolgenden Generationen ist der Holocaust lange vergangen, wie alle Geschichte lange vergangen ist. Gelegentlich eine anrührende historische Begebenheit – das ist okay und ist auch genug.
Dürfen die nächsten Generationen den Holocaust vergessen? Dürfen, um die deutsche zur allgemeinen Frage zu weiten, die Japaner die ermordeten Chinesen und missbrauchten Koreanerinnen vergessen, die Türken die vernichteten Armenier, die Russen die Opfer des Stalinismus und die Amerikaner die versklavten Afrikaner und die ihres Lands und Lebens beraubten Indianer? Steht uns moralisch frei, was und wann wir erinnern und was und wann wir vergessen? Gibt es Vergangenheiten, die erinnert werden müssen? Gibt es Vergangenheiten, die vergessen werden dürfen?
[15] 2
»Die Vergangenheit ist der Schlüssel zur Zukunft« oder, spiritueller, »Erinnerung ist das Geheimnis der Erlösung« oder, einschüchternder, »was wir nicht erinnern, müssen wir wiederholen« – diese sprichwörtlichen Weisheiten mahnen uns zum Erinnern, weil anders eine doppelte Gefahr drohe: dass wir unsere Wurzeln verlieren und dass wir in Zukunft die gleichen Fehler machen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Ist das nicht auch die Weisheit der Psychoanalytiker und -therapeuten, die mit ihren Patienten tief in deren bewusste und unbewusste Vergangenheit eindringen?
Aber es gibt auch andere Therapeuten, die lehren, dass Selbstfindung und -vergewisserung in Aufarbeitung der Vergangenheit und dessen, was uns angetan wurde und wir anderen angetan haben, im Erinnern und erst recht in Schuld und Reue nicht gelingen könnten, sondern nur, wenn wir entschlossen im Hier und Jetzt lebten. Diese Betonung der Bedeutung des Hier und Jetzt ist buddhistisch beeinflusst, reklamiert aber eine reichere Tradition und zitiert auch die Bibel und Christus: »Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, ist nicht geschickt zum Reich Gottes.«
Diese einander widersprechenden Lehren richten sich wie an Einzelne auch an Völker. Völker haben zu ihren Vergangenheiten denn auch manchmal eher das eine, manchmal eher das andere Verhältnis. Dass Erinnerung das Geheimnis der Erlösung ist, eine Einsicht von Baal Shem Tov, leuchtet als Maxime für das Volk der Juden unmittelbar ein; [16] ohne einen ständig erneuten und bewährten Willen zum Erinnern, ohne eine Kultur und Tradition des Erinnerns hätte es in Gefangenschaft und Diaspora seine Identität verloren. Ähnlich haben die Polen ihren Zusammenhalt trotz beinahe zweihundertjähriger Teilung wahren können, weil sie ihre gemeinsame Vergangenheit erinnert haben. Junge Nationen, die verschiedene Stämme, Kulturen und Traditionen zusammenhalten müssen, zeigen oft ein großes Bedürfnis nach einer inspirierenden und verbindenden Vergangenheit. Andererseits wurde Amerika für seine Fähigkeit gerühmt, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, und die Amerikaner für ihre Gleichgültigkeit gegenüber ihrer eigenen Geschichte und der Geschichte anderer, gegenüber historischen Prägungen und Traumata; so habe Amerika es geschafft, wieder und wieder zu neuen Horizonten aufzubrechen, und hätten die Amerikaner ihre Offenheit gegenüber der Zukunft, gegenüber Neuem und Fremdem, und ihre Freiheit von Ressentiments und Vorurteilen gewonnen.
Aber dürfen die Amerikaner darum die versklavten Afrikaner und die ihres Lands und Lebens beraubten Indianer vergessen? Sind die Polen frei in dem, was sie in die kollektive Biographie hineinnehmen und was sie von ihr ausschließen? Sind junge Nationen frei, eine große Vergangenheit zu erfinden, wenn sie keine haben?
Beides, Erinnern und Vergessen, dient offensichtlich wichtigen Bedürfnissen. Erinnern bewahrt und pflegt Identität, Vergessen befreit zu den Aufgaben der Gegenwart und Zukunft. Es lassen sich auch zeitliche Abschnitte ausmachen, in denen entweder Erinnern oder Vergessen [17] ansteht, weil die entsprechenden Bedürfnisse sich geltend machen. Die Unwilligkeit der Westdeutschen, sich nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Nazi-Vergangenheit zu beschäftigen, hatte ihren Grund weniger im Wunsch, diese...
| Erscheint lt. Verlag | 23.9.2015 |
|---|---|
| Verlagsort | Zürich |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Essays / Feuilleton |
| Schlagworte | Christen • Erinnerungskultur • Gedenken • Geschichte • Glaube • Konflikte • Kultur • Moral • Prosa • Recht • Rechtsprechung • Religion • Sachbuch • Schriftsteller • Solidarität • Verantwortung |
| ISBN-10 | 3-257-60699-0 / 3257606990 |
| ISBN-13 | 978-3-257-60699-7 / 9783257606997 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich