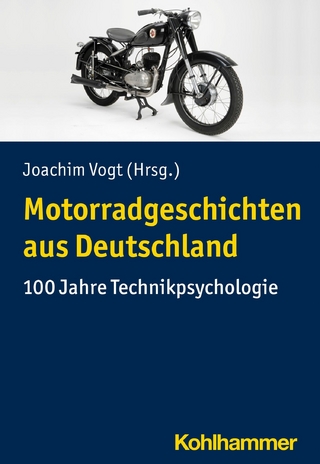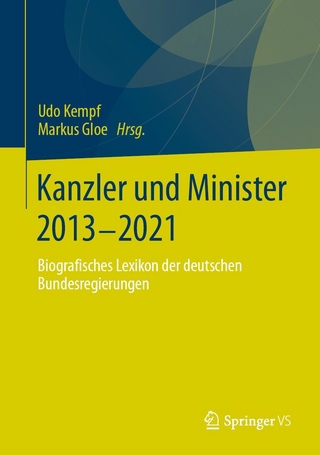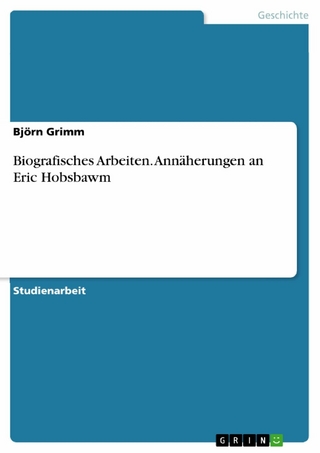Nationalstaat und Föderalismus (eBook)
326 Seiten
Campus Verlag
978-3-593-45486-3 (ISBN)
Andreas Wirsching ist Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin und Inhaber des Lehrstuhls für Neueste Geschichte an der LMU München. Lars Lehmann ist Historiker und Wissenschaftlicher Koordinator des Schelling-Forums der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Universität Würzburg.
Andreas Wirsching ist Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München–Berlin und Inhaber des Lehrstuhls für Neueste Geschichte an der LMU München. Lars Lehmann ist Historiker und Wissenschaftlicher Koordinator des Schelling-Forums der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Universität Würzburg.
Einleitung
Andreas Wirsching
Wir leben in einer Zeit, in der Nationalismus und Demokratiefeindschaft, Machtmissbrauch und Alleinherrschaft mit geradezu brutaler Wucht in die Geschichte zurückgekehrt sind. Unverhofft gewinnen alte Probleme, die zumindest die westliche Welt für erledigt halten konnte, neue und fast bedrückende Aktualität. Hierzu gehört die Frage nach institutionellen Vorkehrungen, Gegengewichten und verfassungsrechtlichen Sicherungen gegen die möglichen Exzesse exekutiver Macht. Angesichts eines neuen Nationalismus, der umso gefährlicher werden kann, wenn ihm die Machtmittel einer zentralisierten Staatsgewalt zu Gebote stehen, sehen sich die demokratischen Verfassungsordnungen mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Ihre Stabilität und Funktionalität sind nicht mehr selbstverständlich, sondern müssen neu justiert werden.
Neben Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit gehört der Föderalismus zu den historisch gewachsenen und wirksamen Instrumenten zur Einhegung exekutiver Macht. Nicht zufällig hatte die »Gleichschaltung« der Länder eine der höchsten Prioritäten auf der nationalsozialistischen Agenda des Jahres 1933. Und man mag sich kaum vorstellen, welche Auswirkungen Donald Trumps Präsidentschaft in den USA hätte haben können ohne die Macht der Bundesstaaten. Umgekehrt gehört die systematische Zurückdrängung des russischen Föderativsystems zur unmittelbaren Vorgeschichte von Putins Diktatur. Historisch werfen diese Bemerkungen die in der Forschung schon seit Längerem diskutierte Frage danach auf, inwieweit das 19. Jahrhundert föderative Entwicklungspotenziale in sich trug, die alternative Wege in die Moderne aufzeigten: Wege abseits eines einseitigen nationalstaatlichen Telos, das den Nationalismus prämierte und entsprechende Kosten verursachte. Föderativ-übernationale Gebilde, die vor 1914 als »Völkergefängnisse« bezeichnet wurden, wie insbesondere das Habsburgerreich, das Osmanische Reich oder das zaristische Russland, erscheinen angesichts des Horrors von Ausgrenzung und Gewalt, den das 20. Jahrhundert bereithielt, in einem anderen Licht, als es eine einfache Fortschrittsgeschichte von Nation, Demokratie und Moderne glauben machen möchte.
Für die deutsche Geschichte ist dieser Forschungskomplex paradigmatisch. Der Föderalismus ist eine ihrer Grundtatsachen – und er blieb es auch nach dem Zusammenbruch des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation.1 Über das ganze 19. und 20. Jahrhundert hinweg koexistierten die »modernen« Ideen der nationalen Einigung und des Nationalstaates mit dem Fortbestand der traditionellen föderalen Struktur deutscher Territorialität und Staatlichkeit. Über die Frage, wie eine Balance zwischen beiden Prinzipien verfassungsrechtlich, politisch und kulturell einzurichten sei, entstand ein Dauerthema der deutschen Politik, das uns bis heute begleitet. Das nationalstaatliche Prinzip ließ auf Einheit und Zusammengehörigkeit, Wirtschaftswachstum und Machtentfaltung hoffen. Das Prinzip einer föderativen Nation versprach, Einheit und Pluralität zu verbinden und damit die Koexistenz ethnischer, politisch-regionaler und kultureller Vielfalt unter einem nicht zu schwachen verfassungspolitischen Dach. Insbesondere Dieter Langewiesche und jüngst Jana Osterkamp am Beispiel der Habsburgermonarchie haben eindringlich gezeigt, dass die deutsche Geschichte in sehr viel stärkerem Maße von zukunftsfähigen föderativen Ideen durchzogen war, als es die lange Zeit dominante borussische Geschichtsschreibung wissen wollte.2 In der Paulskirche etwa war die amerikanische Verfassung das große Vorbild für die Verbindung von Föderation und nationaler Einheit. Erst das politische Scheitern der Revolution, der Aufstieg des »realpolitischen« Denkens im Stile August Ludwig von Rochaus und dann vor allem die Einigungskriege von 1864 bis 1871 erzeugten eine Umdeutung der deutschen Geschichte in Richtung kleindeutscher Einigung. Der Kritik an der »Märchenwelt des deutschen Particularismus«3 entsprach die Heroisierung Preußens, dessen frühneuzeitlicher Geschichte ein deutscher Sinn eingeschrieben wurde. Es gehört zu den langfristig höchst wirksamen Folgen dieser Wende, dass sich der Hauptstrom deutschen Geschichtsdenkens darauf fixierte, die nationale Geschichte bis zu Bismarcks Reichsgründung als historischen Irrweg zu zeichnen: als Geschichte einer großen Kulturnation, die aber aufgrund dynastischer Eigensucht, innerer Uneinigkeit und politisch-militärischer Ohnmacht regelmäßig zum Opfer gieriger Nachbarn – und hier natürlich vor allem Frankreichs – wurde. Föderalistisch orientierte Skeptiker und Gegner dieser Deutung wie Constantin Frantz4 fielen dem Vergessen anheim oder mussten, wie Heinrich von Treitschke mit Blick auf Georg Gottfried Gervinus schrieb, »durch eine tragische Demütigung gezüchtigt« werden.5 Zur Aufgabe der Geschichtswissenschaft gehört es demgegenüber, Aspekte und Ansätze alternativer, stärker föderativ orientierter Staatsbildungsideen aufzusuchen und zu diskutieren. Letztendlich geht es um den Ort der Reichsgründung von 1871 in dem komplexen Kontext von Einzelstaaten und Nationalbewegung, längerfristigen Bundesvorstellungen und preußischem Machtstaat. Zu diesem Zweck muss das Knäuel der borussischen Geschichtsschreibung entwirrt und dekonstruiert werden. In diesem Sinne zeigt zunächst Wolfgang Neugebauer, wie insbesondere Treitschke sich gegen den dynastischen Partikularismus wandte und Preußen zu einem Einheitsstaat erklärte, dem sich die deutschen Kleinstaaten anschließen sollten. Die kleindeutsche, auf Preußen fixierte »Homogenitätsfiktion« wird damit einer kritischen Prüfung unterzogen. Neugebauer führt vor Augen, wie Heinrich von Treitschke und Johann Gustav Droysen diese Fiktion entwarfen, um sie in den Dienst einer (scheinbar) zielstrebigen Reichgründungspolitik und der damit einhergehenden Machterweiterung des preußischen Staates zu stellen.
Das führt zum Thema der Staatlichkeit des im Jahr 1871 gegründeten Deutschen Reichs, in dem von Beginn an föderale und einheitsstaatliche Machtzentren und Tendenzen spannungsvoll koexistierten und miteinander konkurrierten. Vor allem der Reichstag mit seinem demokratischen Männerwahlrecht bildete im Kaiserreich zunehmend eine unitarische Klammer. Er war dies auch durch die in ihm vertretenen Parteien, die sich über die Einzelstaaten hinweg organisierten. Liberalismus und Sozialdemokratie vertraten ohnehin explizit unitarische Konzepte. Aber auch Konservatismus und politischer Katholizismus fanden ihren politischen Fluchtpunkt in Berlin, selbst wenn der föderale Gedanke Teil ihrer politischen Identität war.
Mit seinen Abgeordneten und Parteien baute der Reichstag seine Kompetenzen aus und erreichte eine immer weiter ausgreifende öffentliche Sichtbarkeit.6 Der Bundesrat hingegen blieb die föderale Klammer des Reichs. Er wahrte den Schein einer bündischen Ordnung, schützte das monarchische Prinzip und sicherte die Vormachtstellung Preußens.7 Jedoch verlor er im Gegensatz zum Reichstag an Bedeutung. Oliver F. R. Haardt zeigt auf, wie sich das Verfassungssystem zwischen 1871 und 1918/19 wandelte: Aus einem Fürstenbund wurde ein integrierter Bundesstaat, der als Reichsmonarchie unitarische Züge annahm. Die Entwicklung der »Verfassungsrealität drängte den Bundesrat in ein politisches Schattendasein«; er wurde zum »Satellitenorgan« und zum Spielball der Reichsleitung. Lässt sich mithin für das Kaiserreich von einer Art funktionalem Unitarismus im parlamentarisch-parteipolitischen Bereich sprechen, so gilt das ganz sicher auch für die Staatsfinanzen. Zwar blieb das Kaiserreich weitestgehend der Kostgänger der Länder. Die Reichsfinanzen lebten von deren Matrikularbeiträgen, also den regelmäßigen jährlichen Überweisungen der Länder an das Reich entsprechend ihrer Bevölkerungszahl. Zugleich aber ist es ein gutes Beispiel für die Stichhaltigkeit des von dem preußischen Finanzwissenschaftler und -politiker Johannes Popitz aufgestellten Gesetzes von der »Anziehungskraft« des höheren Etats.8 Da nur der Zentralstaat die Gleichheit der Lebensbedingungen gewährleisten bzw. darauf hinarbeiten kann, wächst die Relevanz seiner Aufgaben. Übernimmt aber die zentrale Ebene mehr Staatsaufgaben, so wachsen auch ihr Anteil an der Staatsquote und deren Relevanz. Das Kaiserreich mit...
| Erscheint lt. Verlag | 15.5.2024 |
|---|---|
| Co-Autor | Jonas Becker, Manfred Görtemaker, Bernhard Gotto, Oliver F.R. Haardt, Andreas Hedwig, Arian Leendertz, Lars Lehmann, Detlef Lehnert, Michael Kißener, Andreas Malycha, Wolfgang Neugebauer, Stefan Oeter, Jana Osterkamp, Guido Thiemeyer, Christian Walter, Siegfried Weichlein, Hermann Wentker, Andreas Wirsching |
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Geschichte ► Allgemeines / Lexika |
| Schlagworte | Bayern • Bizone • Bundesländer • Bundesrat • Bundesrepublik Deutschland • Bundesstaat • Bundestag • DDR • Demokratie • Deutsche Demokratische Republik • Deutsche Geschichte • deutsche Territorien • Deutschland • Europäische Integration • Finanzverfassung • Föderalismus • Föderalismusreform • Frühe Neuzeit • Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern • Grundgesetz • Hugo Preuß • Kaiserreich • Ministerpräsidenten • Mittelalter • Nationalsozialismus • Nationalsstaat • Neue Bundesländer • NS • Österreich • Parteien • Preußen • Regionalismus • Staatenbund • Verfassung • verfassungspolitisches Strukturprinzip • Weimarer Reichsverfasssung • Weimarer Republik • Zentralismus • Zentralstaat |
| ISBN-10 | 3-593-45486-6 / 3593454866 |
| ISBN-13 | 978-3-593-45486-3 / 9783593454863 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 4,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich