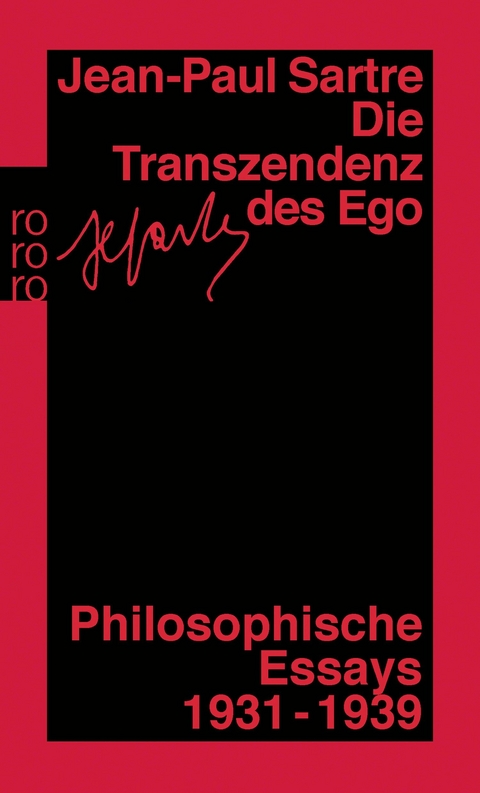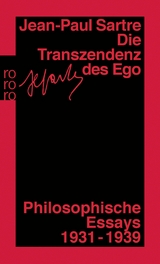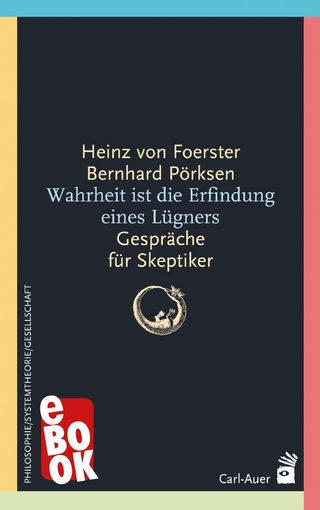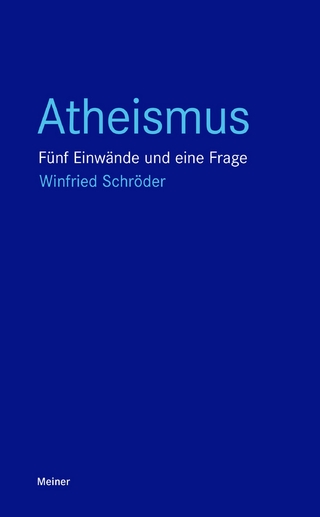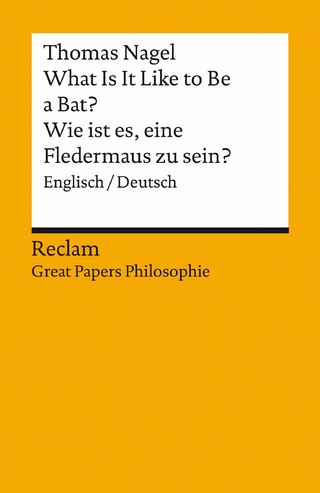Die Transzendenz des Ego (eBook)
360 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-01889-1 (ISBN)
Geboren am 21.06.1905, wuchs er nach dem frühen Tod seines Vaters im Jahre 1906 bis zur Wiederheirat seiner Mutter im Jahre 1917 bei seinen Großeltern Schweitzer in Paris auf. 1929, vor seiner Agrégation in Philosophie, lernte er seine Lebensgefährtin Simone de Beauvoir kennen, mit der er eine unkonventionelle Bindung einging, die für viele zu einem emanzipatorischen Vorbild wurde. 1931-1937 war er Gymnasiallehrer in Philosophie in Le Havre und Laon und 1937-1944 in Paris. 1933 Stipendiat des Institut Français in Berlin, wo er sich mit der Philosophie Husserls auseinandersetzte.Am 02.09.1939 wurde er eingezogen und geriet 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft, aus der er 1941 mit gefälschten Entlassungspapieren entkam. Noch 1943 wurde unter deutscher Besatzung sein erstes Theaterstück «Die Fliegen» aufgeführt; im selben Jahr erschien sein philosophisches Hauptwerk «Das Sein und das Nichts». Unmittelbar nach dem Krieg wurde Sartres Philosophie unter dem journalistischen Schlagwort «Existenzialismus»zu einem modischen Bezugspunkt der Revolte gegen bürgerliche Lebensformen. 1964 lehnte er die Annahme des Nobelpreises ab. Zahlreiche Reisen führten ihn in die USA, die UdSSR, nach China, Haiti, Kuba, Brasilien, Nordafrika, Schwarzafrika, Israel, Japan und in fast alle Länder Europas. Er traf sich mit Roosevelt, Chruschtschow, Mao Tse-tung, Castro, Che Guevara, Tito, Kubitschek, Nasser, Eschkol. Sartre starb am 15.4.1980 in Paris.Auszeichnungen: Prix du Roman populiste für «Le mur» (1940); Nobelpreis für Literatur (1964, abgelehnt); Ehrendoktor der Universität Jerusalem (1976).
Uli Aumüller übersetzt u. a. Siri Hustvedt, Jeffrey Eugenides, Jean Paul Sartre, Albert Camus und Milan Kundera. Für ihre Übersetzungen erhielt sie den Paul-Celan-Preis und den Jane-Scatcherd-Preis. Geboren am 21.06.1905, wuchs er nach dem frühen Tod seines Vaters im Jahre 1906 bis zur Wiederheirat seiner Mutter im Jahre 1917 bei seinen Großeltern Schweitzer in Paris auf. 1929, vor seiner Agrégation in Philosophie, lernte er seine Lebensgefährtin Simone de Beauvoir kennen, mit der er eine unkonventionelle Bindung einging, die für viele zu einem emanzipatorischen Vorbild wurde. 1931-1937 war er Gymnasiallehrer in Philosophie in Le Havre und Laon und 1937-1944 in Paris. 1933 Stipendiat des Institut Français in Berlin, wo er sich mit der Philosophie Husserls auseinandersetzte. Am 02.09.1939 wurde er eingezogen und geriet 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft, aus der er 1941 mit gefälschten Entlassungspapieren entkam. Noch 1943 wurde unter deutscher Besatzung sein erstes Theaterstück «Die Fliegen» aufgeführt; im selben Jahr erschien sein philosophisches Hauptwerk «Das Sein und das Nichts». Unmittelbar nach dem Krieg wurde Sartres Philosophie unter dem journalistischen Schlagwort «Existenzialismus»zu einem modischen Bezugspunkt der Revolte gegen bürgerliche Lebensformen. 1964 lehnte er die Annahme des Nobelpreises ab. Zahlreiche Reisen führten ihn in die USA, die UdSSR, nach China, Haiti, Kuba, Brasilien, Nordafrika, Schwarzafrika, Israel, Japan und in fast alle Länder Europas. Er traf sich mit Roosevelt, Chruschtschow, Mao Tse-tung, Castro, Che Guevara, Tito, Kubitschek, Nasser, Eschkol. Sartre starb am 15.4.1980 in Paris. Auszeichnungen: Prix du Roman populiste für «Le mur» (1940); Nobelpreis für Literatur (1964, abgelehnt); Ehrendoktor der Universität Jerusalem (1976).
Legende der Wahrheit[1]
Die Wahrheit wurde nicht zuerst geboren. Die kriegerischen Nomaden brauchten sie nicht, sondern eher einen schönen Glauben. Wer kann sagen, was an einer Schlacht wahr ist.
Für die langwierigen Verrichtungen des Ackermanns bedurfte es, später, nur einer Wahrscheinlichkeit der Gesamtheiten, eines sicheren Vertrauens in die Beständigkeit jener großen Massen ohne Grenzen, der Jahreszeiten. Ich kann mir vorstellen, daß er die fahrenden Götter gut aufnahm und daß er ihre Wunder ohne Bewegung noch Argwohn anhörte, wahr und falsch im ungewissen lassend, während draußen das Grün der Ähren unmerklich mehr Ähnlichkeit mit dem Gelb annahm. Die Vertrautheit mit dem fortgesetzten Wachstum des Getreides gab seinem Geist eine geschmeidige Kraft. Von den Gegenständen, die in seinen Gesichtskreis fielen, verlangte er nicht, daß sie sich in die Grenzen einer Natur ohne Launen einschlössen, und nahm ihre plötzlichen Veränderungen schlicht und einfach hin, sich auf ihre dunkleren Kräfte verlassend, daß sie ihnen eine Einheit geben würden, die für unsere Vernunft noch zu verschiedenartig war. Das Geschrei der Menge verfolgte ihn nicht bis in seine Gedanken, er war sich, unter ihnen, eines absoluten Alleinseins sicher. Es waren knorrige, tief verwurzelte, gegen die Rede aufsässige Kräfte, die nur ihm allein zu entsprechen schienen. Sein Blick ging von der einen zur andren, so wie ein Reisender, an den heimischen Herd zurückgekehrt, rundherum die Gesichter seiner Nächsten betrachtet, die einen ganz lächelnd, die andren in Tränen gebadet. Diese Gesichter reckten sich im Halbdunkel nach ihm wie die Pflanzen nach der Sonne, und manchmal bekam er Angst, wenn er so viele lebendige Dinge in sich spürte.
Die Wahrheit rührt vom Handel her: sie begleitete die ersten Manufakturgegenstände zum Markt: sie hatte auf seine Geburt gewartet, um, voll gerüstet, aus der Stirn der Menschen herauszukommen.
Erdacht, um ländlichen Bedürfnissen zu entsprechen, bewahrten sie deren ganze primitive Schlichtheit: die Töpfe, ganz rund mit einem groben Henkel, waren nichts andres als die Andeutung der Geste des Trinkens. Die Schaber, Eggen, Schleifsteine erschienen einfach als die Kehrseite der gebräuchlichsten geplanten Handlungen. Man mußte von ihnen einen einzigen Gedanken ableiten, einen ruhenden, reglosen, stummen Gedanken, ohne Alter, der eher vom Gegenstand als von den Geistern abhängig war, den ersten unpersönlichen Gedanken dieser zurückliegenden Zeiten, und der, selbst in Abwesenheit der Menschen, weiter über den Werken ihrer Finger schwebte.
Der Skeptizismus kam ja von den Feldern mit den Argumenten des Kahlen, des Gehörnten und des Scheffels, weil keine endgültige Sicht dem Wachsen der Ernten entsprechen konnte. Aber über die ersten Instrumente, die von Geburt an tot waren, mußten unwandelbare Worte ausgesprochen werden. Was man von ihnen sagen konnte, galt bis zu ihrer Zerstörung, und selbst dann kam keine unmerkliche Veränderung, das Urteil zu trüben: wenn die Vasen herunterfielen, zerbrachen sie in Stücke. Ihr eponymes Denken sprang, plötzlich befreit, in die Lüfte, kam dann zurück, sich auf andere Vasen zu setzen.
Die Handwerker schließlich hatten beim Herstellen des Feuersteins oder des Tons das entstehende Streben nach Form durchaus erfahren. Aber ihre abrupte, unterwegs ausgeblasene Anstrengung war weit diesseits der Schönheit stehengeblieben, in jenem verworrenen Bereich, wo Ecken, Kanten, Flächen undeutliche Elemente der Kunst und des Wahren sind.
Als solche mußten die ersten Menschenwerke sich absolut von den Naturproduktionen abheben, und die Benommenheit, in die sie nach ihrer Fertigstellung ihre Handwerker stürzten, läßt sich nur mit der einiger Gelehrter angesichts der mathematischen Wesenheiten vergleichen. Durch sie waren sie zwei Fingerbreit davon entfernt, den berühmten Mythos der wahren Gedanken zu finden.
Das Ökonomische besorgte den Rest. Auf dem Markt machten die naiven Gäste der Götter die Erfahrung des Betrugs. Man log, bevor man wahr sprach, weil es lediglich darum ging, einige neue und eigenartige Naturen zu verschleiern, deren Wirklichkeitsgrad man nicht genau kannte. Eine spontane Erwiderung brachte sofort die ersten Wahrheiten an den Tag. Sie trugen noch nicht diesen Namen «Wahrheit», dem soviel Ruhm verheißen war: es waren bloß besondere Vorkehrungen gegen die Betrüger. Jeder, der die Vase des Händlers hin und her drehte, achtete darauf, in seiner Maxime die besondere Idee dieser Vase zu behalten und alle seine Entdeckungen darauf zu beziehen. Man kam überein, daß eine Vase nicht gleichzeitig unversehrt und gesprungen sein durfte. Wer hätte denn gewagt, den spontanen Früchten der Erde derartige Grenzen zu setzen? Aber hier tat man nichts andres, als aus dem Ton die Absicht des Töpfers selbst auszugraben. Man traf hundert andre Vorkehrungen dieser Art, die niemals von einem allgemeinen Prinzip abgeleitet wurden: die Gelegenheit, bestimmte Überlegungen, die Natur der Waren selbst brachten merkwürdigerweise jene Regeln der Marktordnung hervor. Diese jungen Wahrheiten waren also zunächst nur ebenso viele regulative Prinzipien des Tausches, die die Beziehungen der Menschen untereinander betrafen und auf die Produkte der Industrie angewandt wurden. Sie wurden aus einer Überlegung des Menschen über sein Werk, nicht über die natürlichen Existenzen geboren.
Mühelos entstand ein Wortmarkt, dessen Sitz sich keineswegs von dem der Versteigerung unterschied. Es wurden hier Erwiderungen, Berechnungen, Tricks, umsichtige Finten von Händlern ausgetauscht. Die Produkte der Rede erfuhren hier lange vor den andren eine Rationalisierung: ein einziges Modell zwang sich auf. Als hätte man bei seiner Festlegung die allerärmsten Bedürfnisse und Kaufmöglichkeiten in Betracht gezogen. Man setzte klare und haltbare einfache Größen in Umlauf.
Die Macht des Marktes befreite die Menschen von ihren großen inneren Kräften. In ihren geheimsten Ratschluß führten sie eine Drehbank, eine Werkbank nach dem Bild ihrer Holzinstrumente ein. Sie holten unnachahmliche Naturen aus ihrem Innern und legten sie auf ihren Webstuhl. Sie gingen nicht wie Leibeigene heran, sich krümmend, sich wiederaufrichtend, Knoten springen und Späne regnen lassend. Zum Markt der Wahrheiten trugen sie dann gut gehobelte, gut zugeschnittene Abfälle, die jedoch ihrer ersten Tiefe näher waren als die unseren. Es geschah durchaus, daß man betrogen wurde, daß man träge Stuten, schlechte Worte kaufte: das merkte man beim Gebrauch, weil man sie nicht weitergeben konnte. Plötzlich, wie geschminkte Tiere, die ihre Makel offenbaren, erschienen diese übertünchten Gedanken unerklärlich und nackt. Dann, in seinem Schrecken, sie als einziger in seinem Gedächtnis zu besitzen, warf sie der frustrierte Mensch wütend auf den Müll. Nach solchen Reinfällen nahm man die Gewohnheit an, es mit den Worten ebenso zu halten wie jene Wechsler, die in die Geldstücke beißen oder sie gegen Marmor schlagen: jeder ließ sie von seiner ganzen Höhe bis an seinen Boden fallen und lauschte auf den Ton, den sie machten. So wurde die Evidenz geboren als Vorkehrung gegen diese Vorsichtsmaßnahmen.
Aber niemand glaubte, auf diesem Gebiet einen Tauschhandel zu betreiben, noch, daß es eine Ökonomik des Wahren gäbe. Denn jeder, der zu Hause Bilanz zog, dachte, wenn er in seinem Gedächtnis unter seinen neuesten Einkäufen seine eigenen Waren wiederfand, daß er etwas Neues erworben hätte, ohne etwas dafür abgetreten zu haben.
So vollzog das Denken langsam seinen Übergang vom immobilen zum mobilen Kapital.
Aber der Mensch stieß in sich selbst auf eine geheimnisvolle Umwälzung, die er mit meist noch mythologischen Mitteln zu erklären versuchte. So brachte er in zwei Phasen die Legende der Wahrheiten hervor. Ich bin etwas in Verlegenheit, einen Mythos nachzuzeichnen, der so viele und so verschiedene Formen annahm. Um das richtig anzufassen, muß man ihn als die Übertragung der inneren Verwirrung der Zeitgenossen betrachten, und diese Verwirrung muß man zunächst präzisieren.
Der Mensch hatte lange Zeit seine Gedanken wie sein Leben hervorgebracht, sie hafteten an seinem Körper wie die ägyptischen Tiere, die, von der Sonne im Schlamm des Nil gebildet, nur zur Hälfte geboren, ihre unvollendeten Pfoten im Dreck aufgehen lassen. Sie hatten kein anderes Band zu den Dingen als die große universelle Sympathie und nur einen magischen Einfluß auf sie. Sie glichen ihnen nicht wie ein Porträt seinem Modell, sondern wie eine Schwester ihrem Bruder durch ein Familienmerkmal, sie drückten ebensowenig die Pflanzen aus wie die Pflanzen das Meer ausdrücken; aber sie lebten wie die Pflanzen, die Winde und das Meer, mit Jahreszeiten, Tagundnachtgleichen, Flüssen und Rückflüssen, raschem und dann verlangsamtem Wachstum, Zurückbleiben und Überholen, zögerndem Aufblühen, etwas Aufgelöstem und Unordentlichem, kurz, einer absolut natürlichen Gestalt.
Doch siehe da, eine unwiderstehliche Bewegung trieb sie plötzlich ans andere Ende der Welt, unter die Produkte der Industrie. Man zog ihnen sorgfältig das Leben heraus, man schnitt alle ihre Bande zur Natur ab, man unterwarf ihre Hervorbringung technischen Regeln, kurz, man machte kostbare Erfolge der Kunstfertigkeit daraus, aber unbelebte, man verlieh ihnen zugleich den schrecklichen Titel «Vorstellungen [représentations]», eine neue Ehre, eine neue Pflicht, und eine anonyme Menge drängte sich unablässig im Geist eines jeden danach, die Ausübung der vorstehenden Funktion [fonction représentative] zu kontrollieren. Der Mensch war nicht mehr mit sich allein. Als er seine Gedanken mit den...
| Erscheint lt. Verlag | 14.11.2023 |
|---|---|
| Übersetzer | Uli Aumüller, Traugott König, Bernd Schuppner |
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Philosophie ► Philosophie der Neuzeit |
| Schlagworte | Bewusstsein • Ego • Essays • Gegenwartsphilosophie • Intentionalität • Phänomenologie • Philosophie |
| ISBN-10 | 3-644-01889-8 / 3644018898 |
| ISBN-13 | 978-3-644-01889-1 / 9783644018891 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 7,1 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich