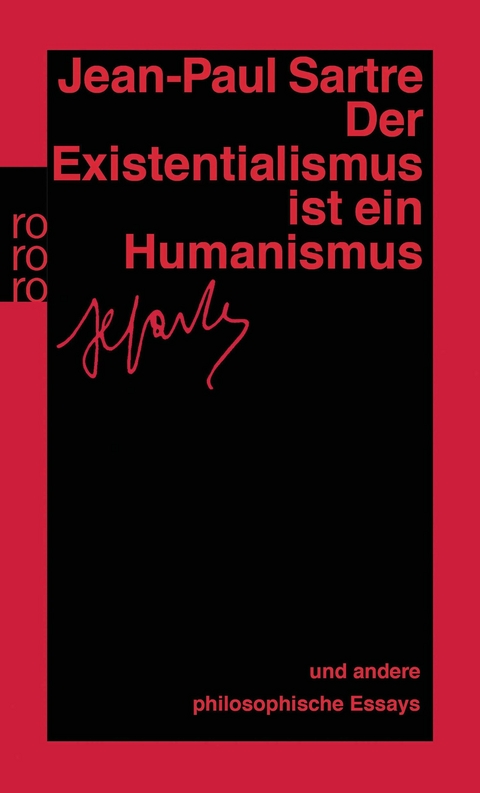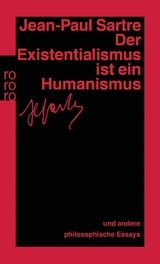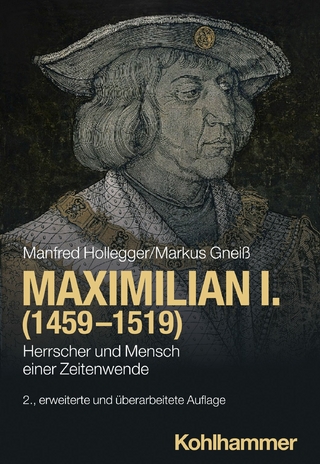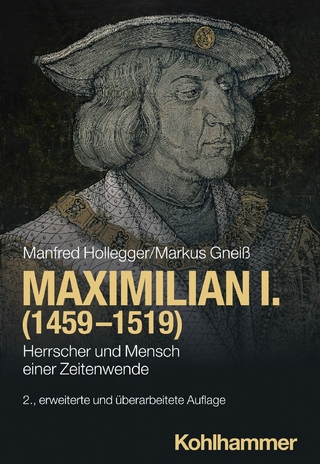Der Existentialismus ist ein Humanismus (eBook)
336 Seiten
Rowohlt E-Book (Verlag)
978-3-644-01884-6 (ISBN)
Geboren am 21.06.1905, wuchs er nach dem frühen Tod seines Vaters im Jahre 1906 bis zur Wiederheirat seiner Mutter im Jahre 1917 bei seinen Großeltern Schweitzer in Paris auf. 1929, vor seiner Agrégation in Philosophie, lernte er seine Lebensgefährtin Simone de Beauvoir kennen, mit der er eine unkonventionelle Bindung einging, die für viele zu einem emanzipatorischen Vorbild wurde. 1931-1937 war er Gymnasiallehrer in Philosophie in Le Havre und Laon und 1937-1944 in Paris. 1933 Stipendiat des Institut Français in Berlin, wo er sich mit der Philosophie Husserls auseinandersetzte. Am 02.09.1939 wurde er eingezogen und geriet 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft, aus der er 1941 mit gefälschten Entlassungspapieren entkam. Noch 1943 wurde unter deutscher Besatzung sein erstes Theaterstück «Die Fliegen» aufgeführt; im selben Jahr erschien sein philosophisches Hauptwerk «Das Sein und das Nichts». Unmittelbar nach dem Krieg wurde Sartres Philosophie unter dem journalistischen Schlagwort «Existenzialismus»zu einem modischen Bezugspunkt der Revolte gegen bürgerliche Lebensformen. 1964 lehnte er die Annahme des Nobelpreises ab. Zahlreiche Reisen führten ihn in die USA, die UdSSR, nach China, Haiti, Kuba, Brasilien, Nordafrika, Schwarzafrika, Israel, Japan und in fast alle Länder Europas. Er traf sich mit Roosevelt, Chruschtschow, Mao Tse-tung, Castro, Che Guevara, Tito, Kubitschek, Nasser, Eschkol. Sartre starb am 15.4.1980 in Paris. Auszeichnungen: Prix du Roman populiste für «Le mur» (1940); Nobelpreis für Literatur (1964, abgelehnt); Ehrendoktor der Universität Jerusalem (1976).
| Erscheint lt. Verlag | 17.10.2023 |
|---|---|
| Übersetzer | Werner Bökenkamp, Hans Georg Brenner, Margot Fleischer, Traugott König, Günther Scheel, Hans Schöneberg, Vincent von Wroblewsky |
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Philosophie ► Philosophie der Neuzeit |
| Schlagworte | Existenzialismus • Humanismus • Identität • Klassiker • Materialismus • Philosophie • Revolution |
| ISBN-10 | 3-644-01884-7 / 3644018847 |
| ISBN-13 | 978-3-644-01884-6 / 9783644018846 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
E-Book Endkundennutzungsbedinungen des Verlages
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich