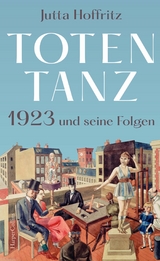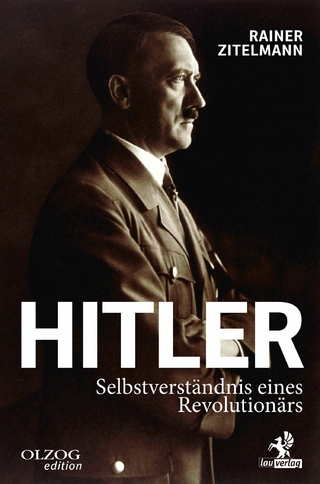Totentanz – 1923 und seine Folgen (eBook)
336 Seiten
Harpercollins (Verlag)
978-3-365-00131-8 (ISBN)
Die Mark fällt. Die Preise steigen.
Zwischen Rausch, Revolution und Radikalisierung - Chronik eines Jahres
1923 wird zum politischen und ökonomischen Wendejahr für Deutschland. Zwischen schwindelerregenden Brotpreisen, eskapistischen Tanzabenden, der folgenreichen Ruhrbesetzung und der Einführung der Rentenmark begleitet Jutta Hoffritz vier Deutsche durch das Jahr. Durch ihren Kampf. Ihren Alltag. Ihre Verhängnisse.
Wir erleben, wie Anita Berber - Berlins begehrteste Tänzerin - auf dem Zenit ihrer Karriere dem Rausch verfällt, wie Ruhrbaron Hugo Stinnes das Kalkül der Besatzer unterläuft und das Kohlekontor an die Alster verlegt, wie Reichsbankpräsident Rudolf Havenstein den Reparationsboykott finanziert und die Hyperinflation schürt, wie Käthe Kollwitz ihren Liebeskummer besiegt und das allgemeine Elend auf Plakaten festhält.
Über ein Jahr und seine Menschen. Über eine Zeit, in der Deutschlands Zukunft auf des Messers Schneide stand - und die unserer heutigen mehr gleicht, als uns lieb ist.
»Was die Wirtschaft betrifft, so sind von Dir angekommen 60 Millionen. Im übrigen hab ich für Lichtrechnung ausgelegt 34 Millionen, für Vorwärts 6 Millionen. Die Quittungen liegen bei den Briefen. Dann an Frau Fechter 4 Millionen und noch zur Wirtschaft erst 50 dann 20 Millionen zusammen 114 Millionen. Bei der Wiedergabe musst du abziehen, was ich hier gegessen habe. Nun lebt wohl und seid gegrüßt, die Zeit hier bei Euch war mir schön.
Eure Mutter.«
Käthe Kollwitz an ihren Sohn Hans, September 1923
<p>JUTTA HOFFRITZ, Jahrgang 1966, hat in Würzburg, New York und Berlin Volkswirtschaft studiert. Seit über zwanzig Jahren schreibt sie für <em>Die Zeit</em> u.a. über<strong><em> </em></strong>die Geschichte der Geldpolitik. Nebenher verfasst sie Beiträge für den Deutschlandfunk. Sie denkt über Inflation nach, seit ihr ihre Großmutter von ihren Erlebnissen im Ruhrgebiet des Jahres 1923 berichtete. Ein »Kalenderblatt«, das sie zum 150. Geburtstag des Inflationsgewinners Hugo Stinnes für den Deutschlandfunk verfasste, gab den Anstoß für dieses Buch. Jutta Hoffritz lebt und schreibt in Hamburg.</p>
JANUAR 1923 – DAS RUHRGEBIET WIRD BESETZT
Warum Ruhrbaron Hugo Stinnes an die Alster umzieht, weshalb das Berliner Glamourgirl Anita Berber in Wien nicht mehr willkommen ist. Wie die Künstlerin Käthe Kollwitz eine Schaffenskrise überwindet und die NSDAP in München ihren ersten Parteitag abhält.
Das Jahr 1923 hätte gut anfangen können für Anita Berber.
Sie ist Berlins begehrteste Tänzerin. Auch in Hamburg hat sie Furore gemacht: Sie hat den Nackttanz auf die Reeperbahn gebracht.
Huren sah man dort, seit es den Hafen gibt, auch nackte Damen gab es zu bestaunen – aber eine, die barbusig tanzt wie Anita Berber, das war selbst in St. Pauli eine Sensation. 1
Jetzt Wien! Bei der Premiere im Konzerthaus tanzt sie Ende 1922 vor ausverkauftem Haus. »Tänze des Lasters« – hüllenlos! Den ganzen Dezember über stehen die Wiener Schlange, um die zarte Gestalt mit den kleinen festen Brüsten zu bewundern.
Ist es die Nacktheit selbst, die die Blicke auf sich zieht? Oder ist es der Gegensatz zwischen dem mädchenhaften Körper und der Morbidität der Darbietung?
Die »Tänze des Lasters« basieren auf Gedichten ihres Partners Sebastian Droste – expressionistische Gedichte. Sie tragen Titel wie »Morphium« und »Kokain« und beschreiben den Kampf mit der Sucht.
»Tanzender Schatten
Kleiner Schatten
Großer Schatten
Der Schatten
Oh – der Sprung über den Schatten
Er quält dieser Schatten
Er martert dieser Schatten
Er frisst mich dieser Schatten
Was will dieser Schatten?
Kokain« 2
So heißt es in dem Gedicht »Kokain« von Droste.
Als sich der Vorhang öffnet, sieht das Publikum den halb entblößten Körper Berbers am Boden liegen. Totenstille. Gerade scheint das Gift ihre bleichen Gliedmaßen zu durchdringen. Dann Zuckungen, Konvulsionen. 3
Langsam kehrt Leben in den mageren Leib zurück.
Zum »Danse Macabre« von Camille Saint-Saëns erhebt sich Anita Berber, die Arme noch hinterm Kopf verschränkt. Ihre Brüste beben. Mit angstgeweiteten Augen blickt sie in die Ferne. Der Rhythmus erfasst sie, trägt die schlanken Glieder mit sich fort. Sie bewegen sich immer schneller, zucken wie bei einer Marionette. Eine Marionette der Sucht.
© INTERFOTO / Friedrich
Anita Berber – Berlins begehrteste Tänzerin. Und ein Leben zwischen Glamour und Abgrund.
»Der gesunde Körper kämpft gegen den vergifteten Körper«, notiert der tschechische Tänzer Josef Jenčík. Er ist Choreograf am Prager Nationaltheater. 4 Nun sitzt er im Publikum und wird jeden einzelnen Schritt und jeden Sprung mitstenografieren. So etwas hat er noch nicht gesehen.
»Die Drehungen des Körpers um die eigene Achse unerhört langsam wie in Zeitlupe. Die stoßartigen Sprünge – wie Peitschenhiebe – enden immer in einem plastischen von Bildhauern erträumten Port de bras.« 5
Er kommt kaum hinterher mit dem Schreiben, auf der Bühne ist einfach zu viel los. Und als schließlich der Körper der Tänzerin »in einer riesigen Kaskade« zu Boden stürzt, sich dort zuckend bewegt, bis er schließlich in einen süßen Schlaf zu fallen scheint, ist der schreibende Choreograf vermutlich fast so erschöpft wie die Tänzerin selbst.
Für Anita Berber aber geht es am nächsten Morgen direkt weiter – im Fotoatelier von Dora Kallmus, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Madame d’Ora. 6 Die berühmte Fotografin hat schon alle Blaublüter der Donaumonarchie für die Ewigkeit festgehalten und die gesamte Wiener Kunstszene. 7 Auch von Anita Berber hat sie schon Aufnahmen gemacht. Jetzt plant sie ein Buch mit ihr.
Die Fotografin weiß natürlich, dass die großen Kinderaugen der Tänzerin geschminkt sind, genau wie ihre herzförmigen Lippen. Sie weiß, dass Berber sich die Achseln rasiert und die Schamhaare mit hautfarbenem Tuch abklebt, um ihr jungmädchenhaftes Aussehen zu unterstreichen. Und sie weiß, dass Anita Berbers Make-up – wenn die Beleuchtung nicht hundertprozentig stimmt – wie eine Maske wirkt. Dann sieht die verführte Unschuld aus wie ein billiges Flittchen.
Doch Madame d’Ora beleuchtet gut – und sie ist diskret. Sie ist ein Profi, die Gesellschaftsfotografin dieser Zeit.
Die Wiener Zeitungen berichten fleißig 8 : über die ausverkauften Vorstellungen, aber auch darüber, wie sich die dreiundzwanzigjährige Anita Berber im Kaffeehaus eine Kokainspritze in den Oberschenkel jagt. 9
Und über die Verhaftung ihres Partners, Sebastian Droste. Man verdächtigt ihn, zwei deutsche Gräfinnen um Schmuck und Geld bestohlen zu haben. Das sorgt aber nur kurz für Ärger, denn ganz Wien verzehrt sich nach dem Duo.
Dass die beiden daraufhin Engagements mit drei Theatern gleichzeitig eingehen, bleibt dann aber doch nicht folgenlos. Man will die Tänzer ausweisen. Sie werden vor das Schiedsgericht der Internationalen Artistenorganisation zitiert. Anita Berber und Sebastian Droste geloben Besserung. Sie treten aber doch in allen drei Etablissements auf – und obendrein noch in einem vierten!
Dann werden sie erneut des Diebstahls verdächtigt – diesmal geht es um eine verschwundene Handtasche –, und so wird ihre Aufenthaltserlaubnis tatsächlich nicht verlängert. Am 5. Januar 1923 wird Sebastian Droste aus Österreich ausgewiesen und acht Tage später auch Anita Berber.
Als die Polizei kommt, tritt sie den Beamten nackt entgegen. Doch das nützt nichts. Sie wird abgeschoben.
Es ist keine gute Zukunft, die in Deutschland wartet: Die Mark verliert ständig an Wert. Die wachsende Anzahl der Nullen auf den Preisschildern wird die Deutschen zu der Einsicht zwingen, dass sie der Krieg, den sie mit einem Sieg beschließen und von den Verlierern finanzieren lassen wollten, nun selbst teuer zu stehen kommt.
Lange hat die Republik taktiert, hat darüber gestritten, ob und wie der Vertrag von Versailles zu erfüllen sei. Nun verlieren die Sieger die Geduld.
Im Jahr fünf nach Kriegsende wird Deutschland sich beugen müssen. In Berlin werden sich in diesem Jahr drei Kabinette verschleißen.
Die junge Republik radikalisiert sich.
© INTERFOTO / Friedrich
Angehörige der Sturmabteilung (SA) mit Standarten auf dem Marsfeld. Erster Parteitag der NSDAP in München, 27.–29. Januar 1923.
Ende Januar 1923 hält die NSDAP in München ihren ersten Parteitag ab, 10 im November wird Adolf Hitler dort erstmals nach der Macht greifen – noch ohne Erfolg. Und doch wird dies das Jahr der Wende werden: Ab 1923 ist Deutschland eine Demokratie auf Abruf.
******
Das Jahr 1923 beginnt schlecht, auch für Hugo Stinnes – aber der Mann weiß sich zu helfen.
Der Ruhrindustrielle ist zweiundfünfzig Jahre alt und auf dem Zenit seiner Macht. Er beschäftigt insgesamt 600000 Menschen in einem Mischkonzern, der weit über Deutschlands Grenzen hinausreicht. Stinnes ist zu dieser Zeit der größte Arbeitgeber der Welt – und definitiv der mächtigste Unternehmer Deutschlands. 11
Ansehen lässt er sich das nicht. Der kleine Mann mit dem stechenden Blick und dem dichten dunklen Bart kleidet sich stets korrekt. Doch seine Anzüge sind so gewählt, dass sie ihm weder eine Inspektion seiner Bergwerke, Hochöfen und Schiffswerften übel nehmen noch seine vielen Reisen nach Berlin. 12
In Berlin-Mitte allerdings fallen Hosen ohne Bügelfalten auf. Einmal, als Stinnes das Hotel Esplanade am Potsdamer Platz betritt, will man ihn am Empfang abweisen. Solche Personen wie er seien hier nicht willkommen, bescheidet man ihm, worauf Stinnes ungerührt entgegnet: »Darüber entscheide ich, das Hotel gehört mir.« 13
Die typische Hemdsärmeligkeit eines Mannes, der sich alles selbst aufgebaut hat. Zwar hat schon sein Großvater mit Kohle gehandelt und der Vater in großem Stil Kohle gefördert. Es war eine familieneigene Grube, in der der junge Hugo das Kohlehauen lernte. Das anschließende Bergbaustudium in Berlin aber fiel kurz aus.
Hugo Stinnes ist erst siebzehn Jahre alt, als sein Vater stirbt. Er ist früh auf sich gestellt – und wenig angetan von der Vorstellung, die Firma mit seinem Vetter fortzuführen. Daher kauft er der Familie eine Zeche ab und zieht sein eigenes Geschäft auf.
© INTERFOTO / Sammlung Rauch
Hugo Stinnes – größter Arbeitgeber der Welt und mächtigster Unternehmer Deutschlands. Auch in die Politik hatte der Ruhrbaron einen guten Draht.
Bald schon kommen neue Kohlefelder dazu. Er expandiert. Investiert in Stahl und in andere kohlenahe Branchen, hilft den Stromkonzern RWE aufzubauen – und lässt dessen Kraftwerk direkt über einer seiner Zechen errichten. 14
Nützlich bei alldem ist das Rheinisch-Westfälische Kohlen-Syndikat, dem außer Stinnes auch all die anderen Ruhrbarone angehören. 15 Ein Rohstoffkartell, das – ähnlich wie später die...
| Erscheint lt. Verlag | 27.9.2022 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► 20. Jahrhundert bis 1945 |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte ► Regional- / Ländergeschichte | |
| Schlagworte | 1923 • Anita Berger • Babylon Berlin • Die große Inflation • Februar 33 • Florian Illies • Hitlerputsch • Hugo Stinnes • Hyperinflation • Käthe Kollwitz • Liebe in Zeiten des Hasses • Notenbank • Rudolf Havenstein • Ruhrbesetzung • Uwe Wittstock |
| ISBN-10 | 3-365-00131-X / 336500131X |
| ISBN-13 | 978-3-365-00131-8 / 9783365001318 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich