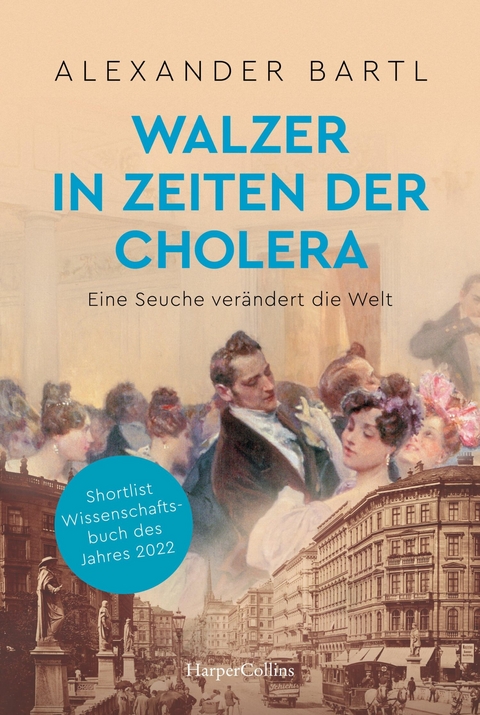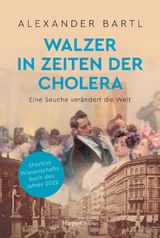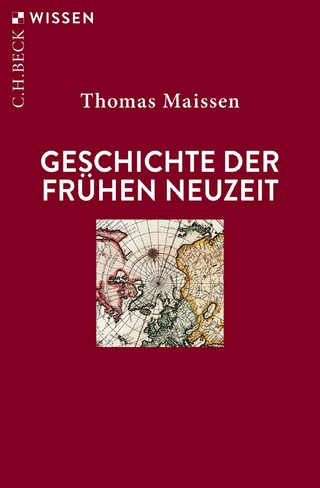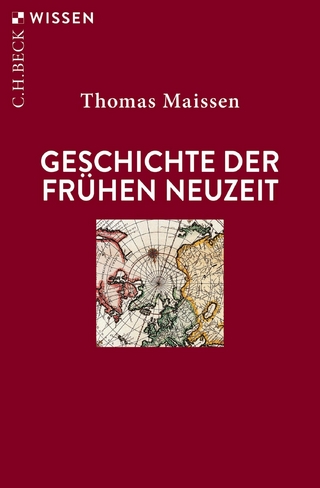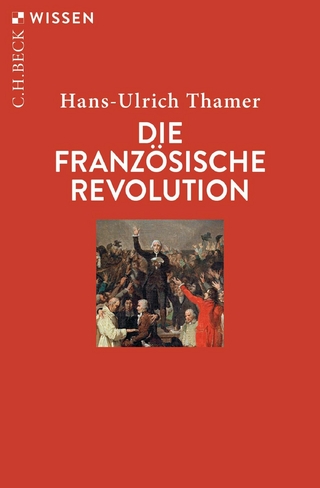Walzer in Zeiten der Cholera – Eine Seuche verändert die Welt (eBook)
352 Seiten
Harpercollins (Verlag)
978-3-7499-5116-1 (ISBN)
---Enthält den Text der aktualisierten Taschenbuch-Ausgabe---
Zwischen Tanzlust und Todesangst - eine Epidemie polarisiert die Gesellschaft
Wien, 1873: Die Stadt feiert die Weltausstellung, während sich über Galizien und Ungarn die Cholera nähert. Ein Bergsteiger und ein Schmetterlingssammler wollen Wien mit reinstem Quellwasser vor der Epidemie schützen und die Alpen anzapfen. Sie treffen auf massiven Widerstand, ihr Projekt sei größenwahnsinnig und überflüssig. Doch dann sterben die ersten Gäste ...
Der 1873 entbrannte Streit ähnelt den Ereignissen der Gegenwart, selbst die Kampagnenschlagwörter sind die gleichen. Spannend und verblüffend aktuell erzählt Alexander Bartl, wie Seuchen die Gesellschaft verändern.
Ein Buch über Menschen im Ausnahmezustand und die Sehnsucht nach Normalität
»Trotz ihrer Lebensfreude waren die Wiener nicht geschont worden. Trotz der Tragödie tanzten sie weiter. Auch der Vater des Schriftstellers Oscar Wilde, der Arzt William Wilde, der unmittelbar nach der ersten Pandemie bei Josef Skoda im Allgemeinen Krankenhaus hospitierte, staunte über die ?Tanz-Manie? in den Wirtshäusern und sogar auf den Straßen. ?Es ist wirklich berauschend für einen Fremden, so viele Dinge um einen herum zu sehen, die sich im Kreis drehen Männer, Frauen und Kinder - [...] die Glücklichen und die Melancholischen?, notierte der junge Mediziner. Kaum ertöne irgendwo ein Walzer, springe der Kutscher von seinem Wagen, lasse die Wäscherin ihren Korb fallen, und Arm in Arm drehten sie sich im Takt.
Der Walzer war in den Jahren der Cholera zu einem der erfolgreichsten Exportprodukte der Monarchie aufgestiegen ...«
»Über Jahrhunderte hatte sich die Medizin damit begnügen müssen, Kranke zu versorgen und im besten Fall zu heilen. Dank neuer Erkenntnisse konnte sie nun darauf hinwirken, dass Gesunde erst gar nicht erkrankten. Je besser die Wissenschaft verstand, wie der Organismus funktionierte, desto genauer wusste sie, was ihn schädigte.
Theoretisch waren viele Wiener die Vermüllung zwar leid, vor allem dann, wenn andere dafür verantwortlich waren. Doch sobald Hygienemaßnahmen den persönlichen Handlungsspielraum einschränkten, sobald womöglich sogar die eigenen Geschäfte darunter litten, sah die Sache anders aus.«
»Alexander Bartl erzählt höchst lesenswerte und überraschend aktuelle Geschichten rund um den Bau der Wiener Hochquellenwasserleitung.« Klaus Taschwer, Der Standard, 29.09.2021
»'Walzer in Zeiten der Cholera' ist bedrückend aktuell.« »Alexander Bartls historisches Werk ist spannend aufbereitet und gibt Hoffnung.« Imogena Doderer, ORF, 27.09.2021
»Minutiös recherchiert und trotzdem stellenweise wie ein Roman erzählt Bartl, mit verschmitztem Humor.« Anne-Catherine Simon, Die Presse, 21.09.2021
»Focus-Textchef Alexander Bartl hat ein Sachbuch geschrieben, das spannend ist wie ein Roman.« G/Geschichte, 17.09.2021
»Tatsächlich ist 'Walzer in Zeiten der Cholera' ein behände zu lesendes Buch über jene Zeit sowie über Menschen im Ausnahmezustand und deren Sehnsucht nach Normalität.« Edgar Schütz, APA, 06.09.2021
<p>ALEXANDER BARTL wurde 1976 in Wien geboren. Er studierte Film- und Theaterwissenschaft sowie Publizistik in Mainz und Edinburgh. Als Journalist schrieb er auch für die<em>Frankfurter Allgemeine Zeitung</em> und für das österreichische Nachrichtenmagazin <em>Profil</em>. Heute arbeitet Alexander Bartl für <i>Focus</i> in Berlin. Sein erstes Sachbuch »Walzer in Zeiten der Cholera« schaffte es auf die Shortlist für das »Wissenschaftsbuch des Jahres 2022«.</p>
1
DER BRUNNEN
Wien, 1873
Am Morgen des 24. Oktober kehrte gegen alle Wahrscheinlichkeit der Spätsommer zurück, als wollte er Wien mit ein bisschen Glanz auf den Pfützen für die Verluste entschädigen.
Die Bevölkerung hatte sich längst auf den Winter eingestellt. Fiel der erste Schnee, nahte Silvester, und dann war sie dieses unselige Jahr endlich los. Die vergangenen Monate hatten die österreichische Reichshauptstadt ausgezehrt. Tausende waren verarmt, Hunderte qualvoll gestorben. »Der Blick hebt sich über die unmittelbare Noth der Gegenwart hinaus in bessere Zeiten« 1, schrieb die Tageszeitung Die Presse. Es klang wie ein Wunschtraum. Wenigstens brach die Sonne durch das Grau. Deshalb und weil Träume manchmal in Erfüllung gingen, rafften sich die Wiener auf, um dem Jahr 1873 eine letzte Chance zu geben.
Alle kamen, die Fürsten und Grafen, die Bürger, Handwerker und Habenichtse. Sie versammelten sich auf dem Schwarzenbergplatz. Noch mehr Neugierige drängten nach, von Norden, Osten und Westen, nur nicht von Süden, denn dort stand das Palais Schwarzenberg im Weg. Sie füllten die Seitenstraßen, warteten selbst dort, wo sie den Schauplatz gar nicht mehr einsehen konnten. Die Sehnsucht, anwesend zu sein, wenn Großes geschah, hob die Laune und stimmte sie zuversichtlich. Der Reporter des Illustrirten Wiener Extrablatts versuchte den Überblick zu behalten. Dieser Trubel, diese Menschenmassen – das sei ja »lebensgefährlich«, notierte er, und weiter:
»Der ganze weite Raum zwischen dem Palais Schwarzenberg, der Heumarktkaserne und der Karlskirche, ja bis zur Polytechnik war mit Festtheilnehmern übersät; von dem Gitterthore, das zum Schwarzenbergpalais führt, über den Schwarzenbergplatz bis zur Ringstraße hielt eine lebende, drängende, stoßende, erwartungsvolle Menschenbarriere die Straße umrahmt. […] Auf den Dächern der den Festplatz umgebenden Häuser gab’s Leute in Menge; selbst auf der Höhe der Kuppel der Karlskirche krabbelten menschliche Wesen umher.« 2
Es war voll, es war eng, aber Chaos herrschte nicht. Das Ständebewusstsein saß tief in diesen Tagen, und so sortierten sich die Schaulustigen instinktiv nach ihrem gesellschaftlichen Rang: ganz vorne die prächtigen Kleider, die breitrandigen Hüte und orientalisch gemusterten Gehröcke aus dem Atelier des Wiener Meisterschneiders Joseph Gunkel, hinten die verwaschenen Schürzen und fadenscheinigen Hosen. Wo sich die Ärmsten unter die Reichsten mischten, gingen berittene Wachmänner dazwischen. Ihre kräftigen Pferde flößten Respekt ein.
Der Reporter der Wiener Morgen-Post widmete sich dem Dekor der Veranstaltung:
»Der ganze Festplatz war mit Masten umgeben, an deren Spitzen die österreichischen Adler im reichsten Fahnenschmucke prangten. Die Flaggen trugen die Reichs-, Landes- und Stadtfarben, sowie auch jene des Heimatlandes unserer Monarchin, nämlich die bayerischen Farben. Alle Flaggenmaste hatte man durch Reisigguirlanden miteinander verbunden und der ganze Festraum war mit Blumengewächsen geschmückt.« 3
Außerdem, berichtete der Journalist, hätten an allen vier Ecken weitere Masten gestanden, die »elektrische Sonnen« trugen, um den Platz künftig auch nachts zu erhellen.
Etwas höher gelegen, im Hof des Palais Schwarzenberg, erhob sich das Festzelt des Kaisers. Dort posierten Minister und Generäle neben den Herren des Wiener Gemeinderats im Sonnenlicht. In den Fräcken begann man zu schwitzen. Lichtreflexe tanzten über die Trompeten und Posaunen der Musikkapellen, die zu beiden Seiten Aufstellung genommen hatten. Alles war vorbereitet für den großen Empfang. Doch der Monarch ließ auf sich warten. Der eine oder andere der Honoratioren, der die Zeit mit gepflegter Konversation überbrücken wollte, gab den Versuch bald wieder auf, weil er sein eigenes Wort nicht verstand. Die Zuschauer lärmten, am lautesten diejenigen, die am wenigsten besaßen. Was für ein grandioser Tag!
Allein das Bauwerk, das an diesem Tag vom Kaiser seiner Bestimmung übergeben werden sollte, sah denkbar unspektakulär aus. Ein Bassin, eingefasst in ein gemauertes Rund, das war alles. Ein leerer Springbrunnen! Keine nackten Statuen im römischen Stil, nicht einmal einen winzigen Neptun hatte man in die Mitte gesetzt. Stattdessen lagen dort nur ein paar Felsbrocken, die das Wasserrohr kaschierten. Obwohl sonst noch nichts zu sehen war, wirkten die Zuschauer ziemlich überdreht. Vielleicht sahen sie in ihrer Fantasie schon die Fontäne in den Himmel steigen. Oder sie waren einfach dankbar dafür, dass endlich etwas passierte, das sie ablenkte von der Tristesse.
Das Jahr der Wiener Weltausstellung hatte sich zur Katastrophe entwickelt. Die Hoffnungen waren so groß gewesen. Doch dann geschah ein Unglück nach dem anderen. Erst kollabierte die Wiener Börse, etliche Firmen gingen bankrott, viele Anleger verloren ihr Vermögen, ihre Häuser, ihren Stolz. Und seit dem Sommer wütete die Cholera in der Stadt. Gäste flohen, Menschen starben, die bisher größte Weltausstellung, die erste auf deutschsprachigem Terrain, endete im größten finanziellen Desaster seit Jahrzehnten. Was die meisten nicht ahnten: Alles hing mit allem zusammen. Die Rolle, die Gott und Schicksal spielten, wurde in der Tagespresse jedenfalls maßlos überbewertet.
Pünktlich zur Einweihung des neuen Brunnens aber schien all das vergessen. Zwei Männer standen etwas abseits der übrigen Ehrengäste, schlank der eine, untersetzt und schon etwas älter der andere, auch wenn man seinem vollen Gesicht die Jahre nicht ansah. Eduard Suess war Geologe, Cajetan Felder der Bürgermeister der Stadt Wien. Beide wirkten so angespannt, dass nicht klar war, ob sie wegen der Sonne schwitzten oder vor Aufregung.
Als überflüssig, als sündteuren Irrsinn hatte man ihr Projekt geschmäht. Mit Überzeugungskraft allein wäre dieser Brunnen niemals vollendet worden. Auch Glück hatte eine Rolle gespielt. Genau das machte Suess nun nervös, weil es bedeutete, dass der Zufall zum Gelingen beigetragen hatte, was wiederum hieß: Er hatte nicht alles unter Kontrolle. Eine beunruhigende Erkenntnis für einen Wissenschaftler wie ihn. Zumal, wenn der Kaiser zur Eröffnung kam.
Während das Publikum an diesem Tag vor allem ein Wasserspektakel bewundern wollte, sah Eduard Suess in dem Brunnen das Finale eines großartigen Gesamtwerks. Das Becken markierte das nördliche Ende der spektakulärsten Wasserleitung der Welt. Dabei ging es dem Geologen nicht um Rekorde. Er hätte sich auch mit einer weniger komplexen Anlage begnügt. Für ihn zählte allein die Reinheit des Wassers. Es musste exzellent sein, kühl und klar wie ein Kristall.
Seine Ansprüche waren so hoch, dass viele Wissenschaftler anderer Länder mit Unverständnis, wenn nicht mit sanftem Spott reagierten. War die österreichische Residenzstadt nicht europaweit berüchtigt für die trübe Brühe, die sie ihren Gästen als erfrischenden Trunk vorsetzte? In englischen Zeitungen las man gelegentlich von verzweifelten Gästen, die in Wiener Hotels Eau de Cologne in ihren Tee kippten, damit er nicht so penetrant roch. Und nun peilte die Stadt chemische Werte an, die Wasser in einer Metropole unmöglich erzielen konnte.
Sogar der unschuldigste Bach lagerte Staub ein, sobald er durch bebautes Gebiet floss. Und ein Hauch Ammoniak war ja wohl nicht der Rede wert. Würde man alle Bestandteile herausfiltern, um den Reinheitsgrad zu erreichen, der Eduard Suess vorschwebte, bliebe vom Wasser nichts mehr übrig, hatten preußische Forscher postuliert. Wiens Ambitionen erschienen grotesk.
Selbst viele Einheimische hatten an dem Projekt gezweifelt und behauptet, es gelinge nie. Dennoch umlagerte halb Wien nun diesen Brunnen, um sich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Hätte Paris etwas Vergleichbares gewagt, wäre Wien dem großen Vorbild bereitwillig gefolgt. Frankreich besaß eben dieses unbestechliche Gespür für den Chic der Zeit. Ging es aber darum, eine Pioniertat zu vollbringen, tat sich die k. k. Reichshauptstadt schwer.
Eduard Suess hielt diesen Wesenszug seiner Heimat für eine Marotte, die man ihr austreiben konnte. Dabei hatte er zehn Jahre lang gegen Widerstände kämpfen müssen, lange genug, um die Beharrungskräfte des offiziellen Wiens kennenzulernen und darunter zu leiden. Aber seine Erfolge als Wissenschaftler bestärkten ihn in der Überzeugung, dass er mit seiner Kompromisslosigkeit richtiglag. Letztlich ging es doch darum, nach Neuem zu streben!
Suess blinzelte in die Sonne und wirkte nun wieder fast so selbstsicher wie Feldmarschall Schwarzenberg, dem man auf der anderen Seite des Platzes ein Reiterdenkmal errichtet hatte. Allerdings sah der Geologe besser aus. Seine ausgeprägten Wangenknochen und die schmale, gerade Nase entsprachen dem klassischen Ideal. Die Porträtfotografen seiner Zeit gaben sich jedenfalls alle Mühe, die vorteilhaften Züge optimal in Szene zu setzen. Für Männer mit solch einem Gesicht ließen Frauen in den damals auf Wiener Bühnen beliebten Lustspielen von Molière ihre verschrobenen Verehrer im Stich, ohne mit der Wimper zu zucken.
Trotzdem wäre der Wissenschaftler eine Fehlbesetzung gewesen, denn er schwärmte allein für seine Ehefrau, die sieben Kinder – und für Gesteine. Im Jahr 1873 standen seine einflussreichsten Forschungen zwar noch bevor, doch sein Name kursierte schon europaweit in geologischen Fachkreisen. Kaum einer bezweifelte noch, dass dieser Suess ein ganz Besonderer war.
Plötzlich kam Unruhe auf, ein Mann in Sonntagsgarderobe wurde...
| Erscheint lt. Verlag | 21.9.2021 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Neuzeit bis 1918 |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte ► Regional- / Ländergeschichte | |
| Schlagworte | 1873 • 19. • 1900 • Autor • Belletristik • beste • Bestseller • Buch • Bücher • Cholera • cholera hamburg • der • Deutsch • Ehefrau • Epidemie • Erfolgsautor • Europas • Freundin • für • Geschichte • Geschichte 19. Jahrhundert • Geschichte Buch • geschichte bücher • Geschichte Europas • Geschichten • Geschichte Wien • Gesellschaft • Gesundheit • Habsburgerreich • Hamburg • Historisches • Hygiene • In • Jahrhundert • Krankheit • Krisenmanagement • Kulturgeschichte • Liebe • Liebe in Zeiten der Cholera • Mama • Medizingeschichte • Medizinwissenschaft • Muttertag • Öffentliche • Oscar • Österreich • Pandemie • pandemie buch • pandemie bücher • pandemie geschichte • Pandemiegeschichte • Pandemie Wien • Roman • Sachbuch • sachbuch pandemie geschichte • Sozialgeschichte • Spiegel • Stadtentwicklung • Tanz • Top • Top-Titel • UM • Walzer • Wasserversorgung • Weltausstellung • Wien • Wien 1900 • Wien Buch • Wien Geschichte • Wien um 1900 • Wilde • William • Zeiten |
| ISBN-10 | 3-7499-5116-0 / 3749951160 |
| ISBN-13 | 978-3-7499-5116-1 / 9783749951161 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich