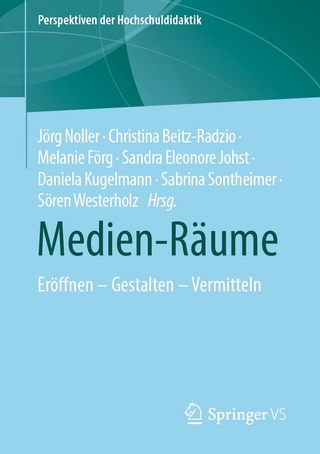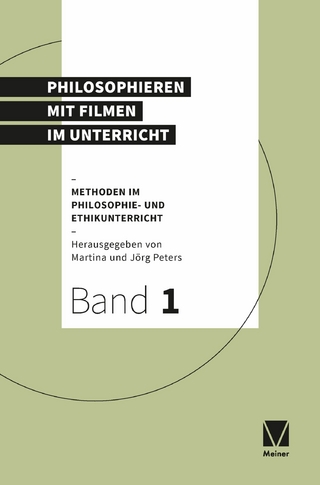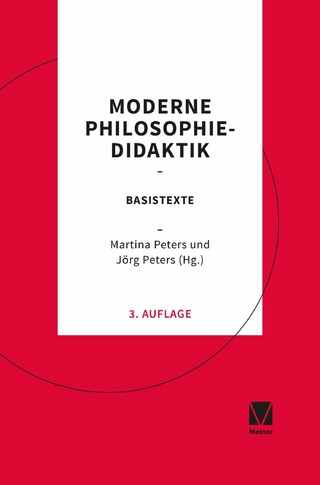Mensch-Maschine-Interaktion (eBook)
IX, 380 Seiten
J.B. Metzler (Verlag)
978-3-476-05604-7 (ISBN)
Oliver Müller ist seit 2017 Heisenberg-Professor am Philosophischen Seminar der Universität Freiburg mit Schwerpunkten in der Technik- und Naturphilosophie, der Philosophischen Anthropologie und der Ethik.
Kevin Liggieri, Promotion über die Begriffs- und Kulturgeschichte der Anthropotechnik, DFG-Forschungsstipendiat an der Professur für Wissenschaftsforschung, ETH Zürich.
Inhalt 5
Vorwort 7
I Vorgeschichte(n): Das Verhältnis von Menschen und Maschinen als Grundthema der (abendländischen) Kultur 10
1 Mensch-Maschine-Interaktion seit der Antike: Imaginationsräume, Narrationen und Selbstverständnisdiskurse 11
1.1 Von Dei ex machina und Androidinnen: Maschinenfaszinationen seit der Antike 11
1.2 Luftschiff, Tauchboot und vor allem die Uhr: Imaginationsräume in Mittelalter und Früher Neuzeit 14
1.3 Von der machina mundi zum l’homme machine: Die Maschine als Leitmetaphorik des neuzeitlichen Selbst- und Weltverständnisses 16
1.4 Schauder, Resonanz und Selbsterkenntnis: Wie Menschen ihren Maschinen begegnen 18
1.5 Die Entdeckung der Maschine als soziales, kulturelles und philosophisches Thema im 19. Jahrhundert 20
2 Eine kurze Geschichte der Maschinenmodelle des Denkens 23
Literatur 25
II Mensch-Maschine-Interaktionen: Paradigmen,Wandel, Brüche 26
3 Arbeitsteilung: Neue Formen der Mensch-Maschine-Interaktion 27
3.1 Terminologie und philosophische Voraussetzungen 27
3.2 Hegel 29
3.3 Marx 31
3.4 Ausblick 33
Literatur 33
4 Scientific Management und Psychotechnik 35
4.1 Der Name des Taylorismus 35
4.2 Methoden und Grundsätze des Taylorismus 35
4.3 Taylorismus in Europa 36
4.4 Der Name der Psychotechnik 36
4.5 Methodik der Psychotechnik 37
4.6 Durchsetzung der Psychotechnik im Ersten Weltkrieg 37
4.7 Blütezeit der Psychotechnik 38
4.8 Weiterleben der Psychotechnik 40
Literatur 41
5 Der ›neue Mensch‹ an neuen Maschinen 42
5.1 Von einer Vision der Avantgarden zum politischen Totalitarismus 42
5.2 Der Film als Mittel der Konditionierung 42
5.3 In der Maschinenhalle: Taylorismus und Psychophysik 43
5.4 Die technische Welt 44
5.5 Philosophie der Technik 45
5.6 Der Rhythmus der Maschinen 45
5.7 Die technische Mobilmachung: Ernst Jünger 46
Literatur 48
6 Maschine als Trauma: Die Prothesen der Kriegsversehrten 49
6.1 Destruktion und Innovation 49
6.2 Staatliche Fürsorge und Prothetik 50
6.3 Vom Ersatzteil zum Medium des Selbstbezugs 52
6.4 Prothesen zeigen 55
Literatur 56
7 Organprojektionstheorien und ›Gliedmaßengemeinschaften‹ von Menschen und Maschinen 58
Literatur 62
8 Die Maschine als Resonanz des Menschlichen 64
8.1 Hermann Schmidts Technikphilosophie 66
8.2 Fazit 67
Literatur 68
9 Relationale Existenzweisen von Maschinen 69
9.1 Gilbert Simondon 69
9.2 Bruno Latour und die ANT 73
9.3 Fazit 75
Literatur 75
10 Die Mensch-Maschine als Utopie 77
10.1 Wer ist wessen Prothese? 78
10.2 Schlussbemerkungen 84
Literatur 85
11 Die Diktatur der Maschinen und die Antiquiertheit des Menschen 87
11.1 Philosophiegeschichtlicher Kontext 87
11.2 Genese der Andersschen Technikphilosophie 88
11.3 Paradigmatische Technologie Atombombe: Verlust der Autonomie durch Komplexität 89
11.4 Paradigmatische Technologie Raumfahrt: Verlust der Autonomie durch Automatisierung 89
11.5 Paradigmatische Technologie Fernsehen: Kritik am Bild 90
11.6 Emotionstheoretische Grundlegung: Der Begriff der prometheischen Scham 91
11.7 Nachrangigkeit von Wirtschaft und Politik 92
11.8 Allgemeine Vernetzung als Vision 92
Literatur 93
12 Ge-stell und Megamaschine: Zur Genese zweier Deutungsapparaturen 94
12.1 Von der ›totalen Mobilmachung‹ zur Herrschaft des ›Riesenapparats‹ und des ›Makrogeräts‹ 94
12.2 Die ›Machenschaft‹ 95
12.3 Das ›Ge-stell‹ und sein Begriffsumfeld 97
12.4 Von der Mensch-Maschine-Interaktion zur ›Organisationsmensch-Megamaschine-Interaktion‹ 98
Literatur 100
13 Mensch-Maschine-Schnittstellen in Technosphäre und Anthropozän 101
13.1 Wortgeschichte von Sphäre und Technik 101
13.2 Geo- und Biosphäre 102
13.3 Entstehung des Begriffs der Technosphäre als störendes Teilsystem der Biosphäre um 1970 104
13.4 Noosphäre als Technosphäre 106
13.5 Technosphäre im Anthropozän 107
13.6 Mensch-Maschine-Schnittstellen und die Biopolitik der Technosphäre 108
13.7 Die Ruinen und die Zukunft der Technosphäre 110
Literatur 111
14 Interaktionen in der Technosphäre und Biofakte 112
14.1 Technosphären-Konzepte 112
14.2 Biofakte 117
Literatur 119
15 Von der Regelung und Steuerung zur Kybernetik 120
15.1 Vom Flaschenzug zum Schachcomputer 120
15.2 Regelung, Steuerung, Organisation 121
15.3 Mechanisierung des Welt- und Menschenbildes 123
15.4 Lebenskraft 124
15.5 Zwei Geschichten 126
Literatur 126
16 Kybernetische Maschinen – artifizielles Leben oder lebhafte Artefakte? 128
16.1 Phänomenlage 128
16.2 Positionen 130
16.3 Fazit 132
Literatur 132
17 Das Lernen der Maschinen 134
17.1 Vorbemerkungen 134
17.2 Philosophische Zugänge 135
17.3 Interaktion mit lernenden Maschinen: Wie interagiert man mit lernenden Maschinen? 137
Literatur 139
18 Anthropotechnik. Mensch und Maschine als (System-)Partner 140
18.1 Problemstellungen 140
18.2 Forschungsstand: Kybernetisches und ingenieurwissenschaftliches Menschenbild 141
18.3 Vorbedingungen und Möglichkeiten einer technikwissenschaftlichen ›Anthropotechnik‹ 142
18.4 Das Forschungsinstitut für Anthropotechnik 143
18.5 Anthropotechnische Anthropologie 144
18.6 Zusammenfassung und Ausblick 145
Literatur 146
19 Die Maschine als Spielpartnerin 148
19.1 Zauberkreise und Rahmen 148
19.2 Spielen mit dem Computer 149
Literatur 154
20 Die Maschine als Konkurrentin im Mensch-Maschine-Vergleich 156
20.1 Mensch-Maschine-Vergleich in der Philosophie, der Populärkultur und den Medien 156
20.2 Hand, Gehirn und Emotion: Vergleiche und Erfahrungen von Konkurrenzen von Mensch und Maschine seit dem 19. Jahrhundert 159
20.3 Konkurrenz, Bedrohung oder Entlastung? 161
20.4 Paradox: Menschlich-maschinelle Verwobenheit und menschliche (Selbst-) Wahrnehmungen 161
Literatur 162
21 Unterstützung und Assistenz durch die Maschine 163
21.1 Entstehung und Vielfältigkeit von Unterstützungstechnik 163
21.2 Theoriehistorische Kontexte für Unterstützung 164
21.3 Unterstützungssituationen: Unbestimmtheit und Materialisierung 166
21.4 Operative Infrastruktur von Unterstützung 168
21.5 Möglichkeiten eines begrifflichen und empirischen Fokus auf Unterstützung 169
Literatur 170
22 Emotionen in der Mensch-Maschine-Interaktion 171
22.1 Emotionen in der Mensch-Maschine-Interaktion 172
22.2 Ethik oder die Frage nach dem guten Leben 174
22.3 Ausblick auf weitere Forschung 176
Literatur 176
23 Lust- und Schmerzmaschinen 178
Literatur 182
24 Maschine und Genderdiskurs 183
24.1 Theorie der Tier-Maschine 183
24.2 Egalität der Geschlechter 184
24.3 Körper als sexuierte Maschinen 185
24.4 Technische und biologische Reproduktion: Woman, Machine, Cinema 186
24.5 Die Cyborg 187
24.6 Überwindung des technologischen Anthropomorphismus und Neuer Materialismus 188
Literatur 189
25 Cyborgisierungen 190
25.1 Die dreifache Geschichte des Cyborgs 190
25.2 Cybernetics und Cyborg 191
25.3 Mensch-Maschine-Interaktion 192
25.4 Human enhancement und Posthumanismus 193
25.5 Politik 193
25.6 Theoriebildung 194
Literatur 195
26 Interface. Die Natur der Schnittstelle 196
26.1 Der Krieg der Kürzel 196
26.2 Ecological Interface Design 198
26.3 HCI, ACI und HCBI 199
Literatur 201
27 Mensch-Maschine-Schnittstellen in den Bio- und Neurotechnologien 204
27.1 Neue Hybride der Mensch-Maschine-Interaktion 204
27.2 Normative Erwartungshaltungen in der Mensch-Maschine-Interaktion 205
27.3 Die Verschmelzung von Mensch und Maschine als neue Dimension neurotechnologischer Forschung 207
Literatur 210
28 Mensch-Maschine-Schnittstellen und ›verteilte Agency‹ am Beispiel motorischer Neuroprothesen 211
28.1 Die ›Standardtheorie‹ des Handelns in der klassischen Handlungstheorie 211
28.2 Funktionale und strukturelle Aspekte von Handlungskontrolle in der interdisziplinären Handlungstheorie 212
28.3 ›Agency‹ und ›Akteur‹ aus handlungstheoretischer Perspektive 214
28.4 Mensch-Maschine-Interaktion am Beispiel motorischer Neuroprothesen 214
28.5 Motorische Neuroprothesen und brain-computer interfacing 215
28.6 Shared control in neuroprothetischgestützter Agency 215
28.7 ›Verteilte Handlungsträgerschaft‹ als Herausforderung für den Akteursbegriff 216
Literatur 217
29 Der menschliche Organismus in den Mechanismen der Fortpflanzungsmedizin 219
29.1 Natur/Kunst – und jenseits davon 219
29.2 In-vitro- und In-vivo-Zeugung 220
29.3 Die Gameten als Agenten 221
29.4 Der Organismus als locus technicus 223
29.5 Produkt ›Embryo‹ 223
29.6 Fazit 224
Literatur 225
III Begriffe und Konzepte 226
30 Affective Computing 227
Literatur 229
31 Affordanz 230
31.1 Ursprung und Definition des Affordanzbegriffes 230
31.2 Weiterentwicklung und Kritik des Affordanzkonzeptes 230
31.3 Sozialwissenschaftliche Analysen der Mensch-Maschine-Interaktion 231
Literatur 231
32 Algorithmus 233
32.1 Erläuterung und Relevanz 233
32.2 Abgrenzung 234
32.3 Wichtige Autoren und Forschungsfragen 234
Literatur 235
33 Anthropotechnik/Ergonomie 236
33.1 Begriffsgeschichte 236
33.2 Das Konzept einer Mensch-Maschine-Anpassung 237
33.3 Anthropotechnik 237
Literatur 238
34 Automation/Automatisierung 239
Literatur 241
35 Autonomie 242
35.1 Menschliche Autonomie 242
35.2 Facetten menschlicher Autonomie 242
35.3 Facetten technischer Autonomie 243
35.4 Verhältnis von menschlicher und technischer Autonomie 243
Literatur 244
36 Bionik 245
Literatur 246
37 Computation 248
Literatur 250
38 Cyber-physisches System 251
Literatur 253
39 Cyborg 254
39.1 Der Cyborg als männlich-technizistische Überlegenheitsphantasie 254
39.2 Die Cyborg als feministisch-affektive Opposition 254
39.3 Realweltliche Manifestationen 255
Literatur 255
40 Design/Entwerfen 257
40.1 Entwurfsmethoden 257
40.2 Verruchte Entwurfsprobleme 258
40.3 Entwerfen als Erkenntnispraxis 258
40.4 Verantwortungsvolles Entwerfen 259
Literatur 259
41 Digital/analog 261
41.1 Erläuterung und Relevanz 261
41.2 Abgrenzung 262
41.3 Wichtige Autoren und Forschungsfragen 262
Literatur 263
42 Feedback 264
Literatur 265
43 Human Factors Engineering 267
43.1 Die Integration des Menschen in technische Großsysteme 267
43.2 Die Epistemologie der angewandten Forschung 268
43.3 Auswirkung und Kritik des Human Factors Engineering 268
Literatur 269
44 Individualisation/Interaktion 270
Literatur 272
45 Industrie 4.0 273
Literatur 275
46 Information 276
46.1 Mathematische Informationstheorie nach Claude E. Shannon 276
46.2 Entropie, Kybernetik und das Human Factors Engineering 277
46.3 Virulenz und Ästhetisierung der Information 277
Literatur 278
47 Kompilieren 279
Literatur 280
48 Kreativität 281
48.1 Unterschiedliche Konzepte von Kreativität 281
48.2 Kreativität und Maschine 281
48.3 Kreativität zwischen Technik und Kunst 282
Literatur 283
49 Kybernetik 284
Literatur 285
50 Maschinelles Lernen 287
Literatur 289
51 Neuroprothetik 290
Literatur 290
52 Operation/Operativität 291
52.1 Wortherkunft und Gebrauch 291
52.2 ›Operationen‹ in den Wissenschaften 291
52.3 Triumph des Operationalismus 292
52.4 Posthumanistische Operatoren 293
Literatur 294
53 Organprojektion 295
Literatur 297
54 Relation 298
Literatur 299
55 Roboter, humanoide 301
55.1 Roboter als Werkzeug in einer menschengerechten Umgebung 301
55.2 Roboter als Erkenntniswerkzeug 301
55.3 Voraussetzungen gelingender Mensch-Roboter-Interaktion 302
55.4 Soziale und ethische Bewertung des Einsatzes von humanoiden Robotern 302
Literatur 303
56 Soziotechnisches System 304
56.1 Geschichte und Systematik des Begriffs 304
56.2 Der Tavistock-Ansatz 305
56.3 Der Ansatz von Günter Ropohl 305
Literatur 306
57 Turing-Test 308
Literatur 309
IV Ethische Fragen: Normen, Herausforderungen, Perspektiven 311
58 Ethische Fragen bei autonomen Systemen 312
58.1 Technisches Handeln mit autonomen Systemen 312
58.2 Kooperation Mensch und autonomes System 313
58.3 Lernende autonome Systeme 314
58.4 Ethische Reflexion autonomer Systeme 316
Literatur 318
59 Ethische Fragen bei Brain-Computer Interfaces und anderen Neurotechnologien 319
59.1 Begriffsdefinitionen und Stand der Technik 319
59.2 Aktuell relevante technische und gesellschaftliche Entwicklungen 319
59.3 Aktuelle ethische Debatten mit Bezug zur Neurotechnologie 321
59.4 Lösungsansätze für ethische Herausforderungen 325
59.5 Offene Forschungsfragen und Ausblick 326
Literatur 326
60 Verlässlichkeit und Vertrauens-würdigkeit von Computersimulationen 328
60.1 Beurteilung und Umgang mit Computersimulationen 328
60.2 Verlässlichkeit, Vertrauenswürdigkeit und Opazität 331
Literatur 333
61 Sicherheitsfragen in der Mensch-Maschine-Interaktion 335
61.1 Zum Begriff der Sicherheit 335
61.2 Safety: Unfälle und Vulnerabilität mindern 336
61.3 Security: Schutz vor Angriffen 337
61.4 Certainty: Minderung von Kontingenz 338
Literatur 339
62 Technikfolgenabschätzung bei der Mensch-Maschine-Interaktion 341
62.1 Motivationen der Technikfolgenabschätzung 341
62.2 Technikfolgenabschätzung als Beratung 342
62.3 Technikfolgenabschätzung als Forschung 343
62.4 Mensch-Maschine-Interaktion als Thema der TA 344
62.5 Human enhancement 345
62.6 Autonome Roboter als Begleiter 345
62.7 Arbeiten in der Industrie 4.0 346
Literatur 347
63 Von den three laws of robotics zur Roboterethik 348
63.1 Roboter und Science-Fiction 348
63.2 Ethische Reflexion von Robotern als technische Mittel 349
63.3 Humanoide Roboter, Cyborgs, moralische Agenten 352
Literatur 353
64 Arbeitsfelder der Roboterethik 355
64.1 Einleitung 355
64.2 Die Arbeitsfelder der Roboterethik 356
64.3 Roboter als Handlungssubjekte 357
64.4 Roboter als Handlungsobjekte 358
64.5 Inklusive Ansätze in der Roboterethik 360
64.6 Fazit 362
Literatur 362
65 Die Maschinenethik als neues interdisziplinäres Forschungsfeld 364
65.1 Grundbegriffe der Maschinenethik 364
65.2 Selbstverständnis der Maschinenethik 365
65.3 Umsetzung maschineller Moral 366
65.4 Anwendungsgebiete der Maschinenethik 367
65.5 Zusammenfassung und Ausblick 369
Literatur 370
Anhang 371
Autorinnen und Autoren 372
Personenregister 375
Sachregister 379
| Erscheint lt. Verlag | 24.9.2019 |
|---|---|
| Zusatzinfo | IX, 380 S. 3 Abb., 2 Abb. in Farbe. |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Philosophie |
| Schlagworte | Benutzerschnittstelle • Ethik • Interaktion • Mensch-Computer-Interaktion • Mensch-Maschine-Interaktion • Philosophie |
| ISBN-10 | 3-476-05604-X / 347605604X |
| ISBN-13 | 978-3-476-05604-7 / 9783476056047 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 5,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich