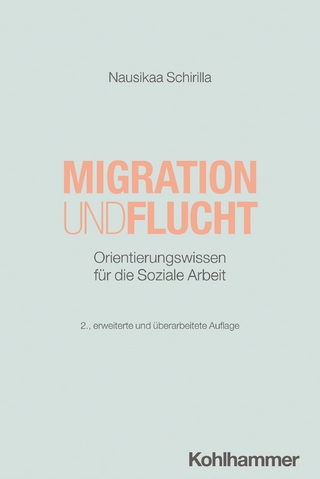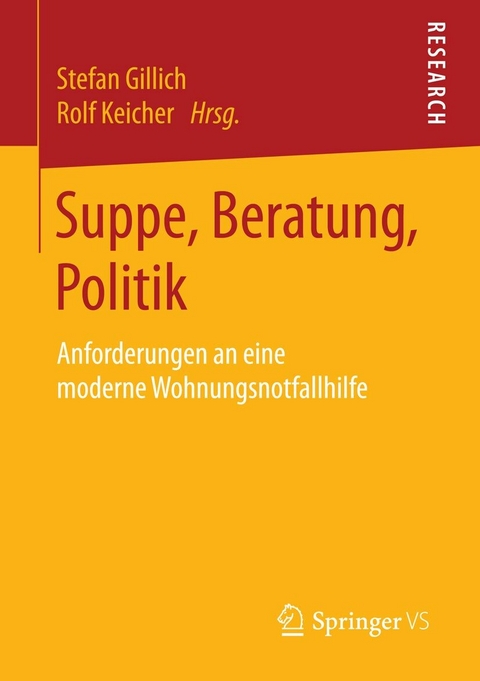
Suppe, Beratung, Politik (eBook)
297 Seiten
Springer VS (Verlag)
978-3-658-12272-0 (ISBN)
Die Herausgeber Stefan Gillich und Rolf Keicher greifen Fragen nach Bedingungen und Kooperationspartnern für eine gelingende Wohnungsnotfallhilfe auf. Die Beiträge reichen von Aspekten der Existenzsicherung und privater Wohltätigkeit (Suppe) über Unterstützung von spezifischen AdressatInnen (Beratung) und strukturellen Rahmenbedingungen sowie soziale Rechte und die Durchsetzung dieser Rechte (Politik). Beispiele für eine gelingende Zusammenarbeit sowie aktuelle Forschungsergebnisse werden ergänzend vorgestellt.
Stefan Gillich ist stellvertretender Vorsitzender des Evangelischen Bundesfachverbandes Existenzsicherung und Teilhabe e.V. (EBET) und Bereichsleiter für Existenzsicherung, Armutspolitik, Gemeinwesendiakonie bei der Diakonie Hessen - Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e.V., Frankfurt
Rolf Keicher arbeitet bei der Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundesverband als Referent für Hilfen in besonderen Lebenslagen und Wohnungspolitik, Berlin.
Inhaltsverzeichnis 5
Suppe, Beratung, Politik – Anforderungen an eine moderne Wohnungsnotfallhilfe. Eine Einführung 8
I Politik: strukturelle Rahmenbedingungen und Forschungsergebnisse 12
Rahmenbedingungen (guter) sozialer Arbeit am Beispiel Bremen 13
Was ist eigentlich eine Arbeitnehmerkammer? 14
Wodurch wird soziale Arbeit bestimmt? 15
Soziale Dienstleistung als Investition 18
Brüchiges Selbstverständnis der sozialen Arbeit 20
Atypische Beschäftigung als Folge des aktivierenden Sozialstaats 22
Soziale Arbeit wird durch einen prekären Arbeitsmarkt neu herausgefordert 24
Klamme Kommunen stoßen an ihre Grenzen 27
Schuldenbremse heißt: Über Einnahmen nachdenken! 29
Soziale Dienstleistungen brauchen ein gemeinsames Selbstverständnis 31
Literatur 32
Steuerpolitik in 60 Minuten 33
„Die Zukunft wird nicht gemeistert von denen, die am Vergangenen kleben.“ Wahrnehmungen zur Förderung langzeitarbeitsloser Menschen an der Jahreswende 2014/2015 50
Als Tigerin gesprungen… 52
…als Kätzchen gelandet? 55
… als Bettvorleger geendet? 57
Leitlinien einer solidarischen Wohnungspolitik 60
Forderungen an die Bundesebene 63
Forderungen an die Landesebene 71
Forderungen an die kommunale Ebene 76
Hausbesuche in der Wohnungslosenhilfe 81
Kontextinformationen zur Studie 81
Systematisierung von Hausbesuchen nach ihrer Zielsetzung 82
Ambivalenzen und Paradoxien 83
Hilfe und Kontrolle 83
Gastgeber/-innen und Hilfenehmer/-innen 84
Zugang zur Innenwelt und Schutzraum 84
Nähe und Distanz 85
Macht und Ohnmacht 85
Strategien ja, Konzeption nein?! 86
Schlussfolgerungen 87
Strukturierungsvorschlag für die Entwicklung von Hausbesuchskonzeptionen 87
Fazit 89
Literatur 89
Gravierend-komplexe Problemlagen bei jungen Wohnungslosen – aktuelle Forschungsergebnisse, strukturelle und fachliche Konsequenz 91
Ausgangslage 91
Ergebnisse der face-to face Befragungen 92
Soziodemographische Parameter 92
Bildungs-/Ausbildungsstatus 94
Störungsbilder und Hilfeerfahrungen/Behandlungen 94
Psychosoziale Belastungen 96
Ergebnisse der Experten-Interviews 102
Fazit 103
Konsequenzen 104
Literatur 105
Prävention von Wohnungslosigkeit in Nordrhein-Westfalen. Ergebnisse einer landesweiten Untersuchung 107
Zielsetzung und Durchführung des Untersuchungsvorhabens 107
Quantität, räumliche Verteilung und Entwicklung bedrohter Wohnverhältnisse 108
Sozialstrukturelle Merkmale von Haushalten in bedrohten Wohnverhältnissen 110
Anlässe/Gründe für bedrohte Wohnverhältnisse und Wiederholungsfälle 110
Zuständigkeiten und Organisation der Hilfen 111
Zugang zu den präventiven Hilfen: Informationssystem und Kontaktaufnahme 112
Maßnahmen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit und ihre Effekte 114
Zentrale Optimierungsund Handlungsbedarfe 115
Handlungsempfehlungen 116
Empfehlungen zur Stärkung und zum Ausbau präventiver Hilfestrukturen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit 116
Empfehlungen zur Organisation und Struktur präventiver Hilfen und zu Kooperationen der relevanten Akteure 117
Jobcenter 117
Einbeziehung freier Träger 118
Kooperation mit der Wohnungswirtschaft 118
Kooperation mit Sozialdiensten der Justizvollzugsanstalten 119
(Weiter-)Entwicklung von effektiven präventiven Hilfestrukturen in Kreisen 119
(Weiter-)Entwicklung der Hilfen für U25-Jährige 120
Empfehlungen zur Veränderung von rechtlichen Grundlagen und bei der Praxis der Rechtsanwendung 121
Empfehlungen zur Verbesserung der Wohnraumversorgung von Wohnungsnotfällen 122
Empfehlungen zur Dokumentation und statistischen Erfassung bedrohter Wohnverhältnisse 123
II Beratung: Methode und besondere Adressatengruppe 124
Junge Menschen in (Wohnungs-)Not 125
Marginalisierte und schwer erreichbare Jugendliche aus Sicht der Jugendsozialarbeit 125
Blicke in die Praxis 128
Lebenslagen von Mädchen 130
Care Leaver: Eine Initiative von Betroffenen 131
Erfahrungen und Problemlagen 132
Fachliche Anforderungen 133
Literatur 134
Betreutes Wohnen für wohnungslose alte Menschen in altersgerechtem Wohnraum als Form der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeitennach §§ 67 ff. SGB XII 135
Vorbemerkungen 135
Vorlauf des Projektes 136
Entstehung der Idee zum Projekt 137
Leistungsbeschreibung 138
Zur Frage der konkreten Angemessenheit der Kosten der Unterkunft im Seniorenwohnhaus: „Haus Harz“ 142
Besonderheiten bei der Bereitstellung von Wohnraum im Seniorenwohnhaus „Haus Harz“ im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach§§ 67 ff. SGB XI 147
Abgrenzung der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach §§ 67 ff. SGB XII von der Altenhilfe nach§ 71 SGB XII 148
Erfahrungsbericht 151
Literatur 155
Wohnungslosenhilfe im Wandel. Ambulantisierung der Angebote nach §§ 67/68 SGB XII am Beispiel Bremen 157
Das Hilfesystem im Überblick 158
Die Umstrukturierung 159
Die Betreuung im Intensiv Begleiteten Wohnen 161
Bisherige Erfahrungen 163
Arbeit, Qualifizierung und Beschäftigung für wohnungslose Menschen. Erfahrungsbericht eines ergänzenden Angebots der Berliner Wohnungslosenhilfeanhand des Modellprojekts GUT ZU TUN 165
Entstehungsgeschichte des Projekts 165
Aufgaben und Ziele 166
Arbeitsweise 166
Vermittlungen 167
Herausforderungen 169
Fazit 171
Handlungsempfehlung 172
Literatur 174
Housing First – zum Beispiel Berlin. Nicht so simpel, wie es sein sollte! 175
Ein Housing-First-Vorhaben für Berlin 176
Wie passt das ins System? 177
Für wen soll das geeignet sein? 178
Was funktioniert anders oder besser daran? 179
Fazit 181
Literatur 182
MigrantInnen in der „niedrigschwelligen“ Wohnungslosenhilfe: Handlungsmöglichkeiten in prekären Situationen 183
Ein Fallbeispiel 183
Wieso besteht das Problem? 184
Die Notwendigkeit einer Intervention durch die Soziale Arbeit 185
Handlungsbedarfe 186
Zwei beispielhafte Interventionsmodelle 187
Ein Ausblick 191
Literatur 194
Rückmeldungen aus Provinz und Metropolen: Obdächer sind noch nicht zerschlagen – Was ist zu tun? 195
Situationsanalyse in den ,Obdächern‘ 195
Handlungsvorschläge und Perspektiven 196
Fazit 198
Mit Kunst und Kultur gegen Armut und Ausgrenzung 200
III Suppe: Private Wohltätigkeit, Soziale Rechte und Rechtsdurchsetzung 207
Tafeln als moralische Unternehmen. Prinzipien und Profite der neuen Armutsökonomie 208
„Not-Groschen“, oder: Auf der Suche nach einer moralischen Ökonomie der Armut 208
Erzählformen des gesellschaftlichen Wandels am Beispiel der Tafeln 210
Prinzipien der neuen Armutsökonomie 218
Tafeln als Fallbeispiel armutsökonomischer Märkte 224
Fazit: Ausweitung der Gewinnzone 231
Literatur 231
Case Management in der Wohnungslosenhilfe – Segen oder Fluch? 235
Case Management in der Kommentierung zu §§ 67 ff. SGB XII 235
Das Verständnis von Case Management 236
Case Management als Mittel der Wahl in der Wohnungslosenhilfe? 236
Case Management als Antwort der Sozialverwaltung auf „Eigensinn“ 237
Die neue Dimension von „Hilfe und Kontrolle“ 238
Die Entwicklung sozialer Rechtsstaatlichkeit in der Wohnungslosenhilfe 239
Die Verdrängung rechtsstaatlicher Standards durch „wohlfahrtsstaatliches“ Case Management 240
Vom „Segen“ zum „Fluch“ 242
Grenzziehungen 242
Folgerungen für die Wohnungslosenhilfe 244
Anwaltschaft, Parteilichkeit, Lobbyarbeit: 18 Anmerkungen und eine Jesusgeschichte als Herausforderung für die Wohnungslosenhilf 245
1. Vom Sozialstaat zum Fürsorge-, Almosen- und Suppenküchenstaat 245
2. Soziale Arbeit ist immer politisch 245
3. Soziale Arbeit ist parteilich 246
4. Soziale Arbeit ist eine personenbezogene soziale Dienstleistung und eine Menschenrechtsprofession 246
5. Soziale Arbeit ist ein Reflex in der Gesellschaft und agiert nicht unabhängig davon 248
6. Lobbyarbeit ist die Vertretung der Interessen der Klientel und eigener Interessen 249
7. Anwaltschaftliche Sozialarbeit: Das eigene Hemd ist näher als die fremde Hose 250
8. Parteilichkeit heißt, von der Perspektive der Menschen aus Entscheidun-gen zu treffen, mit allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind 250
9. Parteilichkeit ist eine professionelle Haltung, die engagiert an den Problemen ist, welche die Menschen selbst haben und nicht an denProblemen, die die Gesellschaft mit ihnen hat 252
10. Mit dem Begriffswechsel von parteilicher Sozialarbeit zu anwaltschaftlicher Sozialarbeit haben sich weitreichende Veränderungenvollzogen: theoretisch, strategisch, sprachlich, politisch und als Haltung 253
11. Die gesellschaftliche Reaktion auf wahrgenommene Problemlagen und als Haltung hat Jahrhunderte alte Tradition. Das Grundverständnis warund ist die Individualisierung von Problemlagen 254
12. Im Zentrum der Bemühungen der Versorgung Armer und Arbeitsloser steht nicht ausschließlich deren materielle Absicherung sondern derArbeitsgedanke 256
13. Wohlfahrtsverbände verstehen sich als Anwälte der Benachteiligten. Schon diese Aufgabe findet auf mehreren Ebenen statt 256
14. Soziale Arbeit ist gekennzeichnet durch ihr doppeltes Mandat. Soziale Arbeit ist nie nur Hilfe, sondern immer auch eine Form von gesellschaftlicher Kontrolle 257
15. Die Balance des sozialrechtlichen Leistungsdreiecks verändert sich zu Lasten des Klienten 258
16. Die ignorierten Geschwister: Betroffenenbeteiligung, Selbsthilfe und Selbstorganisation 258
17. Grundlegende Rechtskenntnisse sind unverzichtbar 260
18. Der Umgang ist durch eine grundlegende Haltung geprägt die folgende Aspekte berücksichtigt 262
Literatur 262
Die neue Mitleidsökonomie zwischen Suppe, Beratung und Sozialpolitik 264
Zum Begriff der Neuen Mitleidsökonomie 265
Die Bestandsaufnahme 266
Ergebnisse der Befragung 267
Fazit 271
Literatur 274
Rechtsverwirklichung als Aufgabe der Sozialen Arbeit am Beispiel „Der Verbogene Paragraf“ 275
Warum braucht es einen Negativpreis? 279
Wie kommt es zu einer Preisvergabe? 280
Wie waren bisher die Reaktionen der Preisträger? 282
Was Sie schon immer zur Hilfe nach §§ 67ff. SGB XII wissen wollten! Häufig gestellte Fragen zum Rechtskreis der Hilfe nach dem 8. Kapitel SGB XII 284
Warum kann rechtliche Betreuung die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nicht ersetzen? 285
Welche Hilfeangebote der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gibt es? 286
Was sieht das Gesetz vor, wenn der Antrag auf Hilfe zur Überwindung be-sonderer sozialer Schwierigkeiten bei einem nicht zuständigen öffentlichenLeistungsträger gestellt wird? 288
Darf die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten befris-tet werden? Wie lange kann die Hilfe nach §§ 67 ff. SGB XII geleistet werden? 289
IV Anhang 291
Autorinnen und Autoren 295
| Erscheint lt. Verlag | 24.2.2016 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften |
| Sozialwissenschaften ► Pädagogik ► Sozialpädagogik | |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Sozialwissenschaften ► Soziologie | |
| ISBN-10 | 3-658-12272-2 / 3658122722 |
| ISBN-13 | 978-3-658-12272-0 / 9783658122720 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich