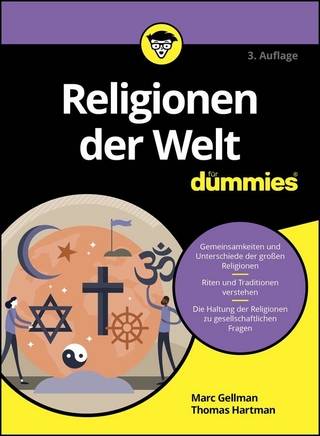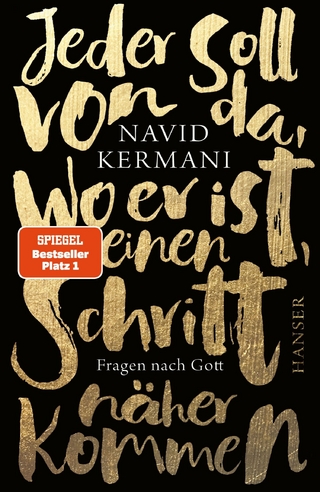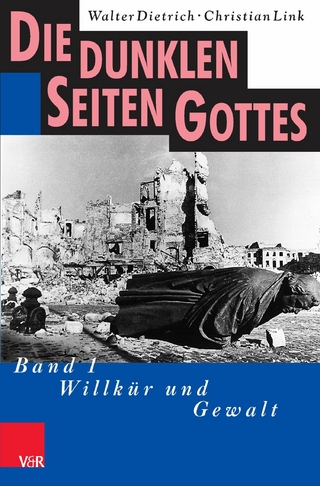Geist und Leben 3/2015 (eBook)
110 Seiten
Echter Verlag
978-3-429-06227-9 (ISBN)
Christoph Benke, geb. 1956, Dr. theol., Priester der Erzdiözese Wien, in der Studentenseelsorge tätig.
Christoph Benke, geb. 1956, Dr. theol., Priester der Erzdiözese Wien, in der Studentenseelsorge tätig.
N
Cornelius Roth | Fulda
geb. 1968, Priester, Professor für Liturgiewissenschaft und Spiritualität an der Theol. Fakultät Fulda
„Man muss drinnen und draußen stehen“
Christussehnsucht und Kirchenkritik bei Simone Weil
Eine Hinwendung der Kirche zu jenen, die am Rand stehen, an der Peripherie der Gesellschaft und der Kirche, hat Papst Franziskus seit seinem Amtsantritt häufig angemahnt. Er selbst überschreitet mit seinen Aussagen immer wieder die Grenzen der Kirche und geht auf Außenstehende zu. Zeit ihres Lebens verstand sich auch die französische Philosophin, Soziologin und Mystikerin Simone Weil (1909–1943)1 als jemand, der an der Schwelle der Kirche steht, „am Schnittpunkt des Christentums mit allem, was es nicht ist“, und zwar aus Liebe zu allem, was außerhalb von ihr liegt: „Immer bin ich genau an dieser Stelle geblieben, auf der Schwelle der Kirche, ohne mich zu rühren, unbeweglich, ἐν ὐπομονᾖ (ein wie viel schöneres Wort als patientia!); nur dass nunmehr mein Herz, wie ich hoffe für immer, in das Allerheiligste versetzt worden ist, das auf dem Altar ausgesetzt ist.“2
Es hat den Anschein, dass es bei ihr manchmal mehr ein Hin- und Herpendeln bzw. ein Überschreiten der Grenzen als das gläubige Ausharren an einer Schwelle ist. Denn in vielen Ausführungen zu ihrer Christusmystik überschreitet sie eindeutig die Schwelle zur Kirche hin und begibt sich in die Fußspuren großer Heiliger (v.a. Franz von Assisi und Johannes vom Kreuz). In anderen Gedanken wiederum steht sie offensichtlich ganz außerhalb der Kirche und des Christentums, betrachtet sie gleichsam von außen als Institution, die totalitäre Züge hat und nur de jure, aber nicht de facto katholisch ist, weil sie Menschen anderer Meinung verfolgt und v.a. keinen Sensus für die göttlichen Spuren außerhalb ihrer institutionellen Verfasstheit entwickelt hat. An Gustave Thibon kann sie deshalb schreiben: „Für den Augenblick wäre ich eher geneigt, für die Kirche zu sterben als in sie einzutreten – falls sie es nächstens nötig hätte, dass man für sie stirbt. Sterben, das verpflichtet zu nichts, wenn ich so sagen darf; es schließt keine Lüge ein.“3
Auch wenn man nicht der Versuchung erliegen sollte, bei Weil das oberflächliche Schema: „Gott/Christus ja – Christentum/Kirche nein“ anzuwenden, scheint sie in gewisser Weise immer wieder einen Keil zwischen Gott und Jesus Christus auf der einen und dem von der Macht korrumpierten Christentum und der Kirche auf der anderen Seite zu treiben. Sie liebt Christus über alles und begeht im Gedanken an das Kreuz, wie sie selber schreibt, die „Sünde des Neids“ (UG 69). Dem institutionalisierten Christentum hingegen steht sie skeptisch bis ablehnend gegenüber – es sei denn, man betrachtet die Kirche als Bewahrerin der Sakramente, in denen auch für Weil das göttliche Heil liegt.4 So wird sie mitunter sogar als Kirchenlehrerin und Heilige interpretiert, die das „Draußen (…) ins Herz der Kirche hereingeholt“ hat, v.a. wenn man annimmt, dass sie kurz vor dem Tod doch noch von ihrer Freundin Simone Deitz getauft wurde.
Im Folgenden soll zunächst die Gottesliebe bzw. Christussehnsucht Weils thematisiert werden, denn ihre eigenen mystischen Erfahrungen, die auch von liturgischen Erfahrungen geprägt waren, bilden den Hintergrund, vor dem dann in einem zweiten Teil die Kirchen- und Christentumskritik zur Sprache kommen kann. Hier zeigt sich bei ihr eine eigenartige Widersprüchlichkeit, die nicht ganz aufgelöst, aber doch für heutige Diskussionen fruchtbar gemacht werden kann.
Berührungen mit Christus
Obwohl Simone Weil bis zu ihren ersten Erfahrungen mit Christus nie irgendwelche Mystiker(innen) gelesen hatte, beschreibt sie ihre Gotteserfahrung in einer Sprache, die an die mystische Tradition der Kirche anknüpft.5 Näherhin sind es zunächst drei „Berührungen“ mit dem katholischen Glauben, drei im weitesten Sinn liturgische Erfahrungen, die sie besonders bewegt haben und von denen sie ihrem geistlichen Begleiter Pater Perrin in einem Brief berichtet.6 Die erste Erfahrung machte sie im Sommer 1935 in einem kleinen portugiesischen Dorf am Patronatsfest, an dem die Frauen der Fischer mit brennenden Kerzen in den Händen in einer Prozession um die Boote zogen und altüberlieferte Gesänge anstimmten, die Weil beinahe das Herz zerrissen. „Niemals habe ich etwas so Ergreifendes gehört, außer dem Gesang der Wolgaschlepper. Dort hatte ich plötzlich die Gewissheit, dass das Christentum vorzüglich die Religion der Sklaven ist“ (UG 49). Eine zweite Erfahrung erzählt sie, die ihr 1937 in Assisi in der kleinen Kapelle in Santa Maria degli Angeli widerfahren ist, wo „etwas, das stärker war als ich selbst, mich zum ersten Mal in meinem Leben auf die Knie zu werfen“ zwang. Schließlich ist als spezifisch liturgische Erfahrung der Aufenthalt in Solesmes in den Kar- und Ostertagen 1938 zu nennen. Trotz bohrender Kopfschmerzen empfand sie in dem Kloster die „unerhörte[ ] Schönheit der Gesänge und Worte“ als eine „reine und vollkommene Freude“. Die schmerzende Anstrengung der Aufmerksamkeit führte sie zudem tief in die Passion Christi hinein und ermöglichte ihr, „die göttliche Liebe durch das Unglück hindurch zu lieben“ (UG 49).
In Solesmes begegnete ihr auch ein junger Engländer, der sie auf ein Gedicht des englischen Dichters George Herbert aus dem 17. Jh. mit dem Titel Love aufmerksam machte. Im Zusammenhang mit diesem Text berichtet sie von einer mystischen Erfahrung im engeren Sinn: „Einmal, während ich es sprach, ist (…) Christus selbst herniedergestiegen und hat mich ergriffen“ (UG 50). Es war für Weil eine „wirkliche(n) Berührung, von Person zu Person, zwischen dem menschlichen Wesen und Gott (…) Im Übrigen waren an dieser meiner plötzlichen Übermächtigung durch Christus weder Sinne noch Einbildungskraft im geringsten beteiligt; ich empfand nur durch das Leiden hindurch die Gegenwart einer Liebe gleich jener, die man in dem Lächeln eines geliebten Antlitzes liest“ (UG 50f.). Später beschreibt Weil noch eine weitere tiefe spirituelle Erfahrung, und zwar im Zusammenhang mit dem von ihr so geliebten und regelmäßig auf Griechisch gebeteten Vater Unser: „Mitunter reißen schon die ersten Worte meinen Geist aus meinem Leibe und versetzen ihn an einen Ort außerhalb des Raumes, wo es weder eine Perspektive noch einen Blickpunkt gibt (…) Mitunter auch ist während dieses Sprechens oder zu anderen Augenblicken Christus in Person anwesend, jedoch mit einer unendlich viel wirklicheren, durchdringenderen, klareren und liebevolleren Gegenwart als jenes erste Mal, da er mich ergriffen hat“ (UG 54f).
Bei aller Sympathie Weils für die Spiritualität Indiens und Chinas und deren gegenstandslosen Meditationspraktiken wird hier deutlich, dass sie selbst durchaus durch „Vehikel“ aus dem christlichen Traditionsraum wie die Liturgie, ein abendländisches Gedicht oder eben das Vater Unser zu ihren mystischen Erfahrungen geführt wurde, an deren Authentizität kaum ein(e) Weil-Forscher(in) zweifelt. Berühmt ist besonders der Prolog genannte Text, der in die Zeit zwischen der ersten mystischen Erfahrung in Solesmes und der Reflexion der weiteren personalen Christusbegegnungen in der Folgezeit (u.a. in Marseille) liegen muss. Ihrer Mutter gegenüber soll Weil diesen Prolog mit der Bemerkung übergeben haben, sie wünsche, dass dieser Text als erster erscheine, sollte von ihr jemals etwas veröffentlicht werden. Das zeigt die Bedeutung, die Weil selbst dieser Erfahrung zumaß. Im Stil der Liebesdialoge, die an das Hohelied und die Schriften der mittelalterlichen Frauenmystik erinnern, berichtet sie darin über ihre intime Beziehung zu Gott bzw. Jesus Christus.7
Kennzeichnend für Simone Weil ist – neben der Christozentrik –, dass sie diese Erfahrungen mit ihrer eigenen spezifischen Situation und ihrem Denken als „ungetaufte Christin“ verbindet. Die Sehnsucht nach der (nur geistig empfangenen) Kommunion und ihre Liebe zum gesamten Universum treten aus solchen Texten deutlich hervor. Gleichzeitig geht sie über die rein äußere Beschreibung ihres Erlebnisses hinaus und schaut auf die Berührung Gottes mit der Welt. Hier kommt ihr zutiefst sakramentales Denken ins Spiel. Sakramente sind für Weil „Augenblicke der Ewigkeit“, das Band der Übereinkunft zwischen Gott und Mensch, wirkliche Berührungen Gottes mit der Welt, die sich besonders in der Schönheit zeigen. Ja, es gibt bei ihr so etwas wie eine „reale Gegenwart Gottes in allem, was schön ist.“ Sie nennt es „Sakrament der Bewunderung“.8 Auch die Freude, welche die Seele als Zustimmung zur Schönheit der Welt empfindet, kann für sie...
| Erscheint lt. Verlag | 1.7.2015 |
|---|---|
| Verlagsort | Würzburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Religion / Theologie |
| Schlagworte | Ignatianisch • jesuitisch • Kontemplation • Mystik • Orden • Spiritualität |
| ISBN-10 | 3-429-06227-6 / 3429062276 |
| ISBN-13 | 978-3-429-06227-9 / 9783429062279 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,1 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
Größe: 1,0 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich