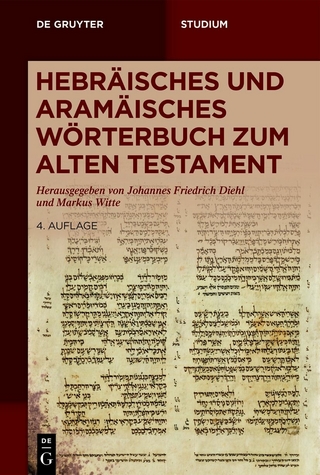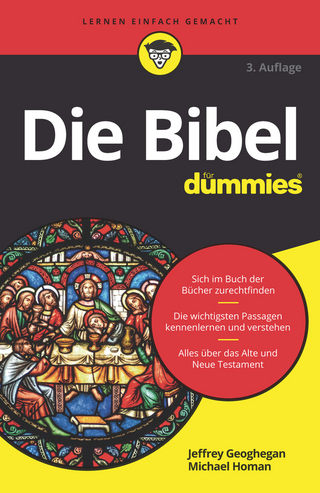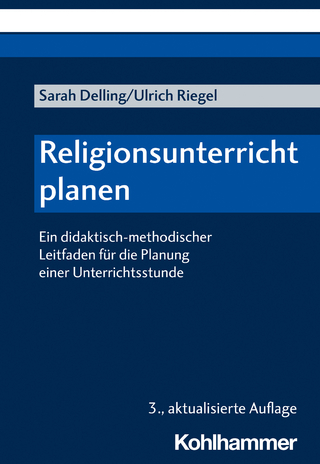Lebendige Seelsorge 3/2015 (eBook)
80 Seiten
Echter Verlag
978-3-429-04814-3 (ISBN)
Erich Garhammer, Dr. theol., geboren 1951; Professor für Pastoraltheologie an der Universität Würzburg; Mitherausgeber der Reihe 'Studien zur Theologie und Praxis der Seelsorge'.
Erich Garhammer, Dr. theol., geboren 1951; Professor für Pastoraltheologie an der Universität Würzburg; Mitherausgeber der Reihe "Studien zur Theologie und Praxis der Seelsorge".
Nicht ohne die Opfer!
Vergebung in eschatologischer Perspektive
Darf Gott Unrecht vergeben, das Menschen einander angetan haben – oder setzt seine Vergebung nicht voraus, dass zuerst die Menschen einander vergeben? Die so gestellte Frage hat weitreichende Konsequenzen für die christliche Hoffnung auf eine universale Versöhnung. Dirk Ansorge
In seinem letzten Roman „Die Brüder Karamasow“ schildert der russische Dichter Fjodor Michailowitsch Dostojewski (1821–1881) ein Gespräch zwischen Aljoscha Karamasow und seinem Bruder Iwan. Dieser habe kürzlich in der Zeitung gelesen, ein Großgrundbesitzer habe das Kind eines Leibeigenen durch seine Jagdhunde zu Tode hetzen lassen, nachdem das Kind einen seiner Hunde versehentlich mit einem Stein verletzt habe.
Wie ist angesichts dieses Verbrechens Vergebung möglich? Das Kind kann dem Großgrundbesitzer nicht verzeihen; denn es ist tot. Die Mutter aber, die mitansehen musste, wie ihr Kind von den Hunden zerfleischt wurde, sie darf dem Großgrundbesitzer nicht verzeihen, so Iwan. Nur das Leid, das ihr selbst zugefügt wurde, dürfte sie verzeihen, nicht aber das Leid ihres Kindes. Ja, mehr noch: „Sie darf es nicht wagen, dem Peiniger zu verzeihen, auch wenn das Kind selber ihm verziehe!“ (II. Teil, Kap. 4). Nicht einmal dann also! Iwans These bedeutete in letzter Konsequenz, die Möglichkeit von Vergebung und Versöhnung überhaupt zu verabschieden. Aus biblischer Perspektive erscheint dies freilich problematisch. Denn dass Gott Schuld vergeben kann und will, zählt zu den zentralen Aussagen des Alten wie des Neuen Testaments: „So wahr ich lebe – Spruch Gottes des Herrn – ich habe kein Gefallen am Tod des Ungerechten, sondern daran, dass ein Ungerechter sich abkehrt von seinem Weg und am Leben bleibt“ (Ez 33,11; vgl. Lk 15,7). Aber kann und darf Gott solches Unrecht vergeben, das nicht zunächst ihn selbst betrifft, sondern das Menschen einander angetan haben?
In seiner autobiographischen Erzählung „Die Sonnenblume“ schildert Simon Wiesenthal (1908–2005), der Gründer des Jüdischen Dokumentationszentrums in Wien, eine Begegnung mit einem sterbenden SS-Offizier in einem Lemberger Hospital. Als der Offizier ihm, dem jüdischen Gefangenen, seine Verbrechen an Jüdinnen und Juden gesteht und um Vergebung bittet, verweigert Wiesenthal sie ihm. Denn trotz seines aufkeimenden Mitgefühls für den Sterbenden sieht er sich außerstande, an Stelle der Ermordeten zu verzeihen.
Wenn schon nicht ein Mensch, sollte dann nicht Gott an Stelle der Ermordeten verzeihen können und dürfen? Aljoscha Karamasow weist seinen Bruder darauf hin: „Du hast eben gefragt: ‚Gibt es auf der ganzen Welt ein Wesen, das verzeihen könnte und dazu ein Recht hätte?‘ Ein solches Wesen gibt es, und es kann allen und alles verzeihen, weil es selbst sein unschuldiges Blut für alle und für alles hingegeben hat“ (ebd.).
Die Deutung des Kreuzestodes Jesu im Sinne eines stellvertretenden Sühnetodes zur Vergebung der Sünden begegnet bereits im Neuen Testament. Auf der Grundlage des Vierten Gottesknechtslieds (Jes 53) und im Ausgang von Mk 10,34 („Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele“) ist sie in der christlichen Theologie und Frömmigkeit tief eingewurzelt. Spätestens seit Anselm von Canterbury (gest. 1109) wurde die Lehre vom stellvertretenden Sühnetod Jesu zum beherrschenden Modell christlicher Soteriologie. Seit geraumer Zeit freilich wird auf die problematischen Aspekte dieser Lehre hingewiesen. Warum eigentlich sollte Gott die Sünden der Menschen nicht aus freier Barmherzigkeit verzeihen können? Petrus Abaelardus (gest. 1142) jedenfalls schien diese Alternative dem Evangelium Jesu angemessener zu sein als Anselms Theorie eines notwendigen Ausgleichs. Und was eigentlich ist mit „Sühne“ gemeint? Sollte Gott ihrer bedürfen, um die Menschen von ihrer Schuld zu erlösen? Inwiefern dient Sühne dem Heil der Menschen? Wie ist es zu denken, dass der Tod des einzig Sündelosen die Versöhnung der Sünder untereinander und mit Gott erwirkt? Die in diesem Zusammenhang vielfach gebrauchte Rede von einem „Überschuss der Gnade“ jedenfalls weckt die fatale Vorstellung von einer dinglich konzipierten Gnadenökonomie. Diese aber würde weder dem personalen Charakter von Schuld und Sünde noch ihrer Überwindung durch Vergebung und Versöhnung gerecht.
DIE UNVERTRETBARKEIT VON SCHULD UND VERGEBUNG
Die heute unhintergehbare Einsicht, dass Sünde und Schuld personalen Charakter besitzen, findet sich erstmals im Alten Testament. Gegenüber der überkommenen Vorstellung einer kollektiven Haftung für begangenes Unrecht betont der Prophet Ezechiel, dass die Menschen nur für ihre je eigenen Taten belangt werden: „Ein Sohn trägt nicht die Schuld des Vaters, und ein Vater trägt nicht die Schuld des Sohns. Die Gerechtigkeit des Gerechten kommt nur ihm selbst zugute, und die Ungerechtigkeit eines Ungerechten lastet nur auf ihm selbst“ (Ez 18,20; vgl. Dtn 24,16). Der Sache nach ist damit bereits ausgesagt, was Immanuel Kant in seiner Religionsschrift (1793/94) prägnant formuliert: „Schuld […] kann […] nicht von einem anderen getilgt werden; denn sie ist keine transmissible Verbindlichkeit, die etwa, wie eine Geldschuld (bei der es dem Gläubiger einerlei ist, ob der Schuldner selbst oder ein anderer für ihn bezahlt), auf einen anderen übertragen werden kann, sondern die allerpersönlichste, nämlich eine Sündenschuld, die nur der Strafbare, nicht der Unschuldige, er mag auch noch so großmütig sein, sie für jenen übernehmen zu wollen, tragen kann“ (B 94).
Kant folgert aus dem personalen Charakter von Schuld, dass stellvertretende Vergebung unmöglich ist. Hätte sich Simon Wiesenthal auf diese Position berufen, dann hätte ihn seine Weigerung, dem SS-Offizier im Augenblick des Todes zu vergeben, unberührt lassen können. Denn dann hätte der Offizier das sittlich Unmögliche von ihm verlangt; darauf aber kann niemand verpflichtet werden: „Ultra posse nemo obligatur“. Doch so einfach ist die Sache offenbar nicht. Wiesenthal jedenfalls ließ die seinerzeit getroffene Entscheidung nicht zur Ruhe kommen; er hat sie öffentlich zur Diskussion gestellt. In vielen Stellungnahmen deutet sich die Möglichkeit an, dass es – über Kant hinaus – doch so etwas wie stellvertretende Vergebung gibt. Wie aber wäre diese zu denken?
Der Bonner Dogmatiker Karl-Heinz Menke (geb. 1950) hat in seiner Habilitationsschrift zum Begriff der „Stellvertretung“ die Konsequenzen erörtert, die sich aus Kants These für die christliche Soteriologie ergeben. Menke gelangt zu einem Begriff von Stellvertretung, der diese nicht als Ersatz für eine Person, sondern als deren Befähigung zum verantwortlichen Handeln verstanden wissen will. In diesem Sinne befähigt der Gekreuzigte und Auferstandene Menschen dazu, in seiner Nachfolge für Gottes wirksame Gegenwart in der Geschichte einzustehen.
Der theologische Stachel, den Dostojewski und Wiesenthal der christlichen Soteriologie ins Fleisch gesetzt haben, reicht aber noch tiefer. Bestritten wird ja nicht nur die Möglichkeit stellvertretender Vergebung; bestritten wird vielmehr die moralische Legitimität von Vergebung überhaupt. Die unglückliche Mutter „darf es nicht wagen, dem Peiniger zu verzeihen, auch wenn das Kind selbst ihm verziehe“! Damit aber ist die biblische Grundüberzeugung in Frage gestellt, dass Gott imstande und auch gewillt ist, Sünde und Schuld zu vergeben. „Ich, ich bin es, der deine Vergehen tilgt, um meinetwillen, und an deine Sünden werde ich nicht mehr denken“, heißt es bei Jesaja (43,25). Und nach Jeremia kündigt Gott an: „Ich werde ihre Schuld verzeihen, und an ihre Sünden werde ich nicht mehr denken“ (Jer 31,34). In biblischer Perspektive also hat Iwans trotziges Beharren auf der Unversöhntheit menschlicher Schuldgeschichte keine Grundlage.
SCHULD IN BEZUG AUF MENSCHEN UND AUF GOTT
Indes hat bereits die frühe rabbinische Tradition mit Blick auf Gottes Vergebungsmacht zwischen jenem Unrecht unterschieden, das Menschen in Bezug auf Gott begehen, und jenem Unrecht, das Menschen einander antun. Beides ist freilich nicht zu trennen. Denn insofern Gott die Welt im Ganzen zum Guten bestimmt hat, ist jede schuldige Tat gegenüber anderen Menschen zugleich auch Schuld vor Gott: „Das, was eigentlich die menschliche Schuld zur Sünde macht, ist, dass der Schuldige das Bewusstsein hat, vor Gott da zu sein“, so der dänische Philosoph Søren Kierkegaard (1813–1855). Dass Verfehlungen gegenüber den Mitmenschen immer zugleich auch Verfehlungen gegenüber Gott sind, wird exemplarisch in der matthäischen Weltgerichtsparabel (Mt 25,31–46) deutlich. Demnach gibt es keine Schuld, die nicht zugleich auch Sünde ist.
Gleichwohl betrifft jedes Vergehen die Mitmenschen...
| Erscheint lt. Verlag | 1.6.2015 |
|---|---|
| Mitarbeit |
Anpassung von: Bernhard Spielberg |
| Verlagsort | Würzburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Religion / Theologie ► Christentum |
| Schlagworte | Pastoral • Seelsorge • Vergebung |
| ISBN-10 | 3-429-04814-1 / 3429048141 |
| ISBN-13 | 978-3-429-04814-3 / 9783429048143 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich