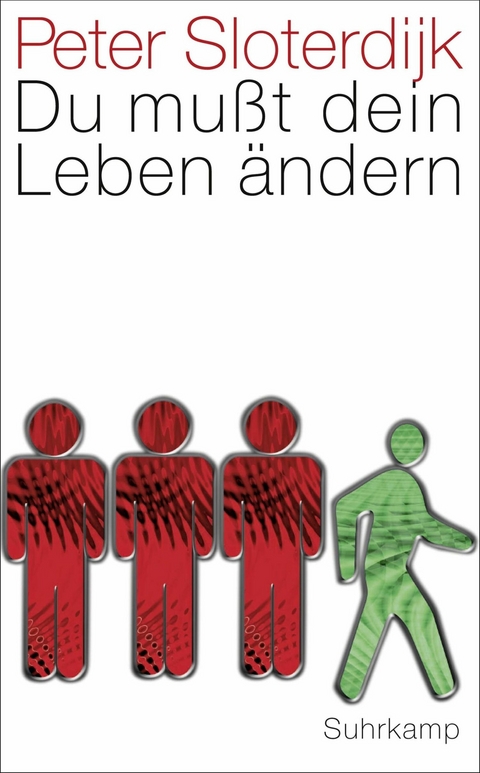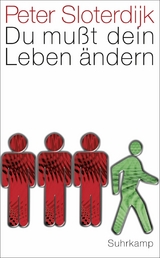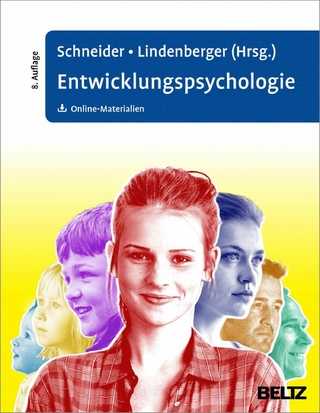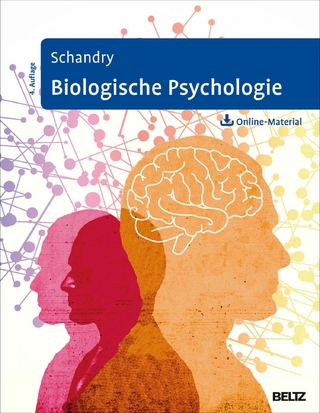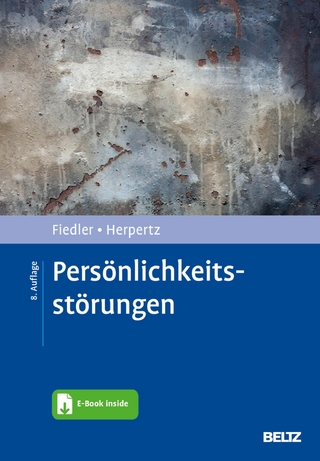Du mußt dein Leben ändern (eBook)
723 Seiten
Suhrkamp (Verlag)
978-3-518-74030-9 (ISBN)
<p>Peter Sloterdijk wurde am 26. Juni 1947 als Sohn einer Deutschen und eines Niederländers geboren. Von 1968 bis 1974 studierte er in München und an der Universität Hamburg Philosophie, Geschichte und Germanistik. 1971 erstellte Sloterdijk seine Magisterarbeit mit dem Titel <em>Strukturalismus als poetische Hermeneutik</em>. In den Jahren 1972/73 folgten ein Essay über Michel Foucaults strukturale Theorie der Geschichte sowie eine Studie mit dem Titel <em>Die Ökonomie der Sprachspiele. Zur Kritik der linguistischen Gegenstandskonstitution</em>. Im Jahre 1976 wurde Peter Sloterdijk von Professor Klaus Briegleb zum Thema<em> Literatur und Organisation von Lebenserfahrung. Gattungstheorie und Gattungsgeschichte der Autobiographie der Weimarer Republik 1918-1933</em> promoviert. Zwischen 1978 und 1980 hielt sich Sloterdijk im Ashram von Bhagwan Shree Rajneesh (später Osho) im indischen Pune auf. Seit den 1980er Jahren arbeitet Sloterdijk als freier Schriftsteller. Das 1983 im Suhrkamp Verlag publizierte Buch <em>Kritik der zynischen Vernunft</em> zählt zu den meistverkauften philosophischen Büchern des 20. Jahrhunderts. 1987 legte er seinen ersten Roman <em>Der Zauberbaum</em> vor. Sloterdijk ist emeritierter Professor für Philosophie und Ästhetik der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und war in Nachfolge von Heinrich Klotz von 2001 bis 2015 deren Rektor.</p>
1 DER BEFEHL AUS DEM STEIN
RILKES ERFAHRUNG
Ich stelle zunächst ein ästhetisches Exempel vor, um das Phänomen der Vertikalspannungen und ihre Bedeutung für die Reorientierung der konfusen Existenz moderner Menschen zu erläutern: Rainer Maria Rilkes bekanntes Sonett Archaïscher Torso Apollos, das den Zyklus Der Neuen Gedichte Anderer Teil aus dem Jahr 1908 eröffnet. Der Ansatz bei einem dichterischen Text scheint günstig – abgesehen davon, daß ich aus ihm den Titel dieses Buchs entliehen habe –, weil ein solcher wegen seiner Zugehörigkeit zum künstlerischen Feld weniger gefährdet ist, jene anti-autoritären Reflexe zu provozieren, die sich heute bei Berührungen mit dogmatisch Gesagtem oder aus der Höhe Gesprochenem nahezu zwanghaft einstellen – »was heißt schon Höhe!« Am ästhetischen Gebilde, und nur an ihm, haben wir gelernt, uns einer nicht-versklavenden Form von Autorität, einer nicht-repressiven Erfahrung von Rangdifferenz auszusetzen. Das Kunstwerk darf sogar uns, den der Form Entlaufenen, noch etwas »sagen«, weil es ganz offensichtlich nicht die Absicht verkörpert, uns zu beengen. »La poésie ne s'impose plus, elle s'expose.«18 Was sich selbst ausgesetzt und in der Prüfung bewährt hat, gewinnt unangemaßte Autorität. Im ästhetischen Simulationsraum, der zugleich der Ernstfallraum für Gelingen und Mißlingen des künstlerischen Gebildes ist, kann die machtlose Superiorität der Werke auf Beobachter einwirken, die ansonsten empfindlich darauf achten, keinen Herrn über sich zu haben, keinen alten und keinen neuen.
Rilkes Torso-Gedicht ist auf besondere Weise geeignet, die Frage nach der Quelle der Autorität zu stellen, weil es von sich her ein Experiment über das Sich-etwas-sagen-Lassen darstellt. Wie man weiß, hatte Rilke unter dem Einfluß Auguste Rodins, dem er zwischen 1905 und 1906 als Privatsekretär in Meudon zur Hand gegangen war, sich von der jugendstilhaften, sensibilistisch-atmosphärischen Dichtungsweise seiner Anfangsjahre abgewandt, um eine stärker vom »Vorrang des Objekts« bestimmte Kunstauffassung zu verfolgen. Das proto-moderne Pathos, dem Gegenstand den Vortritt zu lassen, ohne ihn in der Façon der alten Meister »naturgetreu« abzubilden, führte bei Rilke zum Konzept des Ding-Gedichts – und hierdurch zu einer vorübergehend überzeugenden neuen Antwort auf die Frage nach der Quelle ästhetischer und ethischer Autorität. Von nun an sollen es die Dinge selbst sein, von denen alle Autorität ausgeht – oder besser: von diesem jeweils aktuellen singulären Ding, das sich an mich wendet, indem es ganz den Blick beansprucht. Dies ist nur möglich, weil Ding-Sein jetzt von sich her nichts anderes bedeuten soll als: etwas zu sagen haben.
Rilke führt auf seinem Gebiet und mit seinen Mitteln eine Operation aus, die man philosophisch als die »botschaftliche Transformation des Seins« (vulgo linguistic turn) umschreiben könnte. »Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache«, wird Heidegger sagen – was umgekehrt die These impliziert: Sprache, die vom »Sein« verlassen ist, gerät zum Geschwätz. Dann und nur dann, wenn das Sein sich in privilegierten Dingen zusammenzieht und auf dem Umweg über diese Dinge sich an uns wendet, besteht Grund zu der Hoffnung, der anschwellenden Beliebigkeit zu entgehen, ästhetisch wie philosophisch. Angesichts der galloppierenden Inflation des Geschwätzes mußte eine solche Hoffnung zahlreiche Künstler und »Geistige« um 1900 in ihren Bann ziehen. Inmitten der allgegenwärtigen Geschäfte mit den prostituierten Zeichen konnte das Ding-Gedicht eine Aussicht auf die Möglichkeit einer Rückkehr zu glaubwürdigen Sinnerfahrungen eröffnen. Es vermochte dies, indem es die Sprache an den Goldstandard des von den Dingen selbst Mitgeteilten band. Wo Beliebigkeit ausgeschaltet wird, soll Autorität aufleuchten.
Es liegt auf der Hand, daß nicht jedes beliebige Etwas in den Rang eines Dings befördert werden kann – ansonsten wäre erneut alles und jedes sprechend, ja, das Geschwätz würde sich von den Menschen auf die Sachen ausdehnen. Rilke privilegiert zwei Kategorien von »Seienden«, um es in der pergamentenen Diktion der Philosophie zu sagen, die für die hohe Aufgabe, botschaftliche Dinge zu sein, in Frage kommen – die Artifizien und die Lebewesen –, wobei die letzteren von den ersten her ihre besondere Note erhalten, als wären die Tiere die höchsten Kunstwerke des vormenschlichen Seins. Beiden ist eine botschaftliche Energie inhärent, die sich nicht von selber aktiviert, sondern des Dichters als Decoders und Überbringers bedarf. Hierin hat die Komplizenschaft zwischen dem sprechenden Ding und der Rilkeschen Dichtung ihren Grund – so wie nur wenig später die Heideggerschen Dinge mit der »Sage« einer besinnlichen Philosophie konspirieren, die keine bloße Schuldisziplin mehr sein will.
Mit diesen etwas akzelerierten Hinweisen ist ein Rahmen umrissen, innerhalb dessen wir eine kurze Lektüre des Torso-Gedichts versuchen können. Ich gehe davon aus, daß der Torso, von dem im Sonnett die Rede ist, ein »Ding« im eminenten Sinn des Worts verkörpern soll, und zwar gerade deswegen, weil er bloß den Rest einer vollständigen Skulptur darstellt. Aus Rilkes Biographie wissen wir: Er brachte von seinem Aufenthalt bei den Werkstätten Rodins die Erfahrung mit, auf welche Weise die moderne Plastik zur Gattung des autonomen Torsos vorgestoßen war.19 Die Sicht des Dichters auf den verstümmelten Körper hat darum nichts mit der Fragment- und Ruinenromantik des vorangehenden Jahrhunderts zu tun; sie gehört in den Durchbruch der modernen Kunst zum Konzept des sich mit Autorität selbst aussagenden Objekts und des sich mit Vollmacht selbst veröffentlichenden Körpers.
ARCHAÏSCHER TORSO APOLLOS
Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt
darin die Augenäpfel reiften. Aber
sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber,
in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt,
sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug
der Brust dich blenden, und im leisen Drehen
der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen
zu jener Mitte, die die Zeugung trug.
Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz
unter der Schultern durchsichtigem Sturz
und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle;
und bräche nicht aus allen seinen Rändern
aus wie ein Stern: denn da ist keine Stelle,
die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.
Wer von dem Gedicht bei erster Lesung schon Bestimmteres aufnimmt, versteht soviel: Hier wird von einer Vollkommenheit gehandelt – einer Vollkommenheit, die um so verbindlicher und mysteriöser zu sein scheint, als es bei ihr um die Perfektion eines Bruchstücks geht. Man darf unterstellen, Rilke bedanke sich mit diesem Werk bei Rodin, dem Lehrmeister seiner Pariser Zeit, für das Konzept des für sich stehenden Torsos, dem er bei ihm begegnet war. Das Vollkommene, das in den vierzehn Zeilen beschworen wird, findet seinen Daseinsgrund in dem Umstand, daß es – unabhängig von der Verstümmelung des materiellen Trägers – die Vollmacht besitzt, eine aus sich selbst appellierende Botschaft zu bilden. Diese Appellkraft liegt bei dem hier vergegenwärtigten Gegenstand in exquisiter Weise vor. Vollkommen ist, was einen ganzen Satz des Seins artikuliert. Nicht mehr und nicht weniger hat das Gedicht zu leisten, als den Satz des Seins im Ding zu vernehmen und ihn dem eigenen Dasein anzugleichen – mit dem Ziel, selber ein Gebilde von ebenbürtiger Botschaftsmächtigkeit zu werden.
Der Rilkesche Torso kann als Träger des Prädikats »vollkommen« erfahren werden, weil er etwas mitbringt, was es ihm erlaubt, die gewöhnliche Erwartung einer Gestaltganzheit zu brüskieren. In dieser Geste hat die Wende der Moderne gegen das Prinzip Naturnachahmung – im Sinn von Nachahmung von vorgegebenen Gestalterwartungen – eines ihrer Motive. Sie vermag botschaftliche Ganzheiten und autonome Dingsignale auch dann wahrzunehmen, wenn keine morphologisch integren Figuren mehr vorliegen – ja gerade dann. Der Sinn für Vollkommenheit zieht sich aus den Naturformen zurück – wohl deswegen, weil die Natur selbst dabei ist, ihre ontologische Autorität zu verlieren. Auch durch die Popularisierung der Photographie werden die Standardanblicke der Dinge zunehmend abgewertet. Als erste Auflage des Sichtbaren gerät die Natur in Mißkredit. Sie vermag sich als Absenderin von verbindlichen Botschaften nicht mehr zu behaupten – aus Gründen, die letztlich auf ihre Entzauberung durch wissenschaftliche Erforschung und technische Überbietung zurückgehen. Nach dieser Verschiebung nimmt »vollkommen sein« eine veränderte Bedeutung an: Es heißt, etwas zu sagen haben, was bedeutsamer ist als das Gerede der geläufigen Ganzheiten. Nun kommen die Torsi und ihresgleichen zum Zug, es schlägt die Stunde der Formen, die an nichts erinnern. Die Bruchstücke, die Krüppel, die Hybride bringen etwas zur Aussprache, was die gewöhnlichen Ganzformen und die glücklichen Integritäten nicht mehr zu übermitteln imstande sind. Intensität schlägt Standardperfektion. Hundert Jahre nach Rilkes Wink verstehen wir diesen Hinweis wohl noch besser als dessen eigene Zeitgenossen, da unser Wahrnehmungsvermögen wie das keiner Generation vor uns von dem Geschwätz der makellosen Körper betäubt und ausgeplündert wird.
Mit diesen Hinweisen dürfte deutlich geworden sein, wie das Phänomen des Von-oben-angesprochen-Werdens sich in einem ästhetischen Gebilde verkörpert. Zum Verständnis eines Appell-Erlebnisses solcher Art ist es...
| Erscheint lt. Verlag | 16.11.2010 |
|---|---|
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften |
| Schlagworte | Aktivität • Anthropozentrismus • Entwicklung • Menschheit • Religionskritik • Spiritualität • ST 4210 • ST4210 • suhrkamp taschenbuch 4210 |
| ISBN-10 | 3-518-74030-X / 351874030X |
| ISBN-13 | 978-3-518-74030-9 / 9783518740309 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich