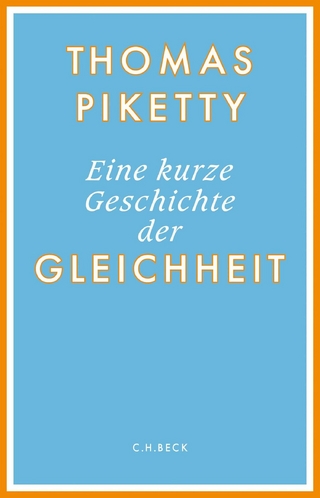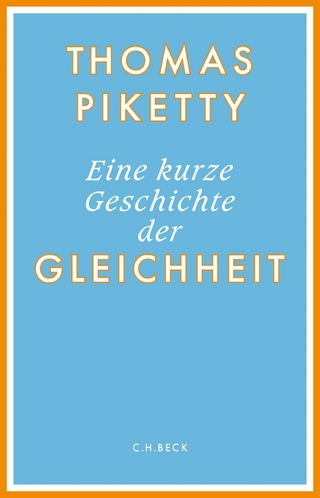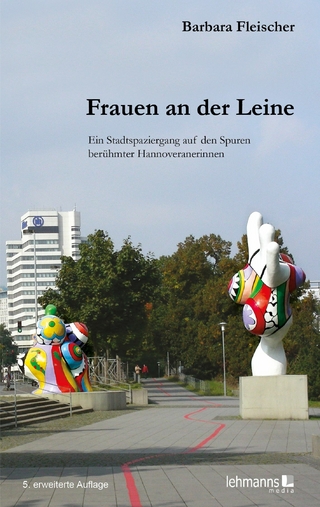wbg Weltgeschichte Bd. IV (eBook)
VII, 511 Seiten
wbg Academic in der Verlag Herder GmbH
978-3-534-74041-3 (ISBN)
Die Herausgeber: Johannes Fried, geb. 1942, ist Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Walter Demel, geb. 1953, ist Professor für die Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität der Bundeswehr in München. Ernst-Dieter Hehl, geb. 1944, seit 1998 apl. Professor, ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Albrecht Jockenhövel, geb. 1943, war bis zu seiner Emeritierung 2008 Professor für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Gustav Adolf Lehmann, geb. 1942, ist Professor für Alte Geschichte und Direktor des Althistorischen Seminars der Georg-August-Universität Göttingen. Helwig Schmidt-Glintzer, geb. 1948, ist Sinologe und seit 1993 Direktor der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel.
Ernst-Dieter Hehl, geb. 1944, seit 1998 apl. Professor, ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Albrecht Jockenhövel, geb. 1943, war bis zu seiner Emeritierung 2008 Professor für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Helwig Schmidt-Glintzer, geb. 1948, ist Sinologe und seit 1993 Direktor der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Walter Demel, geb. 1953, ist Professor für die Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität der Bundeswehr in München. Gustav Adolf Lehmann, geb. 1942, ist Professor für Alte Geschichte und Direktor des Althistorischen Seminars der Georg-August-Universität Göttingen. Johannes Fried, geb. 1942, ist Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Hans-Ulrich Thamer ist Senior Professor für Neuere und Neueste Geschichte im Exzellenzcluster Religion und Politik der WWU Münster. Forschungsschwerpunkte sind u.a. Nationalsozialismus und europäischer Faschismus; Ideen- und Sozialgeschichte im Zeitalter der Französischen Revolution; Historische Jugendforschung; Kulturgeschichte von Sammlungen und Museen.
»Thematisch klug organisiert.« Historische Zeitschrift
»Die Beiträge, verfasst von ausgewiesenen Fachleuten, vermitteln solides Sachwissen, verständlich dargeboten und klar strukturiert. Das ist angesichts der enormen Fülle des Stoffs, die Herausgeber und Autoren zu bändigen hatten, schon eine ansehnliche Leistung. Mit ihrem vor profunder Sachkenntnis strotzenden Opus haben die Autoren einen wichtigen Schritt hin zur endgültigen Überwindung eigentlich längst veralteter europazentrierter Perspektiven getan.« Damals
»Im Gegensatz zu älteren globalgeschichtlichen Unternehmen, wie der Historia Mundi und der noch heute sehr geschätzten Propyläen-Weltgeschichte, beansprucht diese Weltgeschichte, wirklich umfassend zu sein. Wie im ersten Band ist das den Verfassern auch im dritten und vierten Band gelungen. Dabei kommen zugleich die an die unterschiedlichen Zeiten gebundenen unterschiedlichen Bedeutungen des Begriffes global zur Geltung. Besonders im dritten Band kommen die überregionalen Entwicklungen in Weltbild, Religion, Handel, Kunst und Herrschaftsformen durch interessante Vergleiche und Bezüge zur Geltung.« Preußische Mitteilungen
Diese Weltgeschichte »öffnet die Perspektive auf bisher kaum behandelte Themen, wie Technik, Erziehung, Sozialisation und Professionalisierung. Und er bietet eine sehr solide Darstellung der demographischen, technischen, kulturellen, religiösen und sozialen Verschiebungen und Austauschprozesse in einer klaren und ausdrucksvollen Sprache. Insofern ist das Ziel einer globalen Weltgeschichte erreicht worden.« sehepunkte.de
»Sowohl ein universitärer Leserkreis als auch ein breiteres Publikum finden hier wichtige lesenswerte Darstellungen zu großen welthistorischen Themen des 19. und 20. Jahrhunderts« Historische Zeitschrift
Einleitung
Walter Demel
Entdeckungen
Entdeckungen charakterisieren den in diesem Band behandelten, freilich von „fließenden“ Grenzen umrahmten Zeitraum in einem besonderen Maße. Dem deutschen Wort – wie vielen seiner Entsprechungen in anderen europäischen Sprachen – liegt die Vorstellung zugrunde, dass eine Sache zunächst nicht sichtbar, weil „bedeckt“, gewesen sei und dann durch den Vorgang der „Entdeckung“ mit einem Mal erkennbar vor Augen liege. Eine solche Erkenntnis, so die Idee, gehe normalerweise nicht mehr verloren.
Tatsächlich wissen die weitaus meisten Menschen der heutigen Welt, dass es einen Kontinent Amerika gibt, und auch wenn Kolumbus glaubte, in Ostasien gelandet zu sein, bildeten seine Fahrten doch die für diese Erkenntnis wesentliche Grundlage. Zwar waren auch die Wikinger, schon um das Jahr 1000, zum Beispiel auf Neufundland gelandet. Das blieb jedoch vergleichsweise folgenlos. Das Entscheidende ist also nicht, dass irgendein Seefahrer auf ein „neues“ Land stößt, sondern dass dieses Ereignis zumindest mittelfristig das Leben vieler Menschen verändert: durch die Wandlung ihres „Weltbildes“, aber noch mehr durch den Transfer von Krankheiten, Naturprodukten oder Kulturgütern aller Art. Gerade das 15./16. Jahrhundert führte, nach vorherigen Rückschlägen, zu einer Verdichtung und dauerhaften Verstetigung der Kontakte zwischen weit entfernten Weltgegenden und Kulturen. Das ermöglichte eine Ausweitung der gegenseitigen Kenntnisse, die nun über das hinausgingen, was frühere Reisende wie Ibn Battuta oder Marco Polo vermittelt hatten.
Neue Ordnungen
Außer durch die Ausweitung geographischer Kenntnisse und den interkulturellen Austausch veränderte sich das „Weltbild“ durch neue wissenschaftliche Entdeckungen und Entwicklungen. Erfolgte eine grundlegende Neuordnung des Wissens im Westen erst im Zuge einer späteren „Wissensrevolution“ (s. Band V), so entstanden doch schon in der hier betrachteten Epoche im politisch-gesellschaftlichen Bereich in vielen Weltgegenden neue Ordnungen und Strukturen. In Europa bildete sich ein Ständewesen aus, und an die Stelle des Universalismus von Kaisertum und Papsttum trat mehr und mehr ein System souveräner Staaten. Miteinander konkurrierend, begann ein Teil von ihnen Kolonien in aller Welt zu gründen und vernichtete dabei indigene Kulturen, vornehmlich in Amerika. Dagegen schottete eine zentrale Herrschaft Japan ab 1640 weitgehend von der Außenwelt ab, nachdem sie zuvor die inneren Kämpfe der kriegerischen Samurai beendet hatte. Im Reich der Mitte blieben nach der Mongolenherrschaft konfuzianische Literatenbeamte die staatstragende Elite. Aber an die Spitze der Gesellschaft traten ab 1644 ein Kaiserhaus und ein Adel mandschurischer Herkunft. In ähnlicher Weise herrschten seit 1206 diverse muslimische Dynastien und Eliten zentralasiatischer beziehungsweise persischer Herkunft und kultureller Prägung über große Teile Indiens sowie eine mehrheitlich hinduistische Bevölkerung – eine für das Mogulreich im 18. Jahrhundert zunehmend instabile Konstellation. In weiten Gebieten der nördlichen Hemisphäre förderte eine unter anderem klimabedingte Krise im 17. und frühen 18. Jahrhundert – zumindest vorübergehend – eine gewisse soziale Dynamik und stürzte weitere Reiche in wachsende Schwierigkeiten, die im Falle der Safawiden und der spanischen Habsburger ebenfalls zu einer Aufteilung ihrer Imperien führten. Erhalten blieben dagegen politische Gebilde, in denen die weltliche Herrschaft durch wiederbelebte oder neue Legitimationsformen schließlich erneut gefestigt werden konnte.
Bevölkerung und Landbau
Demographie, Technik und Wirtschaft, die Gesamtheit der Menschen in ihrer ungleichmäßigen Verteilung über die Welt und die Erfüllung ihrer Lebensbedürfnisse durch Landwirtschaft, Gewerbe und Handel, bilden den ersten Themenkreis der folgenden Betrachtungen. Zunächst werden Bevölkerung und Landbau ins Auge gefasst. Der globale Bevölkerungsanstieg zwischen 1200 und 1800 wie auch die unterschiedliche Dichte der Weltbevölkerung, welche sich in China, Indien und der Westhälfte Europas konzentrierte, resultierten nämlich wesentlich aus einer Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion in diesen Weltregionen, welche sich der Erschließung von Neuland, der Intensivierung der Bodennutzung und der Einführung neuer Nutzpflanzen verdankte.
Technischer Wandel
Im landwirtschaftlichen wie im gewerblichen Bereich spielte der technische Wandel eine wichtige Rolle. Ausgehend vom einem weitgefassten Technikbegriff werden die Bedeutung des Techniktransfers und die Unterschiedlichkeit der Nutzung neuer Erfindungen etwa am Beispiel des Buchdrucks aufgezeigt – ein Medium, durch das Wissen, Ideen, aber auch politische und religiöse Propaganda viel schneller als früher verbreitet werden konnten. Ferner werden die Entwicklungen in den Bereichen Architektur (inklusive Brücken- und Festungsbau), Kanalbau (zu Bewässerungs- wie auch Transportzwecken), Landwegebau und Schifffahrt vorgestellt, ebenso die Verbesserungen der Transportmittel und Orientierungshilfen, die für den Land- beziehungsweise Seeverkehr gebraucht wurden. Nicht minder bedeutsam waren Veränderungen der Waffentechnik, die machtpolitisch enorme Wirkungen entfalteten. So waren die Reiche der Inkas und Azteken, die nicht einmal Eisen kannten, schnell dem Untergang geweiht – trotz ihrer Fertigkeiten auf dem Gebiet der Architektur oder der Zeitmessung. Neben Waffen stellten Handwerker aber zum Beispiel auch Luxusgüter, nicht selten Imitate von Überseeprodukten, her. Gerade in der Porzellan-, Uhren- oder Textilproduktion etablierten sich Manufakturen und Verlagsbeziehungen, die teilweise schon mit komplexen Maschinen arbeiteten. Dieser Trend lässt sich im Bergbau ebenfalls beobachten, der – unter anderem auf Grund seines hohen Holzverbrauchs – auch Beispiele für die teilweise bedenklichen ökologischen Folgen technischer Entwicklungen liefert. Nur auf wenigen der angesprochenen Gebiete besaß Europa vor 1800 gegenüber anderen Kulturen einen klaren Vorsprung! Doch begannen Europäer zu experimentieren und zu quantifizieren, und deshalb erschlossen sich in erster Linie ihnen durch nautische Geräte und Kartenprojektionen, Fernrohre und Mikroskope neue Welten.
Fernhandel und Entdeckungen
Fernhandel und Entdeckungen wurden durch technische Neuerungen zwar erleichtert, motiviert wurden sie jedoch primär von ökonomischen Interessen. Gerade die Reduktion der kommerziellen Fernbeziehungen innerhalb Eurasiens auf dem Landweg im 14. Jahrhundert führte zu vermehrten Aktivitäten im Seehandel, von privater arabisch-indischer, vorübergehend auch von staatlich-chinesischer Seite, vor allem aber letztlich zu den Entdeckungsfahrten von Vasco da Gama und Kolumbus mit der langfristigen Folge eines europäisch dominierten weltweiten Überseehandels. Dessen Hauptträger waren ab ca. 1600 nicht mehr die Kronen Portugals beziehungsweise Spaniens, sondern die Überseekompanien der Niederlande, Englands und anderer konkurrierender Länder. Die Untersuchung zeigt, dass sich durch die Intensivierung der inter- und innerkontinentalen Menschen-, Waren- und Informationsströme bereits das Entstehen einer „Weltwirtschaft“ abzeichnete. Dabei veränderte der – ungleichgewichtige – Austausch von Krankheitserregern wie auch von Nahrungs- und Genussmitteln den Alltag nicht nur der Eliten in vielen Teilen des Globus.
Von den für sie vorerst unattraktiv erscheinenden „neuen Welten“ erkundeten die Europäer primär nur deren Küsten, gründeten dort zu Handelszwecken einige Stützpunkte und suchten ansonsten nach Meeresstraßen, um zu den reichen Gegenden der außereuropäischen Welt zu gelangen. Einige davon – wie Mexiko, Peru oder die Molukken/„Gewürzinseln“ – wurden dann schnell erobert. Andere wie die Binnenreiche Indiens oder die ostasiatischen Staaten erwiesen sich dagegen als wehrhaft oder gar feindlich, so dass Kenntnisse über diese Räume nur schwer – und dementsprechend rudimentär und oft widersprüchlich – zu erhalten waren. Immerhin resultierte aus diesen vielfältigen interkulturellen Begegnungen nicht nur, aber besonders in Europa ein durch Texte, Karten und Bilder verbreiteter, anhaltender Wissenszuwachs. Ein Teil dieser neuen Informationen gelangte in breite Kreise, denn auf viele wirkte und wirkt Exotik faszinierend – egal, ob es dabei um fremde Menschen oder seltene beziehungsweise „kuriose“ Gegenstände aus anderen Weltregionen geht.
„Weltpolitik“
Im Gegensatz zu den ephemeren chinesischen Übersee-Expeditionen wirkte sich die (west-)europäische Expansion auch in den Bereichen von Herrschaft und politischen Ideen aus, denen der zweite Teil des Buches gewidmet ist. Denn durch sie begann die zwischen Ländern und Reichen betriebene Außen- und Machtpolitik immer mehr den Charakter einer „Weltpolitik“ im eigentlichen Wortsinn anzunehmen. Nach den Zerstörungen der mongolischen Invasionen entstanden ab ca. 1300 im kontinentalen Eurasien zwei neue, expandierende Reiche: das Moskauer sowie das Osmanische Reich. In der Tradition des Eroberers Timur gründeten die Moguln seit 1526 ein Imperium, das Teile...
| Erscheint lt. Verlag | 1.1.2016 |
|---|---|
| Verlagsort | Darmstadt |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Allgemeines / Lexika |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte | |
| Schlagworte | "Antike • Antike • Geschichte • Menschheitsgeschichte • "Mittelalter • Mittelalter • Nachschlagewerk • Neuzeit • Weltgeschichte |
| ISBN-10 | 3-534-74041-6 / 3534740416 |
| ISBN-13 | 978-3-534-74041-3 / 9783534740413 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 7,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich