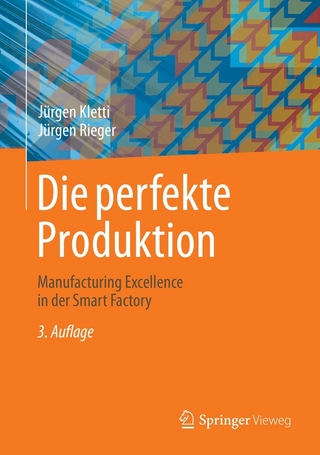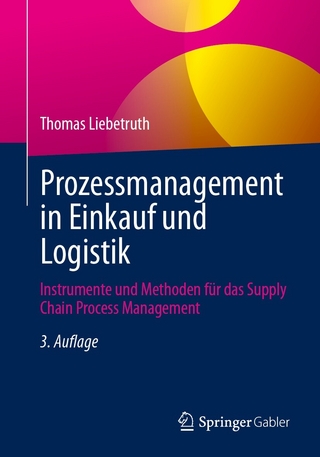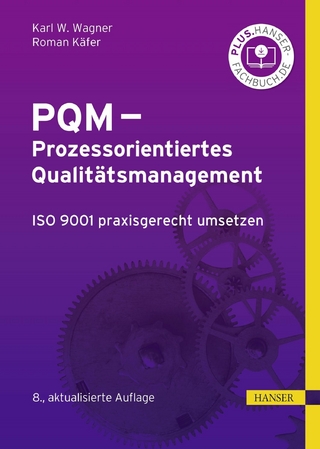Handbuch der Mess- und Automatisierungstechnik in der Produktion (eBook)
XIX, 853 Seiten
Springer-Verlag
978-3-540-34823-8 (ISBN)
Für Studierende der Einstieg in die praktische Welt der Automatisierung. Das Buch gibt einen Überblick über die wichtigen mechanischen, pneumatischen, hydraulischen, elektromechanischen und elektronischen Bauelemente, aus denen komplexe Systeme der Meß- und Automatisierungstechnik aufgebaut werden. Mit einem umfassenden Abkürzungsverzeichnis der Automatisierungstechnik.
Professor Dr.-Ing. Hans-Jürgen Gevatter absolvierte ein Studium des Maschinenbaus und der Elektrotechnik an der TU Braunschweig. Nach der Promotion war er als Entwicklungsingenieur tätig, dann als Technischer Geschäftsführer in der Industrie. Nach einer Honorarprofessur für das Lehrgebiet Bauelemente der Regelungs- und Steuerungstechnik der TU Braunschweig folgte 1985 die Berufung an die TU Berlin, Lehre und Forschung auf den Gebieten der Geräteelektronik, der Sensortechnik und der Mikrosystemtechnik.
Professor Dr.-Ing. Ulrich Grünhaupt war nach dem Studium der Nachrichtentechnik an der TU Berlin wissenschaftlicher Mitarbeiter am dortigen Institut für Feinwerktechnik. Promotion über Laser-Messtechnik in hochdynamischen Servosystemen. Industrietätigkeit bei der Robert Bosch GmbH in der Entwicklung Breitbandkommunikation, als Projektleiter für optische Übertragungskomponenten und als Produktmanager für optische Übertragungssysteme. 1995 Berufung an die FH Karlsruhe auf das Lehrgebiet Elektronik mit Schwerpunkt Optoelektronik.
Professor Dr.-Ing. Hans-Jürgen Gevatter absolvierte ein Studium des Maschinenbaus und der Elektrotechnik an der TU Braunschweig. Nach der Promotion war er als Entwicklungsingenieur tätig, dann als Technischer Geschäftsführer in der Industrie. Nach einer Honorarprofessur für das Lehrgebiet Bauelemente der Regelungs- und Steuerungstechnik der TU Braunschweig folgte 1985 die Berufung an die TU Berlin, Lehre und Forschung auf den Gebieten der Geräteelektronik, der Sensortechnik und der Mikrosystemtechnik. Professor Dr.-Ing. Ulrich Grünhaupt war nach dem Studium der Nachrichtentechnik an der TU Berlin wissenschaftlicher Mitarbeiter am dortigen Institut für Feinwerktechnik. Promotion über Laser-Messtechnik in hochdynamischen Servosystemen. Industrietätigkeit bei der Robert Bosch GmbH in der Entwicklung Breitbandkommunikation, als Projektleiter für optische Übertragungskomponenten und als Produktmanager für optische Übertragungssysteme. 1995 Berufung an die FH Karlsruhe auf das Lehrgebiet Elektronik mit Schwerpunkt Optoelektronik.
Vorwort 5
Autoren 7
Inhaltverzeichnis 9
Teil A Begriffe, Benennungen, Normen 20
1 Mensch-Maschine-Interaktion in der Fertigungstechnik 21
1.1 Der Fertigungsprozess als Mensch-Maschine-System 21
1.2 Gestaltungsmethodik 22
1.3 Gestaltungsaufgaben 23
1.4 Entwicklungstendenzen 25
Literatur 26
2 EU-Richtlinien zur Produktsicherheit von Geräten der Mess- und Automatisierungstechnik 27
2.1 Einleitung 27
2.2 Die Niederspannungsrichtlinie 28
2.3 Harmonisierte Normen 30
2.4 Prüfungen, Zerti.zierungen, Zulassungen zur Produktsicherheit 31
2.5 Die Maschinenrichtlinie 34
Literatur 39
3 EMV-Maflnahmen und -Richtlinien 40
3.1 Technische Regeln im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR/EEA) 40
3.2 EMV-Normen 43
3.3 EMV-Maflnahmen 48
Literatur 54
4 Regeln und Steuern 55
4.1 Einleitung 55
4.2 Regeln 56
4.3 Steuern 63
Literatur 68
Teil B Sensoren 69
1 Kraft, Masse, Drehmoment 70
1.1 Einleitung, Übersicht Messprinzipien 70
1.2 Kraftmessung 72
1.3 Massebestimmung 84
1.4 Drehmomentmessung 96
Literatur 103
2 Druck, Differenzdruck 108
2.1 Druck in Gasen und Flüssigkeiten [2.1] 108
2.2 Allgemeiner Aufbau eines Drucktransmitters 112
2.3 Sensoren für Über-, Absolut- und Differenzdruck 116
2.4 Elektronik 123
2.5 Einbau und Montage 127
Literatur 130
Registrierte Warenzeichen 130
3 Drehzahl und Lage 131
Vorbemerkung 131
3.1 Messprinzipien und Messverfahren 131
3.2 Längenmessung 134
3.3 Winkelmessung 138
3.4 Anforderungen an Messgeräte für Direktantriebe 140
Literatur 142
4 Beschleunigung 143
4.1 Einleitung 143
4.2 Messung von Bewegungsvorgängen mit absolutem und relativem Bezugspunkt 144
4.3 Beschleunigungssensoren mit seismischer Masse – Prinzipieller Aufbau und Eigenschaften 145
4.4 Prinzipien von Beschleunigungssensoren 149
4.5 Eigenschaften und Ein.üsse bei der Messung mit seismischen Sensoren 154
Literatur 160
5 Temperatur 161
5.1 Einleitung 161
5.2 Temperaturmessgeräte mit elektrischem Ausgangssignal 163
5.3 Temperaturmessgeräte mit mechanischem Ausgangssignal 178
5.4. Besondere Temperatursensoren und Messverfahren 184
6 Durchfluss 187
Literatur 185
6.1 Einleitung 187
6.2 Allgemeine strömungsmechanische Grundlagen 187
6.3 Durchflussmessverfahren 191
6.4 Zusammenfassung 210
Literatur 210
Teil C Fertigungs- und Qualitätsmesstechnik 211
1 Fertigungsmesstechnik 212
1.1 Einleitung 212
1.2 Grundlagen der Fertigungsmesstechnik 212
1.3 Prüfdatenerfassung (Geometrie) 238
Literatur 368
2 Methoden der zerstörungsfreien Prüfung 376
2.1 Einführung 376
2.2 Übersicht der Methoden der zerstörungsfreien Prüfung 378
2.3 Aktuelle Methoden der zerstörungsfreien Prüfung 382
2.4. Zusammenfassung, Ausblick, Zukunftsperspektiven 415
Literatur 419
Teil D Elektrische Signalverarbeitung und Komponenten 424
1 Elektrische Signalverstärker 425
1.1 Bipolartransistoren 425
1.2 MOS-Feldeffekttransistoren 429
1.3 Operationsverstärker (OPV) 430
Literatur 433
2 Analog-Digital- und Digital-Analog-Umsetzer 434
2.1 Analog-Digital-Umsetzer 434
2.2 Digital-Analog-Umsetzer 441
Literatur 444
3 Digitale Schaltungen 446
3.1 Grundlegende Betrachtungen 446
3.2 Schaltkreisfamilien und Schaltkreistechnologien 448
3.3 Funktionen digitaler Bauelemente 456
3.4 Anwendungsspezi.sche Schaltungen (ASIC) 464
Literatur 467
4 Relais 469
4.1 Historie und heutige Bedeutung 469
4.2 Eigenschaften elektromechanischer Relais 470
4.3 Schutzbeschaltungen 476
4.4 Weitere Relaisprinzipien 478
4.5 Ausblick 480
Literatur 481
Teil E Bussysteme 482
1 Einführung 483
1.1 Entwicklungen in der Automatisierungstechnik 483
1.2 Serielle und parallele Anschlusstechnik 489
Literatur 492
2 Grundlagen 493
2.1 Kommunikationsmodelle 493
2.2 Kommunikationscharakteristik 495
2.3 Netzwerktopologie 498
2.4 Kommunikationsschichten 499
2.5 Netzwerktechnik1 510
Literatur 522
3 Industrielle Feldbusse 523
3.1 Echtzeit in Bussystemen 523
3.2 Feldbusnormen 528
3.3 Allgemeine Bussysteme 533
3.4 Antriebstechnik 571
3.5 Sichere Bussysteme 582
3.6 Prozessindustrie 589
Literatur 604
4 Ethernet Automatisierungstechnik 605
4.1 Grundlagen Ethernet Automatisierungstechnik 605
4.2 Industrielles Echtzeit-Ethernet 617
Literatur 632
5 Drahtlose Netzwerke 633
5.1 Einleitung 633
5.2 Wireless Technologie 635
5.3 WLAN 802.11 642
5.4 Bluetooth™ 650
5.5 Wireless-Sensornetzwerke 657
Literatur 661
Teil F Antriebstechnik 662
1 Elektrische Antriebstechnik 663
1.1 Hauptantriebe 665
1.2 Stellantriebe 685
Literatur 698
2 Pneumatische Antriebstechnik 699
2.1 Aufbau einer Pneumatikanlage 699
2.2 Ventile 701
2.3 Antriebe 703
2.4 Systemtechnik 707
Literatur 711
3 Hydraulische Antriebstechnik 712
3.1 Einleitung 712
3.2 Elektrohydraulische Antriebe 714
3.3 Ventilgesteuerter Zylinderantrieb im Positionsregelkreis 728
3.4 Schlussbemerkungen 736
Literatur 737
Teil G Robotertechnik und Anwendungen 739
1 Einführung 740
2.1 Definition „Industrieroboter“ 741
2.2 Definition „Autonomes Fahrzeug und mobiler Roboterarm“ 741
2 Definitionen 741
2.3 Definition „Kinematik“ 742
2.4 Definition „Freiheitsgrad“ 742
2.5 Definition „Bewegungsachse“ 742
2.6 Definition „Koordinatensysteme“ 742
Literatur 743
3 Aufbau von Industrierobotern 744
3.1 Kinematik 744
3.2 Greifer 748
3.3 Antriebe und Getriebe 749
3.4 Messsysteme 750
3.5 Steuerungen 752
3.6 Sensoren 754
4.1 Mathematische Beschreibung der Kinematik 759
4 Grundaufgaben der Industrieroboter 759
Literatur 758
4.2 Bahnplanung 764
4.3 Dynamik und Regelung 765
4.4 Programmierung 766
Literatur 767
5 Roboteranwendungen 768
5.1 Oberflächenschleifen groflflächiger Geometrien 768
5.2 Inkrementelle Umformung von Feinblech 771
5.3 rob@work – Assistenzroboter als Helfer in der Produktion 773
5.4 team@work – Mensch-Roboter-Kooperation in der Montage 778
5.5 PowerMate – Mensch-Roboter-Kooperation auf dem Weg zur industriellen Umsetzung 782
Allgemeines Abkürzungsverzeichnis 786
Sachverzeichnis 832
3 EMV-Maßnahmen und -Richtlinien (Anton Kohling) (S. 23-34)
Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), de. niert als die Fähigkeit einer elektrischen Einrichtung in ihrer elektromagnetischen Umgebung zufriedenstellend zu funktionieren, ohne diese Umgebung, zu der auch andere Einrichtungen gehören, unzulässig zu beein. ussen, ist eine Eigenschaft, ein Qualitätsmerkmal eines Produktes. EMV kennzeichnet also einen Zustand, der herrscht, wenn elektrische Einrichtungen aller Art sich gegenseitig nicht stören und in ihrer Funktion nicht beeinträchtigen und diese auch von elektromagnetischen Naturphänomenen wie z. B. dem Blitz nicht beeinträchtigt werden. Dieser Zustand des harmonischen Neben- und Miteinanders modernster Leistungs- und Informationselektronik verschiedenster Hersteller muss erreicht werden.
Zunehmende Integrationsdichte elektrischer und elektronischer Einrichtungen, räumliche Nähe von Leistungs- und Informationselektronik, die Übertragung stetig steigender Mengen elektrischer Energie und wachsende Datenraten, die Ausweitung der Prozessautomatisierung und Überwachung sowie die vermehrte Nutzung informationstechnischer Einrichtungen in allen Bereichen erfordern die vorbeugende Berücksichtigung der Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) für den ungestörten Betrieb elektrischer Systeme und Anlagen. Eine seit Jahrzehnten bekannte Thematik, die mit der massenhaften Verbreitung von High-Tech-Produkten in Haushalten, Büros und Fabriken einer einheitlichen Lösung bedurfte.
Die präventive Berücksichtigung der „Elektromagnetischen Verträglichkeit" ist Schwerpunktthema jeder systemtechnischen Betrachtung. Methoden und Maßnahmen zur Sicherstellung der EMV sind bekannt, Produkte und Leistungen dazu werden angeboten, Normen geben einen Leitfaden. Das Wissen dazu wird in Seminaren und sonstigen Weiterbildungsmaßnahmen vermittelt. Die EMV ist durch die Anwendung und technische Umsetzung einiger weniger physikalischer Grundprinzipien mit normalem Ingenieurwissen zu erreichen und hat nichts mit schwarzer Magie zu tun.
3.1 Technische Regeln im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR/EEA)
3.1.1 Grundsätzliche Anforderungen
Mit dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 3.1 beschlossen die Vertragspartner, den Binnenmarkt schrittweise bis zum 31.12.1992 zu verwirklichen, wobei der Binnenmarkt de. niert ist als ein Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gewährleistet ist. Zur Verwirklichung dieses Zieles mussten bezüglich des freien Verkehrs von Industrieerzeugnissen auch technische Handelshemmnisse, die auf unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen in den Mitgliedstaaten beruhten, abgebaut werden. Die Angleichung nationaler Rechts- und Verwaltungsvorschriften erfolgt mittels technischer Harmonisierungsrichtlinien. Nach der „neuen Konzeption" 3.2 auf dem Gebiet der technischen Harmonisierung und Normung beschränken sich die technischen Harmonisierungsrichtlinien auf die Festlegung der grundlegenden Sicherheitsanforderungen oder sonstiger Anforderungen im Interesse des Gemeinwohls. Die Ausarbeitung detaillierter technischer Spezi. kationen (Normen) wurde den für die Industrienormung zuständigen Normeninstitutionen wie CEN, CENELEC und ETSI übertragen. Normen dieser Organisationen, deren Ausarbeitung von der Kommission für die Umsetzung einer Richtlinie in Auftrag gegeben (mandatiert) wurde und die nach Fertigstellung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden sind, können für den Nachweis zur Übereinstimmung mit den Schutzanforderungen der jeweiligen Richtlinie verwendet werden. Die Anwendung harmonisierter Normen ist grundsätzlich immer nur ein möglicher Weg zur Sicherstellung der Schutzanforderungen. Es gibt immer den Weg, die Richtlinienkonformität direkt anhand der „grundlegenden Anforderungen" zu erreichen. Allerdings ist für diesen zweiten Weg in einigen Richtlinien ein Konformitätsbewertungsverfahren vorgesehen, das die Einschaltung einer „benannten Stelle" fordert. In der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle wird der Weg über die Normen der günstigere sein, denn die Verwaltungen der Mitgliedstaaten sind verp. ichtet, bei Erzeugnissen, die nach harmonisierten, im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften gelisteten Normen hergestellt worden sind, eine Übereinstimmung mit den in der Richtlinie aufgestellten „grundlegenden Anforderungen" anzunehmen. Im Juristendeutsch besteht „die Vermutung der Übereinstimmung". Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Übereinstimmung mit den Anforderungen aller für das Produkt zutreffenden EG-Richtlinien, die nach der „neuen Konzeption" erstellt wurden. Es ist also „Sache" des Herstellers sich zu informieren, von welchen technischen Harmonisierungsrichtlinien sein Produkt betroffen ist.
| Erscheint lt. Verlag | 6.7.2006 |
|---|---|
| Reihe/Serie | VDI-Buch |
| Zusatzinfo | XIX, 854 S. |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Technik ► Bauwesen |
| Technik ► Elektrotechnik / Energietechnik | |
| Technik ► Maschinenbau | |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Logistik / Produktion | |
| Schlagworte | Analog • Antriebstechnik • Bauelement • Bussystem • Definitionen • Digital-Analog-Umsetzer • digitale Schaltungen • Draht • Elektrische Antriebstechnik • Elektromagnetische Verträglichkeit • Feldbus • Fertigungsmesstechnik • Komponenten • Montagesysteme • Netzwerk • Normen • Qualitätsmesstechnik • Relais • Robotersysteme • Schaltung • Sensoren • Signalverarbeitung • Umsetzer • Verstärker |
| ISBN-10 | 3-540-34823-9 / 3540348239 |
| ISBN-13 | 978-3-540-34823-8 / 9783540348238 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 28,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich