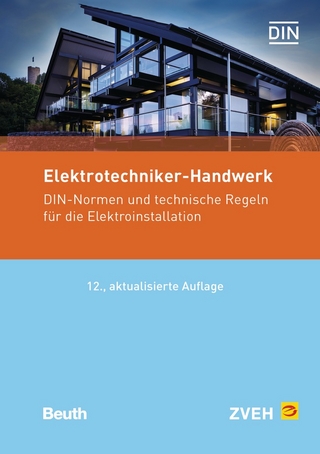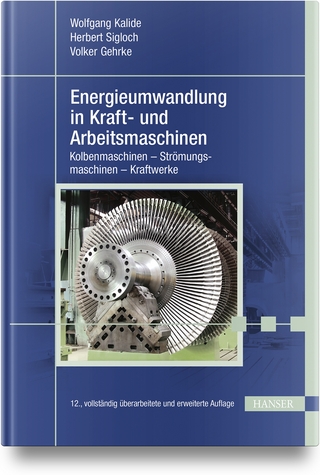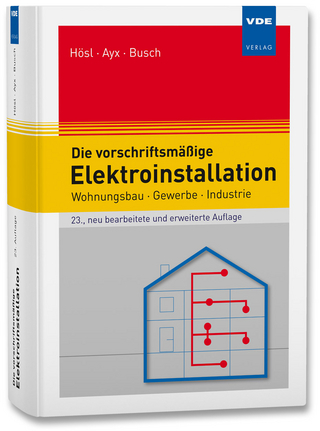Regelungstechnik Aufgaben
Verlag Dr. Zacher
978-3-937638-27-0 (ISBN)
- Titel ist leider vergriffen;
keine Neuauflage - Artikel merken
Das kleinformatige Buch mit 122 Aufgaben auf 150 Seiten hat seit seiner ersten Auflage im Jahr 1998 seinen Gehalt an lernpraktischer Anregung in den vier vorherigen Auflagen bestätigt und wird ständig mit neuen Aufgaben aktualisiert. Trotz immenser Präsenz der Regelungstechnik-Lehrbücher auf dem Buchmarkt (siehe Literaturverzeichnis) wurde die vorliegende Aufgabensammlung gern als Hilfsmittel zur Übung und Klausurvorbereitung von Studierenden gefragt. Wegen seiner kompakten, aber vollständigen Formelsammlung und mehreren Tabellen im Kapitel 1 wird das Buch erfahrungsgemäß auch für Studien- und Abschlussarbeiten verwendet sowie nach dem Studium bei praktischer Arbeit weiter benutzt.
Zum leichten Lernen sind die Übungsaufgaben nach dem Schwierigkeitsgrad in folgende Kategorien eingeteilt und dementsprechend markiert:
L - leicht: einfache Aufgaben zum Einstieg
M - mittel: Übungsaufgaben (klausurrelevante)
H - hoch: Übungsaufgaben (klausurrelevante)
S - sehr hoch: Praktikumsaufgaben (nicht klausurrelevante)
Die Aufgabensammlung ist im Eigenverlag des Autors erschien und kann direkt per Mail bestellt werden:
info@szacher.de
Dieses Buch, wie auch folgende Regelungstechnik-Bücher des Autors in anderen Verlagen, sind in Bibliotheken und im Buchhandel erhältlich:
• „Regelungstechnik für Ingenieure“ (gemeinsam mit M. Reuter), 14. Auflage (2014), Verlag Springer-Vieweg;
• „Übungsaufgaben Regelungstechnik“, 5. Auflage (2014), Springer-Vieweg;
• "Automatisierungstechnik kompakt" (2000), Verlag Vieweg;
• „Duale Regelungstechnik“ (2003), im VDE-Verlag
Mehr Info zum Buch und zum Unterricht findet man auf der Webseite des Autors:
www.zacher-automation.de
Dr.-Ing. Serge Zacher ist seit 1962 im Hochschulbereich und in der chemischen Industrie tätig. Von 1992 bis 2006 war Professor an der Hochschule RheinMain (ehem. FH Wiesbaden) in Rüsselsheim, danach Lehrbeauftragter an diversen Hochschulen. Seit 2003 Inhaber des Verlags Dr. Zacher mit mehreren eigenen Büchern im Bereich Automation, Mathematik und Belletristik, darunter "Bus-Approach for Feeedback MIMO-Control", "Verbotene Mathematik", "Prozessvisualisierung" (mit Claude Wolmering), sowie mit Büchern von anderen Autoren, wie Robert Mille, Michael Kosttin, Olga Zvetkova, Michael Schubothe und Siegfried Auer.
Inhalt
1. Formelsammlung
2. Lineare Regelung
2.1 Bauglieder des Regelkreises
2.1.1 Winkelregelung einer Antenne
2.1.2 Feder-Dämpfer-System (1)
2.1.3 Feder-Dämpfer-System (2)
2.1.4 Lageregelung eines Magnetschwebekörpers
2.1.5 Windkraftanlage
2.1.6 Lageregelung eines Roboterarmes
2.2 Statische Kennlinien
2.2.1 Lineare Regelstrecke
2.2.2 Linearisierte Regelstrecke
2.2.3 Arbeitspunkt
2.2.4 DGL und statische Kennlinie
2.3 Linearisierung
2.3.1 Graphische Linearisierung: Stellverhalten
2.3.2 Graphische Linearisierung: Störverhalten
2.3.3 Analytische Linearisierung
2.3.4 Proportionalbeiwerte im Arbeitspunkt
2.4 Reeller Regelfaktor
2.4.1 Führungsverhalten
2.4.2 Störverhalten
2.4.3 Kreisverstärkung
2.4.4 Kennlinie des Reglers
2.5 Aufstellen von Differentialgleichungen
2.5.1 Winkelgeschwindigkeitsregelung
2.5.2 Schwebekörper im Magnetfeld
2.5.3 Rotorgeschwindigkeitsregelung
2.5.4 Temperaturregelung eines Reaktors
2.5.5 Temperaturregelung eines Induktionsofens
2.6 Wirkungsplan
2.6.1 Grundstrukturen
2.6.2 Offener und geschlossener Wirkungsweg
2.6.3 Vereinfachung des Wirkungsplanes
2.6.4 Störverhalten
2.6.5 Führungsverhalten
2.6.6 Führungs- und Störverhalten
2.6.7 Komplexer Regelfaktor
2.6.8 Überlagerungsprinzip
2.6.9 Umformung des Wirkungsplanes
2.7 Frequenzkennlinien
2.7.1 Amplitudengang
2.7.2 Ortskurve des Frequenzganges
2.7.3 Bode-Diagramm
2.7.4 Bode-Diagramm und Ortskurve
2.7.5 Bode-Diagramm und Sprungantwort
2.8 Sprungantworten
2.8.1 PI -Verhalten
2.8.2 P-Tt -Verhalten
2.8.3 P-P-T1-Verhalten
2.9 Bleibende Regeldifferenz
2.9.1 Störverhalten
2.9.2 Führungsverhalten
2.9.3 Reglereinstellung
2.9.4 Auswahl des Reglers
2.10 Stabilitätskriterien
2.10.1 Hurwitz-Kriterium für DGL 2.Ordnung
2.10.2 Hurwitz-Kriterium für DGL 3.Ordnung
2.10.3 Stabilitätsgebiet
2.10.4 Regelkreis mit instabiler Regelstrecke
2.10.5 Stabilitätsbedingungen nach Nyquist-Kriterium
2.10.6 Nyquist-Kriterium im Bode-Diagramm
2.11 Reglereinstellung
2.11.1 Schwingungsversuch
2.11.2 Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols-Verfahren
2.11.3 Einstellung nach vorgegebenem Dämpfungsgrad
2.11.4 Einstellung nach vorgegebener Phasenreserve
2.11.5 Reglereinstellung nach Betragsoptimum
2.11.6 Betragsoptimum und Ersatzzeitkonstante
2.11.7 Reglereinstellung nach symmetrischem Optimum
2.11.8 Symmetrisches Optimum und Ersatzzeitkonstante
2.11.9 Symmetrisches Optimum und Betragsoptimum
2.12 Regler mit Rückführung
2.12.1 PD-Regler
2.12.2 PID-Regler
2.12.3 PID-Regler nach Betragsoptimum
2.13 Kaskadenregelung
2.13.1 Einstellung nach vorgegebenem Dämpfungsgrad
2.13.2 Dämpfung eines Folgeregelkreises
2.13.3 Einstellung nach gewünschter Zeitkonstante
2.14 Störgrößenaufschaltung
2.14.1 Vollständige Kompensation
2.14.2 Übertragungsfunktion des Korrekturgliedes
2.15 Simulationsaufgaben
2.15.1 Betragsoptimum, Ersatzzeitkonstante
2.15.2 Kaskadenregelung, Betragsoptimum
2.15.3 Regelkreisverhalten
2.15.4 Nyquist-Stabilitätskriterium
3. Zweipunktregelung
3.1 Regler ohne Schaltdifferenz
3.1.1 Zweipunktregler mit und ohne Grundlast
3.1.2 Regelkreis mit P-T2-Strecke
3.1.3 Regelkreis mit I-Tt-Strecke
3.1.4 Zweipunktregler mit Grundlast
3.2 Regler mit Schaltdifferenz
3.2.1 Zweipunktregler mit P-T1-Strecke
3.2.2 Zweipunktregler mit P-Tt-Strecke
4. Modellbasierte Regelung
4.1 Regler nach dem Kompensationsprinzip
4.1.1 Kompensationsregler
4.1.2 Smith-Prädiktor
4.2 Regler nach dem PFC-Algorithmus
4.2.1 PFC für eine P-T1-Strecke
4.2.2 SPFC für eine P-T1-Strecke mit P-Regler
5. Mehrgrößenregelung
5.1 MIMO-Strecken
5.1.1 MIMO-Strecke in P-Form
5.1.2 Identifikation einer MIMO-Strecke in P-Form
5.1.3 MIMO-Strecke in V-Form
5.2 Entkopplungsregler
5.2.1 Entkopplungsregler in V-Form für Strecke in P-Form
5.2.2 Entkopplungsregler in P-Form für Strecke in V-Form
6. Nichtlineare Regelung
6.1 Harmonische Linearisierung
6.1.1 Signalbegrenzung (Sättigung)
6.1.2 Ansprechschwelle (Tote Zone)
6.1.3 Reihenschaltung von zwei Nichtlinearitäten
6.1.4 Relais
6.2 Zweiortskurvenverfahren
6.2.1 Regelkreis mit Signalbegrenzung
6.2.2 Regler mit Ansprechschwelle (Tote Zone)
7. Digitale Regelung
7.1 Quasikontinuierliche Regelung
7.1.1 Bestimmung von Abtastzeiten
7.1.2 Reglereinstellung nach Phasenreserve
7.1.3 Phasengänge von analogen/digitalen Regelkreisen
7.1.4 Stabilitätsgrenze
7.1.5 Reglereinstellung nach Betragsoptimum
7.2 Digitale Regelalgorithmen
7.2.1 Aufstellen von Algorithmen
7.2.2 Sprungantwort eines digitalen Regelkreises
7.2.3 Wertfolge im Zeitbereich
7.2.4 Rücktransformation einer z-Übertragungsfunktion
7.2.5 Wertefolgen im z-Bereich und Zeitbereich
7.2.6 Stabilität im z-Bereich
7.2.7 Zeitdiskreter Regler
7.2.8 Reglerentwurf im z-Bereich
7.2.9 Kompensationsregler im Bildbereich
7.2.10 Smith-Prädiktor im Bildbereich
7.2.11 Kompensationsregler im z-Bereich
7.2.12 Dead-beat Regler im Zeitbereich
7.2.13 Dead-beat Regler im z-Bereich
8. Zustandsregelung
8.1 DGL und Zustandsgleichungen
8.2 Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit
8.3 Eigenwerte
8.4 Zustandsrückführung, Vorfilter
8.5 I-Regler vs. Zustandsrückführung
8.6 PI-Regler vs. Zustandsrückführung
8.7 Beobachter
8.8 Ausgangsrückführung
8.9 Ausgangsrückführung mit I-Anteil
8.10 PI-Regler mit Zustandsrückführung
8.11 Optimale LQ-Regelung: System 1.Ordnung
8.12 Optimale LQ-Regelung: System 3.Ordnung
Literaturverzeichnis
Sachwortverzeichnis / Index Dictionary
Gegenüber der 4. Auflage sind hier die Aufgaben zum Thema „Steuerung“ durch neue Aufgaben zum Thema „Modellbasierte Regelung“ (Kapitel 4) ersetzt. Darüber hinaus entstanden neue Kapitel: • „Mehrgrößenregelung“ (Kapitel 5) zum Entwurf von Entkopplungsreglern; • „Nichtlineare Regelung“ (Kapitel 6) zur Stabilitätsuntersuchung mit Harmonischer Linearisierung für Sättigung, Ansprechschwelle und Relais, sowie zum Regler-Entwurf anhand Zweiortskurvenverfahren; • „Zustandsregelung“ (Kapitel 8). Das Kapitel 4 „Digitale Regelung“ der vorherigen Auflage wurde korrigiert und verbessert. Sie erscheint im vorliegenden Buch als Kapitel 7. Im Kapitel 2 sind, wie in vorherigen Auflagen, lineare Regelkreise im Bildbereich nach dem Betragsoptimum und dem symmetrischen Optimum sowie im Zeit-Bereich nach dem Ziegler/Nichols-Verfahren behandelt. Im Frequenzbereich erfolgt die Lösung hauptsächlich mit Hilfe von Bode-Diagrammen. Die Aufgaben des Abschnitts 2.15 sind speziell für Simulation mit MATLAB/Simulink zugeschnitten. Die Zweipunktregler mit und ohne Schaltdifferenz, sowie mit Grundlast, sind wie in der dritten Auflage, separat in Kapitel 3 behandelt. Die Formelsammlung und mehrere Tabellen sind in Kapitel 1 aufgestellt. Wie in der dritten Auflage beinhaltet das Buch wieder das englische Sachwort- und Formelzeichenverzeichnis, was eine gute Grundlage für Selbststudium und für ein weiteres Studium an internationalen Bachelor-/Master-Studiengängen bilden soll. Die verwendeten Formelzeichen orientieren sich an die Normen DIN 19226, DIN EN 61131-3 und DIN EN 60027-6. Die Wahl der Buchstaben für die Höhe des Eingangssprungs der Führungs- und der Störgröße hält sich an die in der klassischen Literatur übliche Schreibweise ( bzw. ). Die physikalischen Größen sind mit Großbuchstaben X, Y bezeichnet. Mit dem Index 0 sind entsprechenden Variablen im Arbeitspunkt dargestellt, z. B. X0 und Y0. Die Abweichungen der Regelkreisgrößen vom Arbeitspunkt sind mit Kleinbuchstaben bezeichnet, z. B. x und y. Werden die Variablen im allgemeinen Fall mit Großbuchstaben ohne Indizes geschrieben, z. B. X oder Y, so handelt es sich um allgemeine Variablen, X = X0 + x und Y = Y0+y. Für die Ableitungen einer Funktion x(t) gilt die vereinfachende Schreibweise, d. h. Es wird angenommen, dass sich der Regekreis zum Zeitpunkt t = 0 in der Ruhelage befindet.
| Erscheinungsdatum | 30.04.2018 |
|---|---|
| Zusatzinfo | Prinzipskizzen und Wirkungspläne von Regelkreisen, Sprungantworten, Ortskurven, Bode-Diagramme, simulierte Regelkreise mit MATLAB/Simulink |
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 148 x 210 mm |
| Gewicht | 236 g |
| Themenwelt | Technik ► Elektrotechnik / Energietechnik |
| Schlagworte | ASA-Regler • Automatisierungstechnik • Digitale Regelung • Kaskadenregelung • Lineare Regelung • Modellbasierte Regelung • Regelungstechnik • Smith-Prädiktor • Zustandsregelung • Zweipunktregelung |
| ISBN-10 | 3-937638-27-X / 393763827X |
| ISBN-13 | 978-3-937638-27-0 / 9783937638270 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich