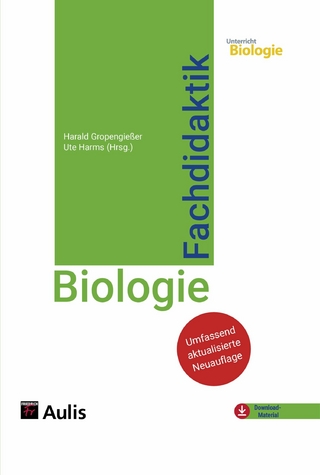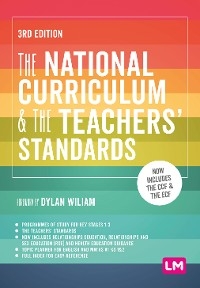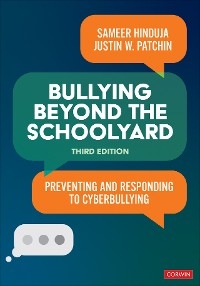Satzanfänge und Formulierungen - Mühelos wissenschaftlich schreiben in 5 Schritten (eBook)
96 Seiten
tolino media (Verlag)
978-3-7546-7382-9 (ISBN)
Wer wissenschaftlich nicht gut schreiben kann, fürchtet selbst kleine Hausarbeiten. Von der Bachelor- oder Masterarbeit ganz zu schweigen. Doch so kompliziert ist es eigentlich nicht. Der Autor Maximilian Hetsch zeigt unerfahrenen Studenten bereits seit Jahren, wie einfach wissenschaftliches Schreiben geht. Komprimiert gibt er in diesem Ratgeber die Geheimnisse einer gut formulierten Studienarbeit weiter: • Überwinde Schreibblockaden. Maximilian zeigt dir hunderte wissenschaftliche Formulierungen, damit du nie wieder eine Schreibblockade bei Studienarbeiten bekommst. • Wie du nie wieder Fehler machst. Der Autor erklärt, wie du jede Studienarbeit auf Fehler überprüfst und damit fehlerfrei abgibst. • Bestnoten mit beeindruckenden Grafiken. Für ein summa cum laude helfen immer eigens angefertigte Statistiken, Infografiken und Bilder - Professoren sehen das besonders gern. Wie du diese einfach anfertigst. • Den roten Faden beibehalten. 20 - 30 Seiten tief in der Bachelorarbeit stellen sich viele Studis die Frage: „Worüber schreibe ich hier denn gerade?“ Lass dir helfen, den roten Faden zu behalten. • Und vieles mehr! Vereinfache dir dein Studium ab sofort. Mit diesem Buch wird die nächste Studienarbeit zur Leichtigkeit.
Maximilian Hetsch zeigt unerfahrenen Studenten bereits seit Jahren, wie einfach korrektes wissenschaftliches Arbeiten funktioniert. Komprimiert gibt er in seinen Ratgebern die wichtigsten Informationen weiter. So werden Haus-, Bachelor- oder Masterarbeiten garantiert zum Erfolg.
1. Schritt: Perspektiven
Wie dir das erste Kapitel gezeigt hat, kannst du die Alltagssprache nutzen und Aussagen erst im Rohtext auf ein angemessenes wissenschaftliches Niveau bringen. Bei einzelnen Formulierungen ist dieser Transformationsprozess „Alltag -> Wissenschaft“ einfacher zu bewerkstelligen als bei ganzen Aussagen. Im 1. Schritt des wissenschaftlichen Schreibens, der in diesem Kapitel vorgestellt wird, geht es darum, dass du – ausgehend von der Annahme, dass du mit dem Schreiben des Rohtextes beginnst – deine Freiheiten und Grenzen bei der Rohtextverfassung in einem vertretbaren Rahmen ausnutzt. Kreativität ist also gewünscht, aber gleichzeitig solltest du einen Grundstein dafür legen, um später mit einem möglichst geringen Aufwand den abnahmefähigen Text zu formulieren.
Ein vertretbarer Rahmen von Freiheiten und Grenzen ist dann gegeben, wenn du nicht ganze Aussagen auf dem inhaltlichen Niveau der Alltagssprache tätigst. Es geht also darum, dass du in der Formulierung des Rohtextes deine Forschungsergebnisse wahrheitsgemäß und mit allen wichtigen zugehörigen Informationen vorträgst. Außerdem solltest du Aussagen aus Quellen korrekt zitieren und das Zitat als solches eintragen, um das Risiko für ein Plagiat zu senken. Das alles ist unter Einhaltung eines logischen roten Fadens durchzuführen.
Sofern du auf all die Vorgaben in diesem Kapitel achtest, stellst du die Richtigkeit deiner Aussagen sicher. Wie du deine Ergebnisse und Erkenntnisse schriftlich im Hinblick auf Satzanfänge und Formulierungen niederschreibst, bleibt im Rohtext dir überlassen und wird erst im Nachhinein ausgebessert. Dieser stilistische Freiraum beim Verfassen deines Rohtextes beflügelt deine Kreativität: Schreibblockaden, Sorge vor Fehlern, unnötig häufiges Korrekturlesen – all das bleibt dir mit höherer Wahrscheinlichkeit erspart, wenn du dich zunächst auf korrekte Aussagen beschränkst und erst danach (siehe Folgekapitel) deinen Text stilistisch und grammatikalisch aufpeppst.
Zu Beginn zählt der Fortschritt, jedoch keineswegs die Perfektion! Schreibe die Inhalte korrekt auf und achte auf die Zitation. Wie du schreibst … das bleibt erstmal dir überlassen. Auf mehr kommt es im ersten Schritt und auch in diesem Kapitel nicht an.
Maximale Freiheiten beim Rohtext
Der Rohtext gibt dir maximale Freiheiten bei der Verfassung wissenschaftlicher Arbeiten. Es ist meist die Version deiner Arbeit, in der du noch nicht auf alle Feinheiten achtest. Im Fokus steht lediglich, die Inhalte aufs Papier zu bringen und eine erste Version der Arbeit fertigzustellen. So besteht zunächst das Grundgerüst, das daraufhin Schritt für Schritt – so, wie es dieses Buch erklären wird – „wissenschaftsreif“ und somit abgabereif gemacht wird.
Auf der Website der Ruhr-Universität Bochum findet sich eine Erklärung des Begriffs „Rohfassung“, die ziemlich hilfreich ist und mit der in den folgenden Zeilen weitergearbeitet wird, um den Rohtext als ersten Schritt der wissenschaftlichen Textverfassung zu erklären:
„Unter Rohfassung versteht man eine erste Version eines Textes. […] Für viele Schreibende kann es hilfreich sein, eine Rohfassung von einem Text zu erstellen, da in dieser noch nicht alle Einzelheiten ausgearbeitet werden (müssen). So können die Formatierung des Textes zunächst irrelevant und sprachliche und stilistische Überlegungen in den Hintergrund gestellt sein. Eine Rohfassung kann z. B. genutzt werden, um die eigenen Gedanken aufs Papier zu bringen oder Informationen aus bereits gelesenen (Fach-)Texten festzuhalten. Dadurch, dass der Fokus in erster Linie auf der Entstehung eines Textes als erster Version liegt, verhindert man beispielsweise, dass man sich mit Formulierungen aufhält, die dann in einer abschließenden Überarbeitung eventuell noch einmal geändert werden würden.“
Wie du stilistische Freiheiten in einem angemessenen Rahmen ausnutzt …
Abbildung 3: Entstehung und Weiterentwicklung des Rohtextes
Quelle: 2022, eigene Darstellung
Zuallererst suchst du Literatur aus und bereitest – falls du eigene Datenerhebungen machst – die Forschungsmethoden vor. Anschließend erhebst du die Daten bzw. forschst in der Literatur, um die formulierte Forschungsfrage zu beantworten. Währenddessen machst du dir Notizen und formulierst eventuell bereits Texte. Zitiere Aussagen aus anderen Quellen, um kein Plagiatsrisiko einzugehen.
Die Notizen und formulierten Texte werden zu einem Rohtext zusammengesetzt. Dieser ist keineswegs perfekt, aber es ist eine erste Fassung, bei der nur wichtig ist, die Inhalte korrekt aufzuschreiben und wiederzugeben. Stilistische Aspekte sind egal.
Diesen Rohtext verbesserst du schrittweise um einzelne Formulierungen und sonstige Qualitätsmerkmale, bis die fertige Arbeit entsteht. Erst in der fertigen Version kommt es darauf an, dass wirklich alles den wissenschaftlichen Anforderungen entspricht.
Diese Abfolge an Schritten verdeutlicht, wie ein Rohtext entsteht sowie weiterentwickelt wird und greift dabei wesentliche Aspekte des soeben erwähnten Zitats von der Website der Ruhr-Universität Bochum auf. Im Vordergrund steht zunächst die korrekte Darbringung von Inhalten, wobei du als Vorlage für die korrekte Arbeit zunächst den Forschungsprozess genau vorbereitest und durchführst.
Bei der anschließenden Verfassung des Rohtextes nutzt du die Freiräume. Dabei musst du nicht digital arbeiten: Falls es dir lieber ist, darfst du auf einem Blatt Papier mit einem Bleistift schreiben. Du darfst dir nahezu alles in der Rohfassung erlauben, was wissenschaftlich eigentlich verpönt wäre. Der Rohtext darf sogar eine Ansammlung aus Stichpunkten sein. Wichtig ist hier nur: Schreibe. Schreibe. Schreibe. Um beim kreativen Schaffensprozess aus dem letzten Kapitel anzuknüpfen: Schreibe insbesondere im Rohtext an so vielen Stellen, wie du möchtest, aus der Ich-Perspektive, um deine eigene Vorgehensweise später einwandfrei nachvollziehen zu können.
Am Anfang des Schreibprozesses steht nicht primär die Wissenschaft. Gewiss solltest du erste Vorgaben einhalten, um einen adäquaten Forschungsprozess zu gewährleisten, den du im Nachhinein wissenschaftlich darlegen kannst, aber abgesehen von den wenigen im nächsten Abschnitt erläuterten Vorgaben hast du zunächst alle Freiheiten. Schreibe dabei auch Gedanken auf, die du niemals (!) in einem wissenschaftlichen Text verarbeiten würdest, die dir aber kommen.
Beispiel
Du machst eine Umfrage in einem bestimmten Wohngebiet, weil du das sozio-kulturelle Umfeld erforschen möchtest. Dabei wählen bei einer deiner Fragen erstaunlich viele der Befragten eine Option, deren Wahl du nicht erwartet hät-test. Mal angenommen, du würdest dir in deiner Rohfassung die folgende Anmerkung aufschreiben: „Ich kann nicht verstehen, wieso die Mehrheit der Befragten für Option XY stimmt.“ Das sind Gedanken, die dir im Forschungsprozess kommen dürfen und ein Bestandteil deiner Forschung sind.
Du fragst dich, welchen Mehrwert es dir später bei der Ausformulierung deiner wissenschaftlichen Arbeit bietet, falls du in deinem Rohtext eine solch subjektive Anmerkung wie in dem Beispiel aufschreibst?
Der potenzielle Mehrwert ist das „Hinterfragen“: Du könntest herausfinden, ob es bei anderen ähnlichen Datenerhebungen mit einer vergleichbaren Option ebenfalls unerwartete Äußerungen der Befragten gab. Dies würde dir eventuell dazu verhelfen, die von Befragten gewählte Option als generell unerwartet einzustufen und somit als erstaunliches Ergebnis deiner Forschung vorzutragen.
Auch ohne Vergleiche nützt dir eine subjektive Anmerkung in deinen Notizen, weil du sie eventuell als Teil einer eigenen Stellungnahme im Fazit deiner Arbeit anführen kannst – hier siehst du den Bezug zu dem vorigen Kapitel und der Einleitung dieses Kapitels: Alltagssprache wie eine subjektive Anmerkung in deinen Notizen bzw. deinem Rohtext kann durch einen Transformationsprozess zu einer wissenschaftlichen Anregung umgewandelt werden, die wissenschaftlich berechtigt ist.
Inwiefern du subjektive Aussagen im Nachhinein in einer wissenschaftlichen Arbeit angemessen verarbeiten kannst, ist eine individuelle Frage, mit der sich dieser Ratgeber aufgrund des Fokus auf die Stilistik, den Wortschatz und deinen kreativen Schaffensprozess nicht beschäftigen wird. Allerdings ist es im Grunde genommen nur eine Frage der Argumentation: Wenn du etwas gemäß der wissenschaftlichen Normen in deinem Studienfach und den bei deiner Forschungsfrage zur Verfügung stehenden Forschungsmethoden angemessen begründest, ist es auch ein möglicher Inhalt für deine Arbeit.
Halte dich bei der Rohfassung nicht mit Kleinigkeiten auf! Die oberste Devise ist, die Inhalte korrekt – also so, wie du sie in Fachquellen liest oder bei eigenen Datenerhebungen generierst – zu Papier zu bringen. Die Darstellung dieser Inhalte – z. B. Satzanfänge, Formulierungen, Fachbegriffe – ist zunächst größtenteils unwichtig.
… und dabei dennoch die ersten wichtigen Vorgaben einhältst.
Wenn man es ganz einfach sagt: Vieles ist beim Rohtext erlaubt und nicht eng definiert. Ein paar „Prisen Wissenschaft“ erweisen sich allerdings schon im Rohtext als nützlich, weil diese zu Beginn grundsätzlich leicht einzuhalten sind und dir eine gute Vorarbeit für die Bewerkstelligung deiner Arbeit liefern. Dies trifft beispielsweise auf die Formatierung zu.
Auf der Website der Ruhr-Universität Bochum war die Rede davon, dass...
| Erscheint lt. Verlag | 24.8.2022 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Studienarbeiten Masterclass |
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Schulbuch / Wörterbuch ► Schulbuch / Allgemeinbildende Schulen |
| Sozialwissenschaften ► Pädagogik | |
| Schlagworte | Ausdrucksweise verbessern • Bachelorarbeit • Bewerbung schreiben • Deutsch • Die Korrekturen • Fremdsprache • Kommentar • Lektüreschlüssel • Lernen • Professionell Schreiben • Satzanfänge • Schule • Studenten Kochbuch • studienhilfe buch • wissenschaftlich formulieren • Wörterbuch |
| ISBN-10 | 3-7546-7382-3 / 3754673823 |
| ISBN-13 | 978-3-7546-7382-9 / 9783754673829 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,7 MB
Digital Rights Management: ohne DRM
Dieses eBook enthält kein DRM oder Kopierschutz. Eine Weitergabe an Dritte ist jedoch rechtlich nicht zulässig, weil Sie beim Kauf nur die Rechte an der persönlichen Nutzung erwerben.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich