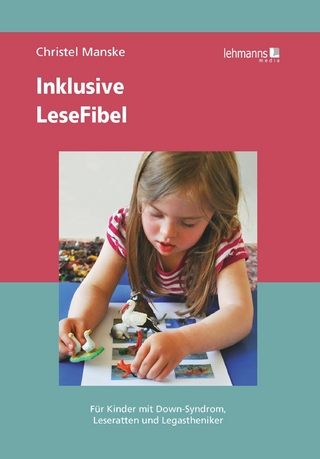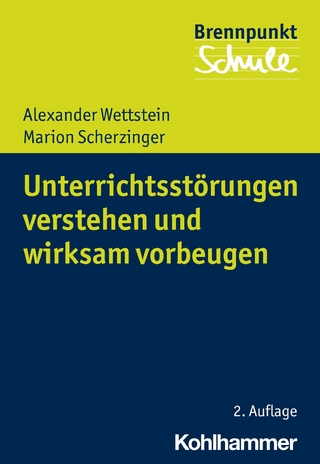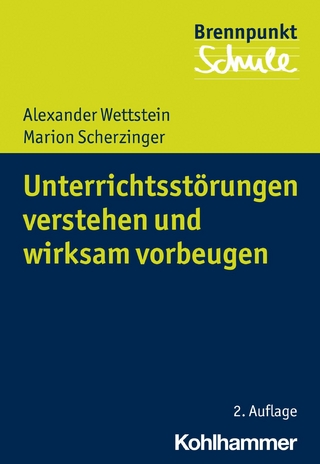Irritation als Chance (eBook)
XV, 425 Seiten
Springer VS (Verlag)
978-3-658-20293-4 (ISBN)
Prof. Dr. Ingrid Bähr, Prof. Dr. Ulrich Gebhard, Prof. Dr. Krieger, Prof. Dr. Andrea Sabisch und Prof. Dr. Wolfgang Sting sind Hochschullehrer und -lehrerinnen am Fachbereich Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg.Britta Lübke, Malte Pfeiffer und Tobias Regenbrecht sind wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Fachbereich Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg.
Vorwort 5
Inhalt 7
Autorinnen und Autoren 9
ITheoretische Beiträge 16
1Irritation im Fachunterricht. Didaktische Wendungen der Theorie transformatorischer Bildungsprozesse 17
1 Krise und Irritation als Ausgangspunkte von Bildungsprozessen 17
1.1 Wovon wir sprechen: Zum Verhältnis von Irritation, Fremderfahrung, Krise und Ungewissheit 19
1.2 Bildung, Erfahrung oder Lernen? 21
1.3 Irritation als Chance 23
1.4 Grundannahme 1: Bildung kann ihren Ausgang von der Auseinandersetzung mit fachlichen Gegenständen nehmen. 25
1.5 Grundannahme 2: Menschen sind bildsam. 27
2 Was bedeutet eine „irritationsfreundliche“ Auseinandersetzung mit einem fachlichen Gegenstand? Eine bildungs- und erfahrungstheoretische Rahmung 28
2.1 Transformatorisches Bildungsverständnis im Rückgriff auf „Fremderfahrung“ und „Krise“ 28
2.2 „Irritation“ und „Phantasie“ als Möglichkeit von Erfahrung im Fachunterricht 36
2.3 Pädagogische Verortung: Irritationssituationen als Fremdaufforderung zum selbsttätigen Umgang mit fachlichen Gegenständen 41
2.4 Resümee und didaktische Wendung 45
3 Empirische Wendung: Zur Erforschbarkeit von Irritationsmomenten im Fachunterricht 47
Literatur 49
2Wahrheit, Gewissheit, Ungewissheit. Eine Skizze systematisch und empirisch gehaltvoller Bildungsprozesstheorie und ihre didaktische Bedeutung 54
1 Wahrheit, Gewissheit, Ungewissheit – eine Skizze 55
2 Lassen sich verschiedene Welt-Selbstverhältnisse auf einen universalen, alle Menschen einenden Grund zurückführen? 59
3 Bedeutung im Zusammenwirken von Denken, Sprache, kulturellem und kommunikativem Handeln 62
4 Wahrheit, Gewissheit und Ungewissheit in Lern- und in Bildungsprozessen 67
5 Bildungsvorhalt und Bildungsprozess als Effekte singulärer Inferenz 71
6 Kohärenzstörung und singuläre Inferenz im Bildungsprozess 82
7 Nihilierung eines Bildungsvorhalts 94
8 Didaktik der Bildungsprozesse 109
Literatur 112
3Responsivität und Medialität in Bildungs- und Erfahrungsprozessen 117
1 Medialität als Zugang 117
1.1 Erfahrung und Fremderfahrung 119
1.2 Zwischen Pathos und Response 121
1.3 Responsive „Arbeit der Erfahrung“ 124
1.4 Transformationsprozesse 126
1.5 Medialität und Erfahrung 128
2 Zur Forderung einer bildungstheoretischen Reflexion der Medialität 130
2.1 Dimensionen des Medialen 131
2.1.1 Struktur der Selbst- und Weltverhältnisse 132
2.1.2 Bildungsanlässe 136
2.1.3 Trans- und Performationsprozesse 138
2.1.4 Empirische Anschlüsse 140
Literatur 141
4Irritation, Erfahrung und Verstehen 145
1 Sinn und Erfahrung in schulischen Lernprozessen 145
2 Die Bildungsdimension ästhetischer Erfahrung 148
3 Hermeneutik, Irritation und bildende Erfahrung 152
4 Zur Phänomenologie des Erfahrungen-Machens 155
5 Irritation als Beginn eines Erfahrungsprozesses 156
6 Die Öffnung eines Vorstellungs- und Phantasieraumes 159
7 Rückzug, Dialog und Versprachlichung 162
8 Fazit 164
Literatur 167
5Ungewissheit, der innere Feind für unterrichtliches Handeln 171
1 Vorbemerkung 171
2 Offenheit und Geschlossenheit 172
3 Offenheit und Ungewissheit 173
4 Die Notwendigkeit der Ungewissheit wie ihre Reduktion 175
5 Klassische Modellierungen zur Gewissheit und Ungewissheit 176
6 Gestaltungsphantasien gegen Ungewissheit 178
7 Grenzen der Pädagogik 179
8 Gewissheitssuggestionen und neue Anforderungen 181
9 Perspektiven 183
Literatur 185
II Empirische Beiträge der Hamburger Forschungsgruppe 186
6Zur empirischen Erforschbarkeit von Irritationen im Fachunterricht. Forschungsstand und method(olog)ische Überlegungen 187
1 Zum Forschungsstand 189
1.1 Perspektiven der allgemeinen Erziehungswissenschaft 191
1.2 Fachdidaktische Perspektiven 196
1.2.1 Perspektiven der Fachdidaktik Biologie und des Sachunterricht 196
1.2.2 Perspektiven der Theaterpädagogik 198
1.2.3 Perspektiven der Fachdidaktik Sport 201
1.2.4 Perspektiven der Kunstpädagogik 205
1.3 Zusammenfassung des Forschungsstandes 207
2 Desiderate und offene Fragen 211
3 Methodologisches und methodisches Vorgehen im Rahmen der Hamburger Studien 214
3.1 Untersuchungsdesign 214
3.2 Datenerhebung und Auswertung 216
3.2.1 Auswertung Biologiedidaktik und Theaterpädagogik 217
3.2.2 Auswertung Sportdidaktik 218
3.2.3 Auswertung Kunstpädagogik 219
4 Forschungsmethodologische Fragen 220
4.1 Reflexion des Verhältnisses von kategorialen zu sequenziellen Zugängen zum Material und Interpretationen 221
4.2 Reflexion normativer Setzungen 222
4.3 Reflexion der Medialität von Bildungsprozessen 223
5 Schlussbemerkung 224
Literatur 224
7Antworten auf Irritationsmomente im Biologie- und Theaterunterricht 230
1 Performativität als Handlungsmoment im Fachunterricht 230
2 Forschungsdesign und Methodik 236
3 Datengewinnung und Auswertung 238
4 Rekonstruktion der Anlässe von und Antwortweisen auf Irritation 239
4.1 „Das tote Schwein“ – eine Fallstudie 239
4.1.1 Diskursive Bearbeitung: Zwischen Gesellschaft und Individuum 240
4.1.2 Szenische Bearbeitung: Dem Schwein eine Stimme geben 245
4.1.3 Vergleichende Betrachtung 249
4.2 Entwicklung eines Modells unspezifischer und spezifischer Antwortweisen auf Irritation 251
4.3 Anlässe für Irritation 256
4.3.1 Gegenstandsbezogene Anlässe 257
4.3.2 Institutionsbezogene Anlässe 259
4.4 Die soziale Dimension von Irritation 260
5 Abschließende Bemerkungen und neue Fragen 261
Literatur 264
Quellen Transkription 267
8Antworten auf Bilder. Zu Irritationen im visuellen Bildungs- und Erfahrungsprozess 268
1 Grundannahmen und begrifflicher Rahmen zur Verortung von Irritationen 269
1.1 Erfahrung und Fremderfahrung 269
1.2 Irritation als Wirkung der Fremderfahrung 270
1.3 Erfahrung und Medialität 271
1.4 Erfahrung und Bildlichkeit 272
2 Fachspezifische Verortung von Irritationen durch die Kunst 273
2.1 Fremderfahrung, Irritation und Ungewissheit im kunstpädagogischen Diskurs 274
2.2 Irritation und Bildlichkeit im bildungstheoretischen Diskurs 276
3 Empirische Erforschung von Irritationen durch Bilder? 277
3.1 Experimentelles Forschungsdesign 277
3.2 Auswahl der Gruppen und der Bilder 278
3.3 Verfremdungen als Irritationspotenzial in der Bildsequenz Lo Straniero 279
3.4 Rahmung des Antwortens auf Lo Straniero 283
3.5 Methodisches: Auswahlprozesse und Darstellungsproblematik 284
3.6 Zur Falldarstellung: Antworten auf Lo Straniero 286
3.7 Zur Fallanalyse: Antworten als Verkörperung zwischen sprachlicher und visueller Ordnung 290
4 Ausblick 293
Literatur 296
Anhang 297
9Irritation als produktives Moment im bewegungsbezogenen Bildungsprozess? 300
1 Fachspezifische theoretische Einführung 301
1.1 Irritation und Ungewissheit als zentrales Moment einer philosophisch-anthropologischen Deutung des Sports 301
1.2 Irritationsmomente und Ungewissheitssituationen im Sportunterricht als „krisenhafter“ Anlass für die Möglichkeit von Bildungsprozessen? 304
2 Empirische Umsetzung 307
2.1 Design 307
2.2 Unterrichtsettings 308
2.3 Beschreibung der Stichprobe 310
2.4 Datenerhebung 311
2.5 Datenauswertung 311
3 Ergebnisse 312
3.1 Zum Umgang von Schüler/innen mit Irritationssituationen im Sportunterricht – ein empiriebasiertes heuristisches Modell 313
3.2 Kategorie Spezifisches Antworten 314
3.2.1 Antworten als Beschäftigung mit dem situativen Moment der Irritation vs. Antworten als Rückgriff auf Referenzsysteme 315
3.2.2 Spontanes Antworten vs. Antworten nach und nach 316
3.2.3 Wechsel/Gleichzeitigkeit der Medien Sprache und Bewegung 316
3.3 Kategorie Unspezifisches Antworten 317
3.4 Fallbeispiele 318
4 Diskussion 325
Literatur 328
10 Zuwenden und Vermeiden. Irritation in kollektiven Theaterprozessen 331
1 Irritation als Auslöser von Schwellenzuständen 334
2 Irritation in Differenzerfahrungen 336
3 Empirischer Untersuchungsgegenstand 338
3.1 Wo treten in kollektiven Probenprozessen Irritationen auf? 339
3.1.1 Das Irritationspotenzial der Aufführungssituation 339
3.1.2 Das Irritationspotenzial von Performativität und Ereignishaftigkeit 342
3.2 Praktiken des Antwortens auf Irritation 344
3.2.1 Praktiken des Vermeidens 345
3.2.2 Praktiken des Zuwendens 347
3.2.3 Paradoxale Strukturen von Zuwenden und Vermeiden 348
4 Fazit und Ausblick 350
Literatur 353
Transkribierte Gruppendiskussionen der Unterrichtsintervention 354
IIIWeitere empirische Beiträge im Themenfeld 355
11Was bedeutet ein aufmerksamer Umgang mit Kontingenz für die kunst- und theaterpädagogische Vermittlungspraxis? Das teambasierte Forschungsprojekt Kalkül und Kontingenz als Anlass für Bildungsprozesse 356
1 Lernen von der Bildungstheorie: die Begriffe ‚Kalkül‘ und ‚Kontingenz‘ 357
2 Das fachdidaktische Forschungsprojekt Kalkül und Kontingenz 359
3 Aufmerksamkeit für Kontingentes herstellen: Kontingenzexperimente mit scores 361
4 Vom Sehen zum ‚Lesen‘ von Situationen 363
5 Die Situation als Text, Dekonstruktion als Lektüremodus 367
Literatur 369
12Auf implizites Wissen setzen: zur Ungewissheit ästhetischer Praktiken 370
1 Ästhetische Praktiken 371
2 Implizites Wissen in ästhetischen Praktiken 372
3 Irritation als Anlass für Reflexion 374
4 Reflexion impliziten Wissens in der Malerei 375
5 Ungewissheit in ästhetischen Praktiken 377
6 Auf implizites Wissen setzen 378
7 Rücksicht auf Ungewissheit 380
Legende zum Interview-Transkript 381
Literatur 381
13Negative Erfahrungen als Reflexionsanlässe im alltäglichen Sportunterricht 383
1 Einleitung 383
2 Erfahrungsprozesse und Krisenkonstellationen im alltäglichen Sportunterricht 385
3 Fachdidaktische Zuspitzungen: Bildung als reflexive Handlungsfähigkeit 389
4 Fallrekonstruktion 391
4.1 Zum methodischen Vorgehen 391
4.2 Der Fall: Anne pfeift 393
5 Fazit 398
Literatur 399
14Ein praktisch-rezeptiver Perspektivwechsel am Beispiel von Arnold Böcklins Toteninsel 402
1 Standortbestimmung 403
1.1 Rezeptionstheoretische und -didaktische Grundlegungen 403
1.2 Konzeptionelle bzw. bildungstheoretische Verortung im Kontext dieses Sammelbandes 406
2 Böcklins Toteninsel als Unterrichtsgegenstand 408
2.1 Die Historische Distanz des Bildes und die Erfahrungsreichweite der Rezipierenden 408
2.2 Das Bild und seine Unbestimmtheitsstellen 410
3 Bildvermittlung 413
3.1 Rezeptionsmethodische Umsetzung 413
3.2 Arbeitsergebnisse 416
4 Resümee 421
Literatur 423
Tatort-Folgen 425
| Erscheint lt. Verlag | 26.10.2018 |
|---|---|
| Zusatzinfo | XV, 420 S. 1 Abb. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Pädagogik ► Schulpädagogik / Grundschule |
| Schlagworte | Bildungstheorie • Didaktik • Erfahrungstheorie • Erziehungswissenschaft • Fachunterricht • Learning and Instruction • Rekonstruktive Sozialforschung • Unterricht |
| ISBN-10 | 3-658-20293-9 / 3658202939 |
| ISBN-13 | 978-3-658-20293-4 / 9783658202934 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 8,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich