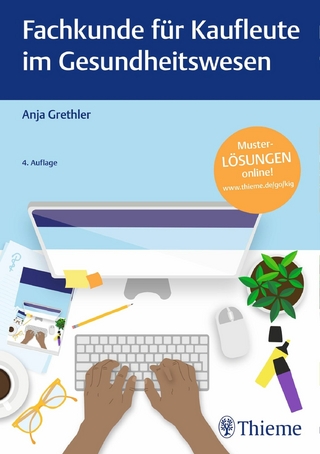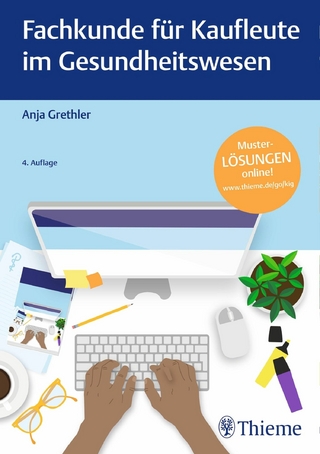ICF-basiertes Training in der Neurorehabilitation (eBook)
216 Seiten
Hogrefe AG (Verlag)
978-3-456-96128-6 (ISBN)
|11|1 Neurorehabilitation im Wandel – wissenschaftliche Denkanstöße
Überblick:
-
Wie erfolgt die Implementierung der ICF-Struktur in der Praxis?
-
Auf welchen Grundlagen basiert das ICF-basierte Training und dessen Integration in die physiotherapeutische Therapieplanung?
1.1 Implementierung der ICF-Struktur
Die tatsächliche Implementierung der ICF-Struktur bei der Therapieplanung, vielmehr noch bei den therapeutischen Interventionen in deren Abfolge, Durchmischung und Intensität, wird bislang ausschließlich in Studien zum Wirksamkeitsnachweis von Einzelinterventionen dokumentiert.
Rentsch et al. (2001) sind der Auffassung, dass bei der Behandlung von neurologischen PatientInnen neben der Lebensqualität vor allem die Selbstständigkeit bei Alltagsaktivitäten im gewohnten oder neuen sozialen Umfeld zu beachten ist, dass sich jedoch auch eine alltagsnahe Auseinandersetzung mit der Realität der Betroffenen und Angehörigen als notwendig erweist. Die Forschergruppe weist des Weiteren darauf hin, dass dabei „nicht die Funktions-/Strukturdimension […], sondern die Dimension der Aktivitäten, die Kontextfaktoren sowie die Partizipationsdimension im Vordergrund“ (Rentsch et al., 2001, S. 177) stehen. Die tabellarische Auflistung nach ICF-Ebenen und Items von Rentsch und Bucher (Rentsch & Bucher, 2005) hat schließlich den Leitgedanken zur Erstellung des didaktischen Modells ICF-basiertes Training in der Neurorehabilitation geliefert.
Da es in wissenschaftlicher Hinsicht noch keine Erkenntnisse bezüglich der Umsetzung von ICF-basierten Therapieplänen in die Praxis gibt, stellt sich die Frage, ob bessere Therapieerfolge möglich wären, wenn die Therapieplanung auch klarer nach der ICF-Struktur mit Überlegungen zu den Richtlinien des motorischen Lernens, der Integration der medizinischen Trainingstherapie (MTT) sowie der Integration von Leitlinien erfolgen würde. Es wurde bereits belegt, dass die ICF-Struktur als Rahmenkonzept für das Definieren von Zielen herangezogen werden kann (Lexell & Brogardh, 2015; Lohmann et al., 2011). Auf diesen und oben genannten Informationen basiert das didaktische Modell.
Als eine Hürde im neurologischen Bereich erweist sich die oft gegensätzlich verwendete Sprache, was zu Konflikten innerhalb der traditionellen konzeptorientierten Therapielandschaft, der existierenden Fach- und wissenschaftlichen Literatur sowie der neuen evidenzbasierten Therapieverfahren führt (siehe Abbildung 1-1). Destinationen wie UK, Niederlande, Australien, Schweiz und andere verfolgen bereits differenziertere Vorgehensweisen, welche in wissenschaftlichen Publikationen jedoch nicht detailliert vorgestellt sind und daher keinen Umsetzungscharakter in Österreich finden.
Die größten Probleme bei der Anwendung stellen die Definitionen der eigentlichen Interventionen dar, begleitet von der Frage: „Was mache ich eigentlich genau mit den PatientIn|13|nen?“, „Verfolge ich immer das vereinbarte/gesetzte Ziel?“ oder: „Verfolge ich in jeder darauffolgenden Therapie ein anderes Ziel bzw. in jeder Therapie mehrere unterschiedliche Ziele?“. Die International Classification of Health Interventions – ICHI (WHO, 2019) ist ein Modell, welches ein optimales Rahmenkonzept sowie einen Lösungsansatz für dieses Problem bietet.
Die ICHI-Datenbank (WHO, 2019) wurde von der WHO entwickelt, um Anwendungsbeispiele hinsichtlich ihrer Interventionen international und national vergleichbar zu machen. Diese Klassifikation ermöglicht eine dem ICD-10 -Modell ähnliche individuelle Kodierung von Interventionen aller Professionen im Gesundheitsbereich, wobei drei Achsen berücksichtigt werden:
-
Gesetztes Ziel (Target)
-
Handlung (Action)
-
Instrument (Means).
In Bereich der Handlungen sind neben klinischen auch therapeutische Interventionen angeführt. Die Interventionen sind in allen ICF-Ebenen und Subkategorien geordnet zu finden (Abbildung 1-2).
Die ICHI-Datenbank beinhaltet vor allem klinische, vereinzelt sind aber auch therapeutische Interventionen zu finden. Da die Interventionen der ICHI nur zum Teil Überbegriffe für Maßnahmen der Physiotherapie enthalten, sind diese im ICF-basierten Training in der Neurorehabilitation erweitert dargestellt. Für das hier beschriebene didaktische Modell wurden Überbegriffe für Methoden anhand der ICF-Struktur pro ICF-Ebene herangezogen. Passend zu den Überbegriffen sind dazu Maßnahmen exemplarisch aufgelistet.
1.2 Grundlagen für die physiotherapeutische Therapieplanung nach der ICF-Struktur
Die Basis für eine spezifische, individuelle, patientInnenorientierte und bestmöglich evidenzbasierte Therapieplanung ist eine adäquate Befundung. Dies schließt die Auswahl adäquater Untersuchungsschritte, im Idealfall von standardisierten Assessments, mit ein. Schon bei diesem Schritt ist es wichtig zu reflektieren, auf welcher ICF-Ebene die Outcomes der verwendeten Assessments als Ressource der PatientInnen eingeordnet werden können. Ideen für diese Zuordnung finden sich in dem Buch „Assessments in der Rehabilitation: Neurologie“ (Schädler et al., 2009) oder „Neuroreha nach Schlaganfall“ (Mehrholz, 2011).
Ist beispielsweise das Ergebnis des repetitiven Bewegungstests „Squats von einer erhöhten Sitzhöhe (110 cm)“ maximal zwölf Mal ohne Ausweichmechanismus möglich, zeigt das Testergebnis die Kraftausdauerfähigkeit der dazu notwendigen Muskulatur. Die Kraft der Muskulatur ist nach der ICF-Struktur in dem Bereich bodyfunctions (b), genauer auf Funktionsebene, definiert. Wird andererseits ein Score bezüglich der motorischen Fähigkeiten einer Person mit der „Motor Funktion Assessment Scale (MFS)“ erhoben, liefert die jeweilige Punkteanzahl Informationen zur allgemeinen Mobilität der Person. Die Mobilität, welche sich genauer aufteilt in Greifen und Manipulieren, Lagewechsel, Transfer, Fortbewegung und posturale Kontrolle, wird in der ICF-Struktur dem Punkt Domains (d), Activities and Participation, genauer ausgedrückt: der Aktivitätsebene und in weiterer Folge auch der Partizipation zugeordnet.
Zum besseren Verständnis für die Zuordnung der therapeutischen Methoden und Maßnahmen im ICF-basierten Training, dienen folgende wissenschaftliche Überlegungen.
Die Aussage: „Viel hilft viel“, ist im Bereich der Neurorehabilitation schon längst trivial |14|und muss differenzierter betrachtet werden. Langhorne et al. (2009), Pollock et al. (2014) und Veerbeek et al. (2014) sprechen von hohen repetitiven und aufgabenspezifischen Intensitäten bei der Rehabilitation nach Schlaganfall. Aus diversen Studien zum motorischen Lernen, Interventionsstudien und systematischen Reviews (Askim et al., 2009; Corbetta et al., 2015; Kwakkel et al., 2015; Mehrholz et al., 2013; Mehrholz et al., 2014; Mehrholz et al., 2017; Platz, 2004; Schmidt & Lee, 2005; Thieme et al., 2012; Thieme et al., 2013; Winstein et al., 2013; Winstein et al., 2016) etc. geht andererseits hervor, dass dieses repetitive Training fokussiert über spezifische Zeitperioden und unter Berücksichtigung evaluierter Intensitäten ablaufen muss, so dass Trainingseffekte und ferner Transferleistungen in den Alltag (Aktivität und Partizipation) überhaupt möglich sind. Gruber et al. (2015) diskutieren dieses Problem in ihrem Artikel über effektives Training und dessen Wirkungsnachweise. Sie beschreiben dabei, dass „auf der Basis der Grundlagenliteratur zu Fertigkeitstransfer […] auch in der Neurorehabilitation von einer höchst aufgabenspezifischen Verbesserung bei Training der koordinativen Voraussetzungen ausgegangen werden“ soll (Gruber et al., 2015). Das bedeutet ferner, dass nur das gelernt wird, was auch trainiert wird. Dies impliziert, dass Aktivitäten und Aufgaben in realen Ausgangstellungen und Situationen trainiert werden müssen, um eben in diesen auch Verbesserungen zu erzielen....
| Erscheint lt. Verlag | 22.11.2021 |
|---|---|
| Zusatzinfo | 102 Abbildungen |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Medizin / Pharmazie ► Gesundheitsfachberufe |
| Schlagworte | bio-psycho-soziales Modell • funktionale Gesundheit • Physiotherapie • Therapieplanung • WHO |
| ISBN-10 | 3-456-96128-6 / 3456961286 |
| ISBN-13 | 978-3-456-96128-6 / 9783456961286 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 5,9 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich